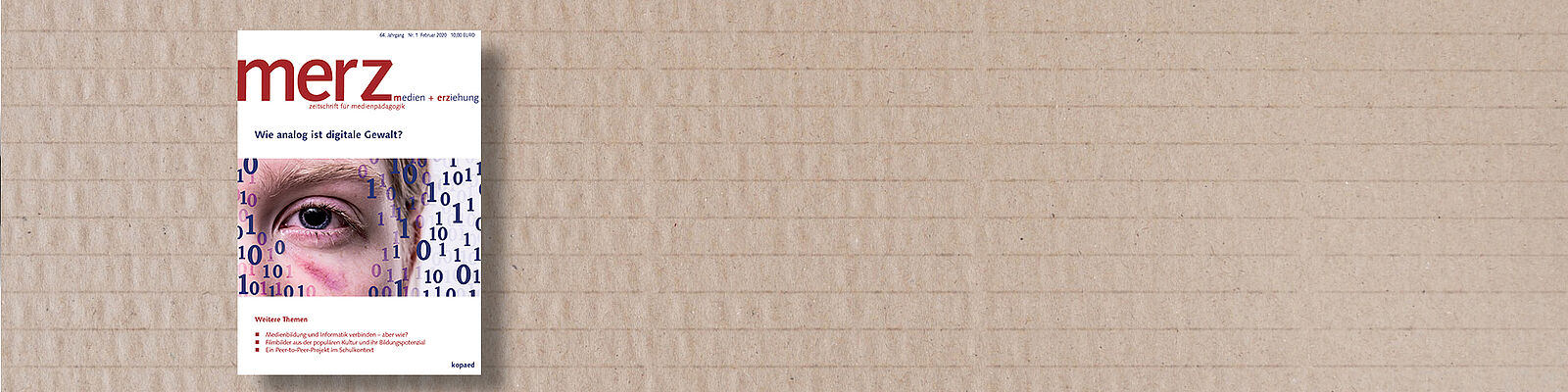2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?
„Regierungen der industriellen Welt, ihr müden Giganten aus Fleisch und Stahl, ich komme aus dem Cyberspace, der neuen Heimat des Geistes. Ich erkläre den globalen sozialen Raum, den wir errichten, als gänzlich unabhängig von der Tyrannei, die ihr über uns auszuüben anstrebt.“ Dieser vielzitierte und pathetische Satz stammt aus der von John Perry Barlow veröffentlichten Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace aus dem Jahr 1996. Gerade einmal 25 Jahre später ist die Verantwortung von allen, auch von diesen Regierungen bei der Suche nach Lösungen gefordert, wie diese neue Heimat eines Geistes zu (maß-)regeln ist, der selbst zum Tyrannen geworden ist. Die Zeiten, aus denen die Unabhängigkeitserklärung stammt, war verbunden mit der Idee eines neuen sozialen, kreativen und gemeinschaftlichen Miteinanders ‚im Internet‘, einer neuen Welt im Cyberspace. Abgesehen davon, dass sich die Begrifflichkeiten gewandelt haben (der Begriff Cyberspace mutet fast schon unzeitgemäß an), ist heute unverkennbar: Digitale Interaktionen bieten nicht nur Möglichkeiten für eine sinnstiftende, konstruktive und kreative Nutzung, sondern auch für Formen des zerstörerischen Gegenteils. In der öffentlichen Diskussion erscheint dieses Internet immer wieder als Nährboden für Hass und Hetze, als Sprachrohr für extreme Ansichten und als Herd für eine ‚verbale Giftsuppe‘. Aber auch weit über die Gewalt der Sprache hinaus werden digitale Instrumentarien des Netzes für die Überwachung, Kontrolle, Verleumdung oder anderweitige Bedrohungen gegenüber einzelnen Personen genutzt.
merz 2020/01 zeigt, wie breit das Spektrum digitaler Gewalt sein kann. Und deutet an, wie weit digitale Aggression in das Leben eindringt.
aktuell
Swenja Wütscher: BPjM veröffentlicht Gefährdungsatlas
Der Kinder- und Jugendmedienschutz bedarf einer Neuausrichtung seiner Schutzziele und Instrumente. Infrastrukturelle Schutz- und Hilfemechanismen in den Angeboten sollen künftig für Kinder, Jugendliche und Erziehende eine unbeschwerte Teilhabe an digitalen Medien gewährleisten. So lautet die kinderrechtliche Einordnung des Gefährdungsatlas. Zum effektiven Schutz vor Gefährdungen sind Anbieter gefordert, ihre Angebote mit altersgerechten Voreinstellungen sowie Schutz- und Hilfemechanismen auszustatten. Der Gefährdungsatlas ist ein erstes Ergebnis des bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) angesiedelten Strategieprozesses „Digitales Aufwachsen. Vom Kind aus denken. Zukunftssicher handeln.“ Auf der Grundlage der Mediennutzungsrealität von Kindern und Jugendlichen gibt er Orientierung über Medienphänomene, den mit ihnen verbundenen Gefährdungen sowie gegebenenfalls auch Entwicklungschancen für Kinder und Jugendliche. Auch nimmt er eine kinderrechtliche Einordnung der Herausforderungen an den Jugendmedienschutz vor. Dem Anspruch folgend vom Kind aus zu denken, wird die Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen im Kontext der Mediennutzung sowie ihr Mediennutzungsverhalten vorangestellt. Deutlich werden die Mediatisierung und Digitalisierung aller Lebensbereiche von Kindern und Jugendlichen sowie die hierdurch beförderte Kommerzialisierung ihrer Lebenswelt. Erkenntnisse über das Nutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen werden entlang von drei Altersgruppierungen (Zwei- bis Sechsjährige, Sechs- bis 13-Jährige und etwa Zwölf- bis 18-/19-Jährige) nach Medientätigkeiten strukturiert dargestellt sowie in erzieherische Kontexte gesetzt. Neben den Gefährdungen werden unter anderem auch fördernde Funktionen für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Blick genommen, die mit den Phänomenen assoziiert sind und den kinderrechtlichen Teilhabeanspruch an der digitalen Mediennutzung begründen. Der in der Autorenschaft des JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis in Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut (HBI) entstandene Gefährdungsatlas ist das erste im Rahmen der Zukunftswerkstatt erarbeitete Ergebnis, wie auch die erforderliche Wissensbasis für den weiteren Arbeitsprozess.
www.bundespruefstelle.de
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Swenja Wütscher
Beitrag als PDFEinzelansichtDana Neuleitner: ARD/ZDF Onlinestudie 2019
Die mobile Internetnutzung ist weiterhin auf einem hohen Niveau: 90 Prozent der Unter- 50-Jährigen nutzen das Internet zumindest gelegentlich von unterwegs, 37 Prozent davon täglich. Das sind Ergebnisse der ARD/ZDFOnlinestudie2019. Der Anteil der 14- bis 29-Jährigen liegt mit 69 Prozent dabei deutlich über dem Durchschnitt. Insgesamt nutzen 71 Prozent der Befragten das Internet jeden Tag, wobei dessen mediale Inhalte durchschnittlich 87 Minuten lang konsumiert werden. Die Gruppe der 14- bis 29-Jährigen hält sich nahezu geschlossen (98 %) täglich im World Wide Web auf. Die Zahl der Onlinerinnen und Onliner ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Mit 89 Prozent bzw. 62,9 Millionen der Deutschsprachigen ab 14 Jahren hält sich das Niveau allerdings weiterhin hoch. Mit fünf Prozentpunkten verzeichnet insbesondere die Gruppe der 60- bis 69-Jährigen den größten Zuwachs (54 %), in den anderen Altersgruppen treten nur leichte Schwankungen auf. Vor allem Kommunikation (47 %) und Medienkonsum (41 %) sind beliebt. Für den Aufwärtstrend der medialen Internetnutzung sind Video- und Musik-Streamingdienste verantwortlich. Netflix wird von 13 Prozent der Befragten wöchentlich genutzt, dicht gefolgt von Amazon Prime (12 %). Dazu kommen Videos in Mediatheken, auf Social-Media-Plattformen oder Nachrichtenportalen. Welches Angebot bevorzugt wird, ist altersabhängig: Video-on-Demand- Angebote werden besonders von 14- bis 29-Jährigen genutzt, während die Älteren Mediatheken den Vorrang geben. Lineares Fernsehen war dennoch auch 2019 noch beliebter als die Online-Variante. Auch bei den Sozialen Medien bleibt der Spitzenreiter unverändert: Trotz negativer Schlagzeilen unter anderem zu Datenpannen sicherte sich Facebook wieder den ersten Platz. Die jüngere Generation bevorzugt jedoch Instagram, die dieses Jahr mit vier Prozentpunkten (13 %) den stärksten Zuwachs an täglichen Nutzenden erreicht hat. Für die Studie wurden von Januar bis April 2019 insgesamt 1.500 Deutschsprachige ab 14 Jahren in computergestützten Telefoninterviews befragt. Durch eine Fusionierung mit den Kerndaten der Massenkommunikation Trends 2019 entstanden insgesamt 2.000 Fälle als Daten basis. Durchgeführt wurde die Studie erstmals vom Institut Kantar.
www.ardzdfonlinestudie.de
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Dana Neuleitner
Beitrag als PDFEinzelansichtStefanie Neumaier: Bildungskonzept für Medienpädagogik an Waldorfschulen
Der Bund der Freien Waldorfschulen (BdFWS) hat ein eigenes Bildungskonzept für Medienpädagogik entwickelt. Damit sollen alle 249 Waldorfschulen des BdFWS mit einem Plan zum Umgang mit und Einsatz von digitalen Medien ausgestattet werden. In der frühkindlichen Bildung folgt das Konzept der anthropologischen Weltanschauung der Waldorfpädagogik und geht dabei davon aus, dass digitale Medien diese Entwicklungsphase behindern würden. Daher stehe die Sinnesförderung von Motorik und Sprache im Vordergrund. Didaktische Überlegungen finden sich darin, wie technische Neuheiten Einzug in die Lehre an Waldorschulen finden können, unter Wahrung des Gleichgewichts zu tradierten Vorstellungen der Waldorfpädagogik. Mit Eintritt in die Grundschule wird nach einem Kennenlernen analoger Technik auf den Erkenntnissen der Lernenden aufgebaut, um den sinnvollen Einsatz digitaler Medien mit ihnen zu eruieren. Im Wissenserwerb unterscheidet das Konzept zwischen sozialen Kompetenzen in einer medialen Welt und technischem Know-how. Zum Übergang in die Pubertät der Lernenden wird in Form eines Medienführerscheins das Ziel verfolgt, den geschützten Rahmen der Kindheit zu verlassen und ein selbstständiges Medialitätsbewusstsein zu fördern. Die Medienmündigkeit abgehender Schülerinnen und Schüler stellt das Leitziel des medienpädagogischen Konzeptes dar. Bei der Betrachtung des vorliegenden Rahmens des BdFWS vor dem Hintergrund der Strategie der Kultusministerkonferenz (KMK) zur Bildung in der digitalen Welt fällt auf, dass beide Paper das Ziel verfolgen, Schülerinnen und Schüler als medienkompetente Absolventinnen und Absolventen zu verabschieden. Ein deutlicher Unterschied geht aus der Einbindung digitaler Medien in den Schulalltag hervor. Während der BdFWS im Sinne der Anthropologie davon spricht, nach einer Medienabstinenz in der frühen Kindheit den Einsatz von analoger und digitaler Technik sukzessiv in der Schule einzugliedern, gestaltet sich das Wording der KMK hierzu deutlich akzeptanzorientierter: „Ziel der Kultusministerkonferenz ist es, dass möglichst bis 2021 jede Schülerin und jeder Schüler jederzeit, wenn es aus pädagogischer Sicht im Unterrichtsverlauf sinnvoll ist, eine digitale Lernumgebung und
einen Zugang zum Internet nutzen können sollte“ (KMK 2017, S. 6).www.waldorfschule.de
Antje Müller: stichwort: Performanz
Während Lippmann noch in den Köpfen der Menschen steckte und nach Lösungen für die Installation einer Stereotypen-gestützten Pseudowelt suchte, sprang John L. Austin mit seinem Werk How to do things with words (1962) bereits auf den Bandwagon des gesprochenen Wortes auf. In der Beschäftigung mit dessen Kraft erkannte er die enge Verbindung eines gelungenen Sprechaktes mit seiner gezielten Absicht und seinen sich stetig verändernden Bedingungen. Performanz und performative Äußerungen bleiben jedoch nicht alleiniger Gegenstand der Linguistik. Als ‚performances‘ bilden sie die Grundpfeiler der Theater- und Kulturwissenschaft, als (Geschlechts-)Identitäts-konstruierendes Moment beeinflussen sie Gender-Theorien und damit auch die Politik, und als professionelle sprachliche Leistung sind sie Teil der Arbeits- und Organisationspsychologie – die übrigens auch von der trendigen ‚contextual performance‘ oder dem freiwilligen ‚Extraeinsatz‘ spricht. Im Querschnitt ist also die Rede von sozialen Prozessen, die mal mehr auf soziale Handlungen – theatralisch, inszeniert oder ritualisiert –, mal mehr auf autonom, intentional agierende Subjekte (Performativität) zielen. Sprechakte übernehmen entweder die Funktion, symbolische Handlungen durchzuführen (z. B. Ja-Wort), oder sie nehmen einen konstitutiven Charakter durch ihre kraftvollen Äußerungssubjekte an (z. B. über Zitate). Dabei stellt sich nicht die Frage nach wahr oder falsch, zentral ist ein Gelingen oder Scheitern dieser Akte. Es geht um die erlernte und evaluierte Kompetenz, Sprachwissen und -können im sozialen Kontext adäquat einzusetzen. Sprich: Es geht darum, sich den Herausforderungen der Bühne des Lebens (mit seinen Requisiten, Rollen, Erwartungen und Statisten) zu stellen, sich auch in andere hineinzuversetzen und sich diesen gegenüber verständlich zu machen, ohne zu überfordern oder zu langweilen. Erfolg kann dann bedeuten, im Brian’schen Always-Look-on-the-Bright-Side-of-Life-Stil das weltliche Leben eines Kollektivs auf den Kopf zu stellen oder aber auch im Thunberg‘schen Stil öffentlich wirksam einen sozialen Wandel ins Rollen zu bringen. Aller etwaigen Künstlichkeit von performances zum Trotz, wird so oder so der Ernst des Lebens mit einer neuen sozialen Wirklichkeit konfrontiert. Doch bevor kommunikative Einsichten neue Perspektiven eröffnen, Weltwahrnehmungen oder Handeln verändern, beginnt ein frühzeitiges Erlernen, fachliche bzw. domänentypische Sprach- und Handlungsmuster in Gebrauch zu nehmen. Die medial gestützte Dynamik und Wiederholbarkeit von normgeladenen Sprechakten, ob eines herzerwärmenden Helene-Fischer-Konzerts oder eines kontroversen Rezo-Clips, machen allerdings Prozesse der Kompetenzvermittlung um Wissen, Bewerten, Handeln, Reflexion, Orientierung oder Positionierung nicht leichter. Neben der Basiskompetenz, Sprache (grammatikalisch, orthografisch, syntaktisch und kontextbezogen) korrekt anzuwenden, sind somit Teilbereiche der Didaktik gefragt, Sprachwissen zu den vielfältigen, zunehmend digitalisierten Kommunikationsräumen aufzubereiten und entsprechende Kompetenzen mit den Lernenden im Modus der Performanz zu schulen und zu evaluieren. Denn nur ein hier zugrunde gelegter reflektierter Gebrauch kann später in der Lebenspraxis durch wechselseitigen Zugang und Teilhabe an Sprechakten im sozialen Gefüge zur aktiven Weltgestaltung befähigen. Literacy – Lesekompetenz – Weltmodellierung
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Antje Müller
Beitrag als PDFEinzelansichtAndrea Stephani: YouTube: Mehr Schutz für Kinder
Seit dem 01. Januar 2020 sind YouTuberinnen und YouTuber verpflichtet, Videos zu kennzeichnen, die speziell Kinder adressieren. Im September 2019 musste YouTube eine Rekordstrafe von gut 170 Millionen US-Dollar zahlen. Das hatte die US-Aufsichtsbehörde Federal Trade Commission (FTC) entschieden, nachdem bei Videos für Kinder auf der Plattform ein deutlicher Verstoß gegen die Richtlinien der Children’s Online Privacy Protection Rule (COPPA) festgestellt worden war. YouTube hat daraufhin klare Änderungen im Kontext der Rubrik Kids Content auf der Plattform vorgenommen. Zur Sicherung der Privatsphäre und Verringerung der Interaktionsmöglichkeiten erhalten Videos dieser Rubrik künftig keinen Zugang mehr zu Features wie personalisierten Werbeanzeigen, Kommentaren, Live Chats oder Playlists. Auch ist die Option der direkten Monetarisierung und des Super Chat deaktiviert. Kanäle, die sich in erster Linie an Kinder richten, haben demnach nun keine Storys mehr, keine Benachrichtigungen und keinen Community-Tab. Denn all diese Funktionen benötigen konkrete Nutzerdaten. Da YouTube nie für Nutzende unter 13 Jahren ausgelegt gewesen sei, werden diese Änderungen nun umgesetzt und betreffen alle Nutzenden dieser Videos – also Videos, die speziell markiert wurden oder von YouTube als Kinder-Videos eingeordnet wurden. Das tatsächliche Alter des registrierten Nutzenden spiele dabei keine Rolle. Darüber hinaus sind Creatorinnen und Creatoren verstärkt angehalten, Inhalte, die für die junge Zielgruppe bestimmt sind, eindeutig als solchen Content zu kennzeichnen. Dafür wurde eine neue Zielgruppeneinstellung eingeführt; diese funktioniert einzeln für jedes Video oder für den gesamten Kanal. Für Kanäle, die zweifelsfrei Videos für Kinder veröffentlichen, wird die Einstellung vom System automatisch angepasst. Ein entsprechendes Prüf- und Meldeverfahren ist nicht geplant, auch die Form der Kennzeichnung sowie mögliche Sanktionen des Plattformbetreibers bleiben unkonkret. Werbung dürfen YouTuberinnen und YouTuber weiterhin im Kontext dieser Videos schalten, allerdings nicht personalisiert und auf Interessen der jungen Rezipierenden abgestimmt. Sinkendes Interesse für Werbetreibende und Ausfälle in den Werbeeinnahmen könnten die Folge sein. Bestimmungen der COPPA gelten zwar lediglich für US-Dienste, YouTube betont jedoch die Verbindlichkeit der Richtlinien unabhängig vom Standort.
www.youtube.googleblog.com
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Andrea Stephani
Beitrag als PDFEinzelansichtAndrea Stephani: Shell Jugendstudie 2019
Durchschnittlich verbringen Jugendliche 3,7 Stunden am Tag im Internet, wobei keine Unterschiede zwischen Geschlecht, Alter oder sozialem Hintergrund festgestellt werden konnten. So ein Ergebnis der Shell Jugendstudie 2019, die regelmäßig Jugendliche zu ihrer Meinung befragt. Drei Viertel der Jugendlichen nutzen das Internet mindestens einmal am Tag aus Unterhaltungszwecken (76 %). Von den Befragten nutzen 71 Prozent das Netz auch für Schule und Ausbildung oder um Informationen über Politik und Gesellschaft zu suchen. Informationen zu politischen Themen sucht die Mehrheit der Jugendlichen inzwischen auf Online-Kanälen wie Nachrichten-Websites (20 %), Messenger Apps (14 %) und YouTube (9 %). YouTube als Informationsquelle wird von etwa jedem zweiten Jugendlichen als wenig bis nicht vertrauenswürdig wahrgenommen. Auch Facebook vertrauen mehr als zwei von drei Jugendlichen nicht. Das größte Vertrauen besteht weiterhin gegenüber klassischen Medien. Nachrichten in der ARD oder ZDF werden demgegenüber von der großen Mehrheit als vertrauenswürdiger eingestuft. In Bezug zur Freizeitgestaltung mit Medien streamt mittlerweile etwa die Hälfte der Jugendlichen Videos im Internet (45 %), im Jahr 2015 waren es 15 Prozent. Im Vergleich dazu nutzt nur ein kleiner Anteil (12 %) das Internet zur Veröffentlichung von Fotos, Videos, Musik oder Blogbeiträgen. Das klassische Fernsehen ist von knapp der Hälfte auf 33 Prozent gesunken. Tendenziell wird die Bedeutung des Fernsehens in den nächsten Jahren auch weiter abnehmen. Die Nutzung von Spielen an Konsolen oder Computern ist mit 23 Prozent stabil geblieben. Vor allem bei zwölf- bis 14-jährigen Jungen ist das Spielen an Konsolen oder Computern eine beliebte Freizeitbeschäftigung (57 %). Die Shell Jugendstudie wird alle vier Jahre vom Mineralölkonzern Shell finanziert. Bei dieser Studie werden Jugendliche im Alter von zwölf bis 25 Jahren nach ihren Einstellungen, Verhalten, Werten und Gewohnheiten befragt.
www.shell.de/ueberuns/ shelljugendstudie
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Andrea Stephani
Beitrag als PDFEinzelansichtDana Neuleitner: Bluesky: Twitters neuer Social-Media-Standard
Mit dem geplanten offenen und dezentralen Social-Media-Standard Bluesky will Twitter die Zukunft Sozialer Medien verändern. Twitter-Gründer Jack Dorsey verspricht sich Lösungsmöglichkeiten zu verschiedenen Herausforderungen – bessere Möglichkeiten etwa bei der Moderation von Inhalten sowie eine vereinfachte Durchsetzung weltweiter Richtlinien. Durch das Open-Source-Projekt könnten der Mikroblogging-Dienst und andere Mitglieder der Branche dezentralisiert werden. Soziale Netzwerke wie Twitter oder Facebook sind auf der Infrastruktur eines Betreibers aufgebaut, nicht auf offenen Protokollen. Jack Dorsey kritisiert in diesem Zusammenhang die Empfehlungsalgorithmen der Plattformen: Der Wert von Sozialen Medien verlagere sich weg von Hosting und der Entfernung von Inhalten hin zu Aufmerksamkeit-lenkenden Algorithmen. Wie Dorsey via Twitter anmerkt, seien diese in der Regel proprietär, weswegen es bisher nicht möglich sei, Alternativen zu wählen oder zu entwickeln. Bluesky soll hier Abhilfe schaffen und durch offene Empfehlungsalgorithmen eine gesunde Diskussionskultur fördern. Gleichzeitig ergibt sich so für Twitter oder andere denkbare Clients die Möglichkeit, die Verantwortung für problematische Inhalte auf Bluesky abzuwälzen. Die Responsibilität für Hate Speech oder Desinformation würde auf den dezentralen Standard ausgelagert werden. Für die Konstruktion von Bluesky soll daher ein kleines, bis zu fünfköpfiges Entwicklerteam betraut werden. Die Technologie soll möglicherweise auf Blockchain fußen und mehr Wettbewerb und Innovation begünstigen. Angesichts der Tatsache, dass Twitter nicht der einzige Mikroblogging-Dienst ist, der auf einen offenen Standard setzen möchte, ist das Vorhaben an sich nicht besonders innovativ: Das 2016 vom deutschen Programmierer Eugen Rochko entwickelte Soziale Netzwerk Mastodon baut auf dem offenen, dezentralen Protokoll ActivityPub auf. Mastodon erlaubt seinen Nutzenden, von verschiedenen Servern aus direkt miteinander zu agieren und Mikroblogging zu betreiben. International gesehen ist es jedoch weitgehend unbekannt. Von Seiten Mastodons wird Dorsey vorgeworfen, er sei lediglich bestrebt, seine Macht weiter auszubauen. Bisher ist noch nicht beschlossen, ob das Bluesky-Team existierende offene Standards erweitern oder einen gänzlich neuen entwerfen soll.
www.twitter.com/jack/status/ 1204766078468911106
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Dana Neuleitner
Beitrag als PDFEinzelansicht
thema
Susanne Heidenreich/Ulrike Wagner: Editorial: Digitale Gewalt – analoge Muster in digitalen Dimensionen?
„Regierungen der industriellen Welt, ihr müden Giganten aus Fleisch und Stahl, ich komme aus dem Cyberspace, der neuen Heimat des Geistes. Ich erkläre den globalen sozialen Raum, den wir errichten, als gänzlich unabhängig von der Tyrannei, die ihr über uns auszuüben anstrebt.“ Dieser vielzitierte und pathetische Satz stammt aus der von John Perry Barlow veröffentlichten Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace aus dem Jahr 1996. Gerade einmal 25 Jahre später ist die Verantwortung von allen, auch von diesen Regierungen bei der Suche nach Lösungen gefordert, wie diese neue Heimat eines Geistes zu (maß-)regeln ist, der selbst zum Tyrannen geworden ist. Die Zeiten, aus denen die Unabhängigkeitserklärung stammt, war verbunden mit der Idee eines neuen sozialen, kreativen und gemeinschaftlichen Miteinanders ‚im Internet‘, einer neuen Welt im Cyberspace. Abgesehen davon, dass sich die Begrifflichkeiten gewandelt haben (der Begriff Cyberspace mutet fast schon unzeitgemäß an), ist heute unverkennbar: Digitale Interaktionen bieten nicht nur Möglichkeiten für eine sinnstiftende, konstruktive und kreative Nutzung, sondern auch für Formen des zerstörerischen Gegenteils. In der öffentlichen Diskussion erscheint dieses Internet immer wieder als Nährboden für Hass und Hetze, als Sprachrohr für extreme Ansichten und als Herd für eine ‚verbale Giftsuppe‘. Aber auch weit über die Gewalt der Sprache hinaus werden digitale Instrumentarien des Netzes für die Überwachung, Kontrolle, Verleumdung oder anderweitige Bedrohungen gegenüber einzelnen Personen genutzt. Eine Übersicht über derzeit bekannte Phänomene in diesem Heft (siehe Glossar, S. 24 ff.) zeigt, wie breit das Spektrum digitaler Gewalt sein kann. Und es deutet an, wie weit digitale Aggression in das Leben eindringt. Die Eskalation von Gewalt gegenüber öffentlichen Personen und der Übergang von digitalen Attacken in den physischen, öffentlichen Raum finden regelmäßig ihren Platz in der medialen Berichterstattung. Was aber passiert bei digitaler Gewalt im häuslichen, alltäglichen Umfeld? Welche Aufmerksamkeit und Hilfe erfahren die Betroffenen von digitaler Aggression, die aus dem privaten Beziehungsumfeld ausgeübt wurden? Was passiert mit Ex-Partnerinnen bzw. Ex-Partnern, die privates Bildmaterial veröffentlichen? Oder mit Kindern, die selbst in den privatesten Momenten zum Postingmaterial ihrer Eltern werden? Mit Jugendlichen, die von ihren Eltern permanent digital kontrolliert und überwacht werden? Eltern, die von ihren Kindern in Sozialen Netzwerken verleumdet werden? Kinder, die von Kindern gemobbt werden? Die Aufzählung ist lang und zeigt: Digitale Gewalt ist im Privaten angekommen und lässt sich zumindest auf zwei Ebenen verorten: Zum einen der im obigen Zitat benannten staatlichen Überwachung und Kontrolle des Netzes durch Regierungen, die in Gewalt gegen Gruppen und einzelne Bürgerinnen und Bürger münden kann. Zum anderen tangiert sie Gewalt auf der privaten, persönlichen Ebene, mit dem Ziel, die Integrität einzelner Subjekte anzugreifen. Letzteres bildet den Themenschwerpunkt dieses Heftes. Die zentrale Ausgangsfrage dabei ist, ob digital ‚nur‘ fortgesetzt wird, was in der physischen Welt ‚aus Fleisch und Stahl‘ seit langem traurige Realität ist, oder ob Gewalt-Phänomene eine neue Qualität über ihre Ausübung im digitalen Raum erreichen. Wie analog ist also digitale Gewalt? Ein Konsens aller Beiträge zeigt: Digitale Gewalt kann nicht getrennt von ‚analoger Gewalt‘ betrachtet werden. Angewendet wird sie meist in Ergänzung oder zur Verstärkung von bestehenden Gewaltverhältnissen und -dynamiken (siehe Vobbe in dieser Ausgabe, S. 29 ff.). Hinzu kommt, dass sich die digitale Medienwelt nicht mehr mit einem Appell, einem Verbot oder der Löschung von einzelnen Beiträgen eines Senders, einer Produzentin bzw. eines Produzenten ‚ins Reine bringen‘ lässt. Sie konstituiert sich durch unzählige Beiträge, Einträge und Interaktionen der Netzgemeinde. Ganz im Sinne Barlows, der diesen entstandenen Geist jedoch noch als sozialen Raum ganz ohne Tyrannei vorstellte. Doch neben organisierten Netzwerken sind es eben auch die einzelnen Individuen, die mit ihrem Hass, ihrer Hetze und Gewaltaufrufen (virtuelle) Räume miterschaffen, in denen Gewalt ‚zusammenschweißt‘ und ein Klima der Angst geschürt wird. Juristische Mittel reichen nicht, um grundlegend digitale Gewaltakte zu verhindern. Hier ist – neben anderen Disziplinen – die (Medien-)Pädagogik einmal mehr gefordert, Konzepte für die Vermittlung ethischer Fragen des (digitalen) sozialen und damit demokratischen Miteinanders zu entwickeln und umzusetzen. Für die Soziale Arbeit kristallisiert sich die Aufgabe heraus, stärker als bisher Konzepte und Maßnahmen zum Schutz für die Betroffenen solcher Gewaltakte in der Beratungs- und Hilfepraxis einzubinden. Aus diesen Überlegungen heraus ergaben sich für uns als Fachredaktion folgende, die Auswahl der Beiträge leitende Fragen:
- Welche Formen digitaler Gewalt lassen sich differenzieren?
- Was passiert, wenn sich Attacken gegen Einzelne im digitalen Raum richten? Besitzt die Gewalt eine neue Qualität, zum Beispiel durch die bleibende und ständige Präsenz der persönlichen Gewaltattacke?
- Finden die Betroffenen adäquate Hilfe? Gibt es genügend und vor allem spezielle Beratungsstellen und/oder Hilfeangebote, die Betroffene nutzen können? Welche fachlichen Kompetenzen sind für eine zielführende Prävention notwendig?
- Welche staatlichen und nicht-staatlichen Stellen sind für welche Fragen im Zusammenhang mit Formen digitaler Gewalt geeignete Partner? Und nicht zuletzt: Werden Betroffene in ihrer – vielleicht ‚nur digitalen‘ – Verletzung ernst (genug) genommen?
Handlungsbedarf
Die intensive Arbeit an diesem Themenheft zeigte deutlich: Viele Beratungsstellen und Praxiseinrichtungen sind immer stärker mit dieser Problematik konfrontiert, sie sind ebenso für die möglichen und realen Folgen für das Leben der Betroffenen sensibilisiert. Doch was fehlt, sind sowohl kurzfristige Hilfestellungen als auch langfristig greifende Konzepte des Schutzes und der Prävention. Es fehlt zudem ganz grundsätzlich an Forschungen und Studien zu digitalen Gewaltformen, zu deren Auswirkungen auf das reale Leben für verschiedene Menschengruppen, zu nachhaltigen Schutzmaßnahmen und eine Offenlegung rechtlicher Leerstellen. Eine Ausnahme stellt hier das Thema (Cyber-) Mobbing unter Jugendlichen dar, das im Vergleich dazu häufig im Forschungsfokus steht. Die Recherchen nach medien- und sozialpädagogischen Modellen und Konzepten, die sich mit Formen digitaler Aggression befassen, zeigt: Es finden sich zwar viele engagierte Projekte im lokalen Raum oder begrenzt auf ein bestimmtes Phänomen (z. B. Hate Speech oder Mobbing), jedoch fehlt es an übergreifenden Konzepten, die sich den Phänomenen digitaler Gewalt grundsätzlich annähern. Für die pädagogische Praxis relevant sind diese Phänomene allesamt zweifellos, jedoch besteht die Schwierigkeit, diesen inhaltlich komplexen, multiperspektivischen Themenkomplex angemessen zu bearbeiten. Zusammen mit einer förderpolitischen Ausgangslage, in der langfristig angelegte Projekte meist nur geringe Chancen auf Umsetzung haben, verwundert es daher nicht, dass diese Leerstellen bestehen. Doch auch in der Forschung stellt sich das Thema Digitale Gewalt als ein komplexes Geflecht aus fundierten Erkenntnissen zur Gewaltforschung und (noch) unbekannten Auswirkungen im digitalen Leben dar. Eine Folge der sich stets ändernden, teils undurchschaubaren technischen Möglichkeiten, die sowohl die Formen von Gewalt verändern als auch deren Präsenz. Trotz der Erfordernisse gestaltete sich das Auffinden von wissenschaftlichen Autorinnen und Autoren für die vorliegende Ausgabe als sehr schwierig. Um die Brisanz des Themenfeldes aufzeigen zu können entschieden wir uns, Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Praxisfeldern und der Praxisforschung in Form von Interviews zu Wort kommen zu lassen, was unserer Ansicht nach der allgemeinen Lage in diesem Themenfeld gerecht wird: Derzeit existieren mehr Fragen und Bedarfe als Antworten und Lösungen.Perspektiven auf digitale Aggression
Im einführenden Artikel geben Nicola Döring und M. Rohangis Mohseni einen fundierten Überblick über Formen digitaler Aggression, deren Ursachen und den Herausforderungen bei der Prävention. Zunächst klären sie, was unter interpersonaler Gewalt und Aggression zu verstehen ist und welche Besonderheiten digitale interpersonale Gewalt aufweist. Sie differenzieren fünf Besonderheiten: Neben der Zeit- und Ortsunabhängigkeit und der Tatsache, dass sich interpersonale Gewalt im (teil-)öffentlichen Raum mittels Text-, Foto- und Videodokumenten realisiert, ist es vor allem die Möglichkeit, digitale Gewalt in unterschiedlichen Lebensbereichen der Betroffenen auszuüben und die Tatsache, dass digitale Spuren kaum endgültig gelöscht werden können. Immer wieder neue Begrifflichkeiten sind in diesem Themenfeld zu hören und zu lesen. Die Redaktion hat eine für dieses Heft relevante Auswahl in einem Glossar zusammengestellt. Ausgehend davon, dass Akte digitaler Aggression längst in die Sphäre zwischenmenschlicher Beziehungen eingedrungen sind, ist die Beratungspraxis vor neue Herausforderungen gestellt, insbesondere vor dem Hintergrund sich rasant entwickelnder technischer Anwendungen und Möglichkeiten. merz hat dazu drei Interviews geführt: Die Brisanz bei sexualisierter Gewalt mit digitalem Medieneinsatz sieht Frederic Vobbe in der Transzendierung der Gewalt. Digitale Medien fungieren als ‚Struktur-Verstärker‘, da die Verletzungen ursprüngliche Gewalthandlungen zeitlich, räumlich, technisch und psychosozial übersteigen. Er fordert eine kritisch-emanzipatorische Haltung in Schutz- und Präventionskonzepten ein, die nicht primär am individuellen Verhalten ansetzen. Dabei müssen verschiedene Gruppen an der Verankerung beteiligt werden. Er sieht vor allem die Anbieter digitaler Kommunikationsdienste in der Pflicht, denen es „unter dem Label von Freiheit“ hauptsächlich um ihre Profitorientierung geht. Gerade sie hätten die technischen Voraussetzungen für eine personalisierte Primärprävention und Aufklärung, für systematische Eindämmung von diskreditierenden Bild- und Videoaufnahmen und für eine Vernetzung der spezialisierten Unterstützungssysteme. Daneben brauche es weiterhin fundierte Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen, die „Einsichten in die Dynamiken von Gewaltkontexten“ eröffnet. Vobbe fordert eine kollektive Haltung gegenüber sexualisierter Gewalt, was nur über umfassende Konzepte erreicht werden kann, die partizipativ erarbeitet werden. Ans Hartmann vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bff) stellt im Interview fest, dass geschlechtsspezifische Gewalt zunehmend digitalisiert wird und durch das Voranschreiten der Digitalisierung des Alltags auch technische Anwendungen und Medien in die Gewalthandlungen und -dynamiken integriert werden. Hartmann sieht hierdurch folgende Herausforderungen für Beratende: Sie brauchen weiterhin Zeitressourcen für eine intensive psycho- soziale Beratung und müssen über aktuelles Wissen über Formen digitaler Aggression verfügen. Immer häufiger sind sie mit technischen Aspekten konfrontiert, gleichzeitig können sie aber keine IT-Beratung leisten. Dieses Manko ortet Hartmann aber auch bei Polizei und Justiz, um effiziente und rasche Unterstützungsleistungen zu bieten. Insgesamt fordert Hartmann mehr finanzielle und personelle (Ab-)Sicherung der Beratungsstellen, aber auch der Behörden, die durch die neuen Anforderungen zum großen Teil an ihre Grenzen stoßen. Jugendliche in ihrer Lebenswelt zu verstehen, sie zu sensiblen Themen zu erreichen und ihnen bei Problemen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen ist Ziel von JUUUPORT. Susanne Neuerburg erläutert, wie die Peer-to-Peer-Beratung der gemeinnützigen Organisation funktioniert und welchen Mehrwert dies bietet: Mit einer gleichberechtigten Beratung auf Augenhöhe begleiten jugendliche Scouts Kinder und Jugendliche und sorgen mit regelmäßigen Treffen zusammen mit psychologischer Beratung durch erwachsene Expertinnen und Experten für Erfahrungsaustausch. Während reale Gewaltattacken in interpersonellen Beziehungen häufig im Verborgenen bleiben, sind Formen digitaler Aggression teilweise mit Öffentlichkeit verbunden bzw. zielen gerade auf Wirksamkeit in der Öffentlichkeit ab. Marlis Prinzing erläutert anhand zahlreicher Beispielen und Belege, wie Personen, die in „der“ Öffentlichkeit stehen, von digitaler Aggression betroffen sind und welche Vorgehensweisen die Aggressoren verfolgen. Sie argumentiert aus einer ethischen Perspektive, welche Handlungsmöglichkeiten gestärkt werden müssen, wie zivilgesellschaftliche Akteure Einfluss nehmen können und macht eindringlich klar, wo Erfordernisse auf individueller aber vor allem auf gesellschaftlicher Ebene liegen. Abschließend wird ein besonderes Beratungsangebot, das Unterstützung bei digitaler Gewalt in seinen vielfältigen Formen bietet, vorgestellt. HateAid ist eine in Berlin ansässige Beratungsstelle, welche Menschen unterstützt, die im Netz mit digitaler Gewalt angegriffen werden. Ihre Besonderheit liegt in der Unterstützung bei der Rechtsdurchsetzung. Hier übernimmt HateAid in entsprechenden Fällen auch die Finanzierung von Zivilklagen.
Conclusio
Diesen Themenschwerpunkt zu konzipieren und umzusetzen war von Herausforderungen begleitet, die auch sinnbildlich dafür stehen können, wie digitale Gewalt verhandelt wird: Eine erste Herausforderung betrifft die Diskussion um Begriffe in diesem sensiblen Themenkomplex: Wie Döring und Mohseni ausführen, sind immer wieder neue Begrifflichkeiten im Umlauf, die aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich analoge Gewalt und solche mittels technischer Hilfsmittel immer stärker verzahnt. Zweitens sind abseits des Themas (Cyber-)Mobbing deutliche Lücken sowohl in der wissenschaftlichen Beschäftigung als auch in der konzeptionellen Arbeit der Prävention zu konstatieren. Übergreifend wird deutlich, dass es zwar auf der individuellen Ebene wichtig ist, vor allem Kinder und Jugendliche stark zu machen gegen die Zumutungen, die ihnen medienvermittelt begegnen. Daneben braucht es jedoch umso mehr eine breitere gesellschaftliche Diskussion zu den sozialen Welten, in denen Kinder und Jugendliche aufwachsen. So haben Kommunikations- und Medienanbieter letztlich fast freie Hand in der weiteren Verfügung über die Daten der Nutzenden und geben wenig Einblick in ihr Geschäftsgebaren mit dieser höchst wertvollen Währung. Ihre Kommunikationsdienste sind gleichzeitig für Kinder und Jugendliche äußerst attraktiv. Wenn es um die ethische Verantwortung für das Ausüben digitaler Formen von Aggression und die Folgen auf Seiten der Betroffen geht, bleiben die Anbieter aber zumeist außen vor und die Konzepte erschöpfen sich im individuellen Aushandeln und dem Schutz vor gewalthaltigen Handlungen online. Aus den Interviews wird eine dritte Herausforderung offenkundig: Die Netzwerkarbeit unter Betroffenen, Beratungsstellen und allen Einrichtungen, die mit Gewalt befasst sind, ist stärker zu forcieren. Nur durch Unterstützungsnetzwerke fühlen Betroffene, dass sie nicht alleine gelassen werden. In einem solidarischen Zusammenschluss können auch die Beratungsstellen zeigen, dass alle Formen von Gewalt zu ächten sind. So kann ein gesellschaftlicher Diskurs angestoßen werden, in dem gemeinschaftliche und partizipative Handlungsweisen zu einer solidarischen Weiterentwicklung von Gesellschaft beitragen und wieder etwas vom Ursprungsgeist des Internets zu spüren ist. Eine offene Frage bleibt, ob sich ‚die Gesellschaft‘ derzeit tatsächlich polarisiert und radikalisiert. Ist dies ein realer Trend, oder entsteht ein verzerrtes Bild der Gesellschaft durch die lautstarken und gewalttätigen Äußerungen Einzelner? Kommt vielleicht solidarisches, gemeinschaftliches Handeln ohne Lautstärke aus und vollzieht sich über andere Kanäle? Für eine Vision des globalen sozialen Raumes, in dem kreatives, gemeinschaftliches und partizipatives Handeln bestimmend ist, würde es sich lohnen, diesen Fragen aus Sicht von Forschung und Praxis nachzugehen.
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Susanne Heidenreich, Ulrike Wagner
Beitrag als PDFEinzelansichtNicola Döring/M. Rohangis Mohseni: Digitale interpersonale Gewalt und Aggression. Forschungsstand und medienpädagogische Herausforderungen
Interpersonale Gewalt und Aggression werden heutzutage oft mittels digitaler Medien ausgeübt: Online Hate Speech, Cybermobbing, Online Grooming, Revenge Porn, Online Stalking, Trolling, Scamming und weitere Erscheinungsformen sind zu beobachten. Was wissen wir über diese Phänomene, ihre Ursachen und Erscheinungsformen sowie wirksame Gegenmaßnahmen?
Literatur:
Barlow, John Perry (1996). Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace. www.heise.de/tp/features/Unabhaengigkeitserklaerung-des-Cyberspace-3410887.html [Zugriff: 22.10.2019].Dekker, Arne/Koops, Thula/Briken, Peer (2016). Sexualisierte Grenzverletzungen und Gewalt mittels digitaler Medien. Zur Bedeutung digitaler Medien für Phänomene sexualisierter Grenzverletzungen und Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Berlin. www.cora-baden.de/doc/expertise.pdf [Zugriff: 22.10.2019]
Döring, Nicola (2012). Erotischer Fotoaustausch unter Jugendlichen: Verbreitung, Funktionen und Folgen des Sexting. In: Zeitschrift für Sexualforschung, 25 (1), S. 4–25. DOI: 10.1055/s-0031-1283941.
Döring, Nicola (2014). Consensual Sexting Among Adolescents: Risk Prevention Through Abstinence Education or Safer Sexting? In: Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 8 (1). DOI: 10.5817/ CP2014-1-9.
Döring, Nicola (2019). Sozialkontakte online. In: Schweiger, Wolfgang/Beck, Klaus (Hrsg.), Handbuch OnlineKommunikation. Wiesbaden: Springer, S. 167–194.
Döring, Nicola/Mohseni, M. Rohangis (2019a). Fail Videos and Related Video Comments on YouTube: a Case of Sexualization of Women and Gendered Hate Speech? In: Communication Research Reports, 36 (3), S. 254–264. DOI: 10.1080/08824096.2019.1634533.
Döring, Nicola/Mohseni, M. Rohangis (2019b). Male Dominance and Sexism on YouTube: Results of Three Content Analyses. In: Feminist Media Studies, 19 (4), S. 512–524. DOI: 10.1080/14680777.2018.1467945.
Kaspar, Kai/Gräßer, Lars/Riffi, Aycha (Hrsg.) (2017). Online Hate Speech. Perspektiven auf eine neue Form des Hasses. München: kopaed.
Popow, Christian/Ohmann, Susanne/Paulus, Frank W. (2018). „Cyberbullying“ unter Jugendlichen. In: Monatsschrift Kinderheilkunde, 166 (6), S. 498–503. DOI: 10.1007/s00112-018-0464-8.
Robertz, Frank J./Oksanen, Atte/Räsenen, Pekka (2016). Viktimisierung junger Menschen im Internet. Leitfaden für Pädagogen und Psychologen. Wiesbaden: Springer.
Scheithauer, Herbert/Hayer, Tobias (2007). Psychologische Aggressionstheorien und ihre Bedeutung für die Prävention aggressiven Verhaltens im Kindes- und Jugendalter. In: Gollwitzer, Mario/Pfetsch, Jan/Schneider, Vera/ Schulz, André/Steffke, Tabea/Ulrich, Christiane (Hrsg.), Gewaltprävention bei Kindern und Jugendlichen. Aktuelle Erkenntnisse aus Forschung und Praxis. Göttingen: Hogrefe, S. 15–37.
Tedeschi, James T./Felson, Richard B. (1994). Violence, Aggression, and Coercive Actions. Washington, DC: American Psychological Association.
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Nicola Döring, M. Rohangis Mohseni
Beitrag als PDFEinzelansichtSwenja Wütscher: Glossar: Digitale Gewalt. Eine Begriffssammlung
Cybergrooming, Doxing, Happy Slapping, Revenge Porn, Swatting – die unterschiedlichen Begrifflichkeiten, Anglizismen und Wortschöpfungen, die zu digitalen Gewaltformen kursieren, lassen sich nicht alle trennscharf voneinander abgrenzen. Oft gibt es auch für ähnliche Phänomene verschiedene Begriffe, die sich aber nicht alle von selbst erklären. Eine Sammlung einiger relevanter Diskriminierungsformen und Bezeichnungen.
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Swenja Wütscher
Beitrag als PDFEinzelansichtSwenja Wütscher: Sexualisierte Gewalt mit digitalem Medieneinsatz. Ein Interview mit Frederic Vobbe, SRH Hochschule Heidelberg
Sexualisierte Gewalt mit digitalem Medieneinsatz umfasst unterschiedliche Phänomene. Neben einer Sexualisierung ist der Einsatz digitaler Medien zur Anbahnung, Fortsetzung wie auch zur Verübung der jeweiligen Gewaltformen charakteristisch. Eine wesentliche Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe besteht in der Prävention und Intervention eben dieser Gewalt. Doch bestehende Schutzkonzepte berücksichtigen die Spezifika des digitalen Medieneinsatzes meist nur bedingt. Swenja Wütscher im Gespräch mit Frederic Vobbe, Professor für Soziale Arbeit an der SRH Hochschule Heidelberg.
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Swenja Wütscher
Beitrag als PDFEinzelansichtSwenja Wütscher: Aktiv gegen digitale Gewalt. Ein Interview mit Ans Hartmann, bff
Der Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bff) vertritt bundesweit knapp 200 Fachberatungs stellen, die den Großteil der ambulanten Unterstützungsarbeit bei geschlechtsspezifischer Gewalt in Deutschland leisten. Auch das Thema Digitale Gewalt ist dort und in den Beratungsstellen schon länger relevant. Swenja Wütscher im Gespräch mit Ans Hartmann, Leiter*in des Projekts bff: aktiv gegen digitale Gewalt.
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Swenja Wütscher
Beitrag als PDFEinzelansichtAntje Müller: Online-Beratung von Jugendlichen für Jugendliche. Ein Interview mit Susanne Neuerburg, JUUUPORT
JUUUPORT.de ist eine Online-Beratungsplattform, die Jugendlichen bei Problemen im Netz, wie Cybermobbing, Sexting und Datenklau, Unterstützung anbietet. Die Beratung übernehmen Jugendliche, die sich ehrenamtlich als Scouts neben Schule und Studium bei JUUUPORT engagieren. Susanne Neuerburg, medienpädagogische Projektmanagerin und Ansprechpartnerin für die Arbeit der jugendlichen Beraterinnen und Berater bei JUUUPORT, im Gespräch mit Antje Müller, gewährt Einblicke in die Peer-Ausbildung und die Beratung der Scouts.
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Antje Müller
Beitrag als PDFEinzelansichtMarlis Prinzing: Zwischen virtuellen Schlägen und analogen Mistkarren. Digitale Aggression auf Personen in der Öffentlichkeit
Digitale Aggressoren kennen oft keine Grenzen für ihren Hass. Wer in der Öffentlichkeit steht, rückt besonders rasch ins Fadenkreuz – häufig samt Familie. Im digitalen Kommunikationsraum brauen sich in Windeseile Shitstorms zusammen, Attacken gegen Frauen zielen mit besonderer Heftigkeit unter die Gürtellinie. Digitale Gewalt wird auch real bedrohlich. Im Januar 2020 verlangte ein Bürgermeister einen Waffenschein, um sich wehren zu können. Wie aber kann man Empörungswellen und Attacken entgegentreten?
Literatur:
Bundesministerium des Innern (2019). Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2019/massnahmenpaket-bekaempfung-rechts-und-hasskrim.pdf?__blob=publicationFile&v=5 [Zugriff: 13.01.2020]
Campact (Hrsg.) (2019). Hass im Netz. Der schleichende Angriff auf unsere Demokratie. Eine bundesweite repräsentative Untersuchung. https://blog.campact.de/wp-content/uploads/2019/07/Hass_im_Netz-Der-schleichende-Angriff.pdf [Zugriff: 13.01.2020]
Conradi, Elisabeth (2001). Take Care. Grundlagen einer Ethik der Achtsamkeit. Frankfurt a. M.: Springer.
Deutscher Juristinnenbund (2019). Policy Paper. Mit Recht gegen Hate Speech – Bekämpfung digitaler Gewalt gegen Frauen. https://www.djb.de/verein/Kom-u-AS/ASDigi/st19-23/ [Zugriff: 13.01.2020]
Fanta, Alexander (2019). Facebook hilft deutschen Ermittlern gegen Hetze – und will damit Meldepflicht abwenden. Netzpolitik.org. https://netzpolitik.org/2019/facebook-hilft-deutschen-ermittlern-gegen-hetze-und-will-damit-meldepflicht-abwenden/ [Zugriff: 13.01.2020]
Forsa (2017). Hate Speech. Ergebnisbericht. Online-Befragung im Auftrag der Landesanstalt für Medien NRW. http://www.lfm-nrw.de/fileadmin/user_upload/lfm-nrw/Service/Pressemitteilungen/Dokumente/2017/Ergebnisbericht_Hate-Speech_forsa-Mai-2017.pdf [Zugriff: 13.01.2020]
Freidel, Morten (2019). Hetze gegen Lübcke: „Eine widerliche Ratte weniger“ faz.net. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fall-walter-luebcke-hass-im-netz-war-sein-begleiter-16243476.html [Zugriff: 13.01.2020]
Hamich, Christopher (2019). Staaten sollen regulieren, nicht Unternehmen. In: Netzpolitik.org. https://netzpolitik.org/2019/staaten-sollten-regulieren-nicht-unternehmen/; darin: David Kaye https://cdn.netzpolitik.org/wp-upload/2019/10/un-bericht-meinungsfreiheit-hate-speech.pdf [Zugriff: 13.01.2020]
Hate Aid. https://hateaid.me/ [Zugriff: 13.01.2020]
Höffe, Otfried (Hrsg.) (1995). Nikomachische Ethik. Berlin: Akademie.
Hoppenstedt, Max (2019). Straftaten im Netz: Facebook will deutschen Behörden schneller Daten von Online-Hetzern geben. In: Sueddeutsche.de. https://www.sueddeutsche.de/digital/facebook-hatespeech-1.4662303 [Zugriff: 13.01.2020]
Kaspar, Kai/ Gräßer, Lars/ Riffi, Aycha (Hrsg.) (2017). Online Hate Speech – Perspektiven auf eine neue Form des Hasses. München: kopaed.
Klicksafe (o.J.). Ethik macht Klick. Modul 2: Verletzendes Online-Verhalten. www.klicksafe.de/themen/medienethik/verletzendes-online-verhalten/ [Zugriff: 13.01.2020]
Köver, Chris (2019). #netzohnegewalt: Neue Kampagne gegen digitale Gewalt. In: Netzpolitik. https://netzpolitik.org/2019/netzohnegewalt-neue-kampagne-gegen-digitale-gewalt/ [Zugriff: 13.01.2020]
Media-Kanzlei Frankfurt (2019). Das Landgericht Berlin und die zulässige Meinungsäußerung. Klarstellung des untergeschobenen Falschzitates. https://media-kanzlei-frankfurt.de/anwalt/das-langericht-berlin-und-die-zulaessige-meinungsaeusserung [Zugriff: 13.01.2020]
Netz ohne Gewalt. http://netzohnegewalt.org/ [Zugriff: 13.01.2020]
N.N. (2019). 1241 Angriffe auf Politiker. In: Sueddeutsche.de. https://www.sueddeutsche.de/politik/extremismus-1241-angriffe-auf-politiker-1.4735545 [Zugriff: 13.01.2020]
Prinzing, Marlis (2015). Shitstorms: Nur Wutstürme oder begründete demokratische Proteste? In: Imhof, Kurt et al. (Hrsg.): Demokratisierung durch Social Media? Mediensymposium Band 12. Wiesbaden: Springer, S. 145-168.
Prinzing, Marlis (2017). Kompass, Kante, Kompetenz. Warum es nicht genügt, über die Verrohung des Umgangs im Netz zu klagen. In: Communicatio Socialis, 50 (3), S. 334-344.
Prinzing, Marlis (2020). Aufgeklärt und selbstbestimmt: Vorschlag für eine Strategie zu ethisch orientiert gestalteten digitalen Kommunikationsräumen. Ein Essay. In: Döbler, Thomas/Pentzold, Christian/Katzenbach, Christian (Hrsg., im Erscheinen): Räume digitaler Kommunikation. Neue Schriften zur Online-Forschung. Köln: Halem.
Rawls, John (1979). Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt a. M.: Springer.
Schneider, Christoph/Leest, Uwe/Katzer, Catarina/Jäger, Reinhold (2014). Mobbing und Cybermobbing bei Erwachsenen. Eine empirische Bestandsaufnahme in Deutschland, hrsg. vom Bündnis gegen Cybermobbing gemeinsam mit der Arag-Versicherung. https://www.buendnis-gegen-cybermobbing.de/fileadmin/pdf/studien/mobbingstudie_erwachsene_2018.pdf [Zugriff: 13.01.2020]
Verfolgen statt nur löschen. https://www.medienanstalt-nrw.de/regulierung/internet/hassrede-im-netz/verfolgen-statt-nur-loeschen-rechtsdurchsetzung-im-netz.html [Zugriff: 13.01.2020]
Schneider, Christoph/Leest, Uwe (2018). Mobbing und Cybermobbing bei Erwachsenen – die allgegenwärtige Gefahr. Eine empirische Bestandsaufnahme in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz. https://www.buendnis-gegen-cybermobbing.de/fileadmin/pdf/studien/mobbingstudie_erwachsene_2018.pdf [Zugriff: 13.01.2020]
von der Pfordten, Dietmar (2009). Menschenwürde, Recht und Staat bei Kant. Fünf Studien.Paderborn.
Warzel, Charlie (2019). How an Online Mob Created a Playbook for a Culture War. In: New York Times. https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/15/opinion/what-is-gamergate.html [Zugriff: 13.01.2020]
Zapp Medienmagazin (2020). #Umweltsau: Vom Kinderlied zur Morddrohung. https://www.youtube.com/watch?v=QDh5Dpm2MGE [Zugriff: 13.01.2020]
Zapp Medienmagazin (2020b). Fall Gutjahr: mit rechter Hetze allein gelassen? https://www.youtube.com/watch?v=WQFfJCOw9aE [Zugriff: 13.01.2020]
Landgericht Berlin (2020). Beschwerde einer Politikerin wegen ihres Antrags gegen eine Social Media Plattform auf Gestattung der Herausgabe von Nutzerdaten teilweise erfolgreich. www.berlin.de/gerichte/presse/pressemitteilungen-der-ordentlichen-gerichtsbarkeit/2020/pressemitteilung.885539.php [Zugriff: 13.01.2020]
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Marlis Prinzing
Beitrag als PDFEinzelansicht
spektrum
Gerhard Tulodziecki: Medienbildung und Informatik verbinden – aber wie?
In der Diskussion um „Bildung in der digitalen Welt“ (KMK 2016/2017) ist weitgehend unbestritten, dass ein gegenwarts- und zukunftsorientiertes Bildungskonzept sowohl der Digitalisierung als auch der Mediatisierung Rechnung tragen muss. Damit verbundene Problemlagen kumulieren bei dem Versuch, für die Schule ein verbindliches Fach mit einer Verknüpfung von Informatik und Medienbildung lehrplanmäßig auszuformen. Dazu hat unter anderem das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg Vorpommern (2019) einen Rahmenplan vorgelegt. Dessen Analyse zeigt, dass Informatik- und Medienbildungsanteile dort eher nebeneinanderstehen als miteinander verknüpft sind. Deshalb werden im Anschluss an die Analyse weiterführende Überlegungen zu ihrer Verbindung angesprochen und ein entsprechender Ansatz zur Diskussion gestellt.
Literatur:
Dagstuhl-Erklärung (2016). Bildung in der digitalen vernetzen Welt. dagstuhl.gi.de/fileadmin/GI/Hauptseite/Aktuelles/Projekte/Dagstuhl/Dagstuhl-Erklaerung_2016-03-23.pdf [Zugriff: 09.10.2019]
Döbeli Honegger, Beat (2016). Mehr als 0 und 1. Schule in einer digitalisierten Welt. Bern: hep.
Döbeli Honegger, Beat/Hermida, Martin/Schmid, Regina (2019). Zur Entwicklung des Masterstudiengangs Medien und Informatik“. In: Pasternak, Arno (Hrsg.), Informatik für alle, 18. GI-Fachtagung Informatik und Schule. Bonn: Gesellschaft für Informatik, S. 231-236.
D-EDK [Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz] (2014, bereinigte Fassung 2016). Lehrplan 21. Medien und Informatik. v-fe.lehrplan.ch/container/V_FE_DE_Modul_MI.pdf [Zugriff: 24.10.2019]
Frankfurt-Dreieck (2019). Bildung in der digital vernetzten Welt. Ein interdisziplinäres Modell. www.keine-bildung-ohne-medien.de/wp-content/uploads/2019/07/Frankfurt-Dreieck-zur-Bildung-in-der-digitalen-Welt.pdf [Zugriff: 09.10.2019]
GI [Gesellschaft für Informatik] (2008). Grundsätze und Standards für die Informatik in der Schule. Bildungsstandards Informatik für die Sekundarstufe I. Beilage zu LOG IN 28 (150/151).
Herzig, Bardo (2016). Medienbildung und Informatische Bildung - Interdisziplinäre Spurensuche. In: Themenheft 25 der Online-Zeitschrift Medienpädagogik. www.medienpaed.com/article/view/428/427 [Zugriff: 17.01.2020]
Hubwieser, Peter (2016). Informatische Bildung und Medienerziehung. In: merz / medien + erziehung, 62 (4), S. 19–26.
Kultusministerkonferenz (KMK) (2016 in der Fassung von 2017). Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz. www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2018/Strategie_Bildung_in_der_digitalen_Welt_idF._vom_07.12.2017.pdf [Zugriff: 09.10.2019]
Knaus, Thomas (2016). digital – medial – egal? Ein fiktives Streitgespräch um digitale Bildung und omnipräsente Adjektive in der aktuellen Bildungsdebatte. In: Brüggemann, Marion/Knaus, Thomas/ Meister, Dorothee M. (Hrsg.), Kommunikationskulturen in digitalen Welten. Konzepte und Strategien der Medienpädagogik und Medienbildung. München: kopaed, S. 99–130.
Kommer, Sven (2018). Medienpädagogik und Informatik – Gemeinsam oder besser getrennt? In: merz | medien + erziehung, 62 (4), S. 11–18.
Merz, Thomas (2018). Endlich Verbindlichkeit für schulische Medienbildung in der Schweiz. Lehrplan 21 löst mit Modul „Medien und Informatik“ in der Deutschschweiz gewünschte Dynamik aus. In: merz | medien + erziehung, 62 (4), S. 43–50.
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (MBWK) (2019). Rahmenplan für die Sekundarstufe I. Regionale Schule, Gesamtschule. Informatik und Medienbildung. www.bildung-mv.de/export/sites/bildungsserver/downloads/unterricht/rahmenplaene_allgemeinbildende_schulen/Informatik/RP_INFO_MR_5-10.pdf [Zugriff: 09.10.2019]
Tulodziecki, Gerhard (2016). Konkurrenz oder Kooperation? Zur Entwicklung des Verhältnisses von Medienbildung und informatischer Bildung. In: Themenheft 25 der Online-Zeitschrift Medienpädagogik. www.medienpaed.com/article/view/425/424 [Zugriff: 09.10.2019]
Tulodziecki, Gerhard (2017). Thesen zu einem Curriculum zur „Bildung in einer durch Digitalisierung und Mediatisierung beeinflussten Welt“. In: merz / medien + erziehung, 61 (2), S. 50–56.
Tulodziecki, Gerhard/Herzig, Bardo/Grafe, Silke (2019). Medienbildung in Schule und Unterricht. Grundlagen und Beispiele. 2. Auflage. Bad Heilbrunn: Klinkhardt/UTB.
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Gerhard Tulodziecki
Beitrag als PDFEinzelansichtUlrich Kumher: Filmbilder aus der populären Kultur und ihr Bildungspotenzial. Die Erde aus kosmischer Perspektive
Angesichts der Faszination, welche (Bewegt-)Bilder der Erde aus kosmischer Perspektive auszulösen vermögen, wird das Bildungspotenzial dieses Bildmaterials zur Förderung von Medienkompetenz sowie ihr Nutzen für globales Lernen untersucht. Der Fokus des Beitrags liegt dabei auf Filmbildern aus der populären Kultur, die in den Blockbustern Gravity, Jupiter Ascending, Elysium und Interstellar vorkommen. Der Beitrag widmet sich auch den Möglichkeiten, wie das Bildungspotenzial der Filmbilder ausgelotet werden kann.
Literatur:
Bahr, Matthias/Leimgruber, Stephan (2010). Verantwortung für die Eine Welt. In: Hilger, Georg/Leimgruber, Stephan/Ziebertz, Hans-Georg, Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf. 6. Aufl. München: Kösel, S. 472–484.
Boff, Leonardo (1994). Von der Würde der Erde. Ökologie – Politik – Mystik. Düsseldorf: Patmos.
Froese, Klaus (2018). Schöpfung aus zehn Kilometer Höhe. In: Jahrbuch der Religionspädagogik 34, S. 11–12.
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Ulrich Kumher
Beitrag als PDFEinzelansichtAndreas Hudelist/Caroline Roth-Ebner: „Können wir bitte auch mal Mathe so machen?“ Ein Peer-to-Peer-Projekt im Schulkontext
Im Beitrag wird das Konzept des Peer Learnings am Beispiel des Projekts Flipped Classroom erläutert. In dem Projekt agierten Schülerinnen und Schüler selbst als Peer-Educators. Sie bereiteten interaktive Unterrichtseinheiten innerhalb des Themenkomplexes Digitalisierung vor, um diese einer Peergroup sowie deren Lehrkräften zu präsentieren. Es werden Stärken und Herausforderungen dieses Ansatzes aufgezeigt und Schlüsselfaktoren für die Realisierung formuliert.
Literatur:
Biech, Elaine (2015). 101 Ways to Make Learning Active Beyond the Classroom. New Jersey: Wiley & Sons.
Demmler, Kathrin/Heinemann, Kerstin/Schubert, Gisela/Wagner, Ulrike (2012). Peer-to-Peer-Konzepte in der medienpädagogischen Arbeit. München: JFF – Institut für Medienpädagogik. www.digitale-chancen.de/content/downloads/index.cfm/key.1276 [Zugriff: 09.07.2019]
Geier, Gerald/Ebner, Martin (2013). Medienkompetenzentwicklung in einem außerschulischen Lernvideoprojekt für Kinder. In: Medienimpulse, 51 (2), S. 1–8. www.medienimpulse.at/articles/view/538 [Zugriff: 09.07.2019]
Glade, Julia/Hübner, Anett (2013). Peer me up. Vom Peer zum Peer-Educator. In: merz, 57 (1), S. 64–68.
Karrasch, Hartmut/Kühn, Tore-Olaf/Lemke, Jens/Olsen, Christoph/Ramm, Gesa/Riecke-Baulecke, Thomas (2015). Digitale Schule. Trends, Fakten, Praxistipps. Schulmanagement Handbuch, Bd. 156. München: Oldenbourg.
Lang, Catherine/Craig, Annemieke/Casey, Gail (2017). A pedagogy for outreach activities in ICT: Promoting peer to peer learning, creativity and experimentation. In: British Journal of Educational Technology, 48 (6), S. 1491–1501.
Manzan Perine, Cristiane/Rowsell, Jennifer (2016). Die Innen-Außen-Perspektive: schulische mit außer-schulischer Literacy verbinden. In: ide – informationen zur deutschdidaktik, 42 (4), S. 46–56.
Mattes, Wolfgang (2011). Methoden für den Unterricht. Kompakte Übersichten für Lehrende und Lernende. Paderborn: Schöningh.
Ozdamli, Fezile/Asiksoy, Gulsum (2016). Flipped classroom approach. In: World Journal on Educational Technology: Current Issues, 8 (2), S. 98–105.
Prensky, Marc (2001). Digital Natives, Digital Immigrants, Part 1. In: On the Horizon, 9 (5), S. 1–6. DOI: 10.1108/10748120110424816.
Rohr, Dirk/Strauß, Sarah/Aschmann, Sabine/Ritter, Denise (2016). Der Peer-Ansatz in der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen: Projektbeschreibungen und -evaluationen. Weinheim: Beltz Juventa.
Roth-Ebner, Caroline/Duller, Nicole (2018). Medienperformanz als didaktisches Prinzip medienpädagogischer Praxis. In: Medienimpulse, 56 (4), S. 1015012. www.medienimpulse.at/article/view/mi1298 [Zugriff: 09.07.2019]
Topping, Keith J. (2005). Trends in Peer Learning. In: Educational Psychology, 25 (6), S. 631–645.
Wegmann, Konstanze/Roth-Ebner, Caroline (2013). Medienpädagogik peer-to-peer: Das Praxisbeispiel „Digital Teens“. In: Medienimpulse, 51 (2), S. 1–9. www.medienimpulse.at/articles/view/551 [Zugriff: 09.07.2019]
Zirfas, Jörg (2017). Zur Performativität der Pädagogik. In: ide – informationen zur deutschdidaktik, 41 (4), S. 18–29.
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Caroline Roth-Ebner, Andreas Hudelist
Beitrag als PDFEinzelansicht
medienreport
Dana Neuleitner: Alle auf einen. Wenn der Hass das Netz bestimmt
Der Bildschirm bleibt schwarz, lediglich schemenhaft eingeblendete Icons verschiedener Plattformen sind zu sehen, während Schülerinnen und Schüler die scheinbar nicht enden wollenden Botschaften vorlesen: „Ab ins Paddelboot mit denen, die sich nicht an unsere Regeln halten!“, „Heul‘ nicht rum, geh sterben!“ Wenn sich Heranwachsende im Internet bewegen, sehen sie sich bisweilen mit ähnlichen Beleidigungen oder Kommentaren konfrontiert. In Sozialen Netzwerken ist Diskriminierung keine Seltenheit mehr. Bereits in der ersten Minute der Filmreihe Alle auf einen wird das Bewusstsein der Rezipierenden für die Konfrontation mit Diffamierungen und Hetzkommentaren geschärft. Die Filmreihe des Medienprojekt Wuppertal beschäftigt sich mit dem Umgang junger Internetnutzender mit Hass, Hetze und Beleidigungen im Netz. Werden Ergebnisse einer Untersuchung von Campact e. V. hinzugezogen, ist davon auszugehen, dass im Jahr 2019 die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen besonders häufig mit Hate Speech in Kontakt gekommen ist, was die Relevanz des Themas unterstreicht. Es drängt sich die Frage auf, ob es sich noch um Soziale Netzwerke oder eher um ‚Asoziale Hetzwerke‘ handelt, wie der Titel des ersten Beitrags von Alle auf einen propagiert?! In 15 Beiträgen widmen sich junge Filmschaffende in 185 Minuten den Beweggründen hinter dem Online-Handeln: Zwei dokumentarische Kurzfilme geben Auskunft über Hate Speech im politischen Kontext sowie über Cybermobbing. Schülerinnen und Schüler, Studierende, eine Aktivistin sowie Expertinnen und Experten sprechen über ihre Erfahrungen mit Hassreden. Sie geben aus verschiedenen Perspektiven Lösungsmöglichkeiten für Betroffene und indirekt betroffene Bystander. Durch das Einbringen ihrer Erfahrungen wird deutlich, welchen Konfrontationen aktive Onlinerinnen und Onliner in Sozialen Netzwerken ausgesetzt sind. So wird unter anderem die Befürchtung laut, durch Gegenrede könne man selbst zur Zielscheibe werden. Den persönlichen Einschätzungen der Befragten – wie etwa, dass Twitter oder YouTube die am meisten mit Hate Speech belasteten Sozialen Netzwerke seien – könnten jedoch weitere Überprüfungen in Form eines Faktenchecks folgen. Zum Einstieg definiert Anna-Lena von Hodenberg, Leiterin von HateAid, Hate Speech. Dabei erweitert sie gängige Definitionen von Hassrede um persönliche Beleidigungen. Hier spiegelt sich die Problematik in der Verwendung des Begriffs: Es existiert bisher keine rechtlich verankerte Definition, weswegen sich eine Rechtsprechung schwierig gestaltet. Spannende Einblicke bietet Medienpädagoge Heiko Wolf, der verbreitete Strategien von Hatern und Trollen anhand des Internet-Handbuchs Shitposting 1×1 erklärt. In diesem werden Haterinnen und Hater explizit animiert, sich am Trollen oder Ähnlichem zu beteiligen. Hieraus ergeben sich mögliche Ansatzpunkte für die (medien-) pädagogische Praxis, für die Sensibilisierung von Schülerinnen und Schülern oder auch die Analyse von Fallbeispielen. Mit aktuellen Bezügen und prominenten Beispielen, wie den Hassattacken gegenüber Klimaaktivistin Greta Thunberg oder den Twitter-Anfeindungen Donald Trumps, bietet die Filmreihe hohen Aktualitäts bezug, der gleichzeitig einen leichten Zugang zu Hass und Hetze in den Sozialen Medien bereitstellt. Im Anschluss werden in einem Straßeninterview junge Einwohnerinnen und Einwohner Wuppertals zu ihren Erfahrungen mit Hate Speech befragt. Dabei kristallisiert sich zum einen heraus, dass viele der Befragten der Hassrede im Netz durchaus kritisch gegenüberstehen. Andererseits geben einige Passantinnen und Passanten zu, sich selbst auch im Internet beleidigend zu äußern: „Wenn ich mal gehatet hab, dann auf Tellonym. Ist normal“, kommentiert beispielsweise eine Schülerin; wie schwerwiegend ihre Kommentare waren, bleibt im Verborgenen. Diese empfundene Normalität lässt aufhorchen. Nicht nur wird die bloße Anwesenheit von Hate Speech durch die ausbleibende Einordnung gewissermaßen toleriert, sondern diese selbst auch unreflektiert weiterverbreitet. Etwas irritierend erscheint, dass die Interviewfragen teilweise nicht eingeblendet und damit nicht nachvollziehbar werden. Etwas kritischer setzt sich das Format einer fiktiven Night Show mit Hass auseinander. Hier treffen ein YouTuber und dessen Hater aufeinander. Da sich die beiden weder im Internet noch in der realen Welt unter Kontrolle haben, kommt es zur Eskalation. Nur die Erfindung Hate Buster 3000 kann noch Abhilfe schaffen. Die Lösung: Die Beteiligten werden in den Stummmodus überführt. Im ‚echten‘ Leben müssen die Beteiligten aber wohl vorerst mit den Funktionen Blockieren und Löschen auskommen. Alle auf einen gelingt es, in vier Kurzfilmen verschiedene Aspekte von Beleidigungen, Verleumdungen und Hate-Speech-Kommentaren im schulischen Kontext nachzuspielen. Die Konflikte werden dabei nicht nur in der Offline- sondern auch in der Online-Welt ausgetragen. Unangebrachte Inhalte in Klassenchats – wie Volksverhetzung oder Beleidigungen – erfahren derzeit große mediale Aufmerksamkeit. Diesbezüglich wäre ein zusätzlicher Hinweis auf rechtliche Folgen für die dargestellten Szenarien denkbar gewesen. Den Abschluss bilden ein Musikvideo sowie vier Interviews mit Expertinnen und Experten. Hier werden unter anderem das Beratungsangebot HateAid (mehr hierzu S. 52 f. in dieser Ausgabe) und das kostenfreie Onlinetraining LOVEStorm vorgestellt. Die Filmreihe ist offiziell mit der Altersfreigabe FSK 0 gekennzeichnet. Bei der Auseinandersetzung mit jüngeren Kindern ist dennoch zu bedenken, dass potenziell verstörende manipulierte Bilder – wie eine erhängte Greta Thunberg – zu sehen sind und unter anderem in den Kurzfilmen zahlreiche Beschimpfungen fallen. Alle auf einen schafft einen überzeugenden Überblick zu Hate Speech und setzt sich auf Augenhöhe mit Heranwachsenden und angrenzenden Themen wie Cybermobbing oder Filterblasen auseinander. Manchmal kommt es jedoch zu Vermischungen, weil die Begriffe nicht immer klar voneinander abgegrenzt werden. So wird der Begriff ‚Hate‘ in den Kurzfilmen beispielsweise etwas inflationär verwendet, was die Frage aufwirft, wo Hass eigentlich beginnt und endet. Hier liefert Nils Viefs (Universität Marburg) eine hilfreiche Unterscheidung zwischen ‚Hass‘ als affektive Emotion und deren strategischem Transport durch Hassrede. Diese kann bei Diskussionen eine gute Grundlage bieten und könnte auch Heranwachsenden nähergebracht werden. Spannend ist in diesem Zusammenhang auch das Experiment seiner Studierenden, in dem untersucht wird, ob und wie schnell Test-Accounts durch Äußerung politischer Einstellungen via Facebook durch die Funktionsweise des Algorithmus mit Hass-Kommentaren in Berührung kommen. Die einzelnen Filmbeiträge stehen für sich und bauen nicht aufeinander auf. Eine getrennte Behandlung etwa in der Sekundarstufe I in Sozial- oder Gemeinschaftskunde ist daher nicht nur denkbar, sondern drängt sich geradezu auf.
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Dana Neuleitner
Beitrag als PDFEinzelansichtDana Neuleitner: Kann ich meinen Augen noch trauen? Im Zeitalter digitaler Bildbearbeitung
Kaum ein Foto wird heute noch online gestellt, ohne vorher in Kontakt mit Bildbearbeitungsprogrammen wie Photoshop oder Instagram zu kommen. Einen anderen Hintergrund einfügen, ein störendes Detail herausretuschieren – die Möglichkeiten sind beinahe unbegrenzt. Dass das Manipulieren von Fotos jedoch schon länger existiert als Instagram und Co., zeigt die Lehr-DVD Manipulation von Bildern anhand historischer Beispiele. Was damals nur Fachleuten möglich war, ist heute beinahe schon ein Kinderspiel. Da viele der so entstandenen Bilder täuschend echt aussehen, ist es wichtig, bereits Schülerinnen und Schüler in dieser Hinsicht zu sensibilisieren. „Wir glauben gerne, was wir sehen“ – mit diesem Satz beginnt das Lehrvideo von didactmedia. Im Folgenden wird jedoch bald klar, dass man seinen Augen nicht immer trauen sollte: Anschaulich wird in etwa 16 Minuten erläutert, wie Bilder inszeniert, manipuliert oder in einen falschen Zusammenhang gestellt werden, um Rezipientinnen und Rezipienten zu täuschen. Dieser Vorgang wird mit Hilfe von historischen und aktuelleren Bildern gut verständlich erklärt. Den Einstieg bildet im Kapitel ‚Manipulieren und falsch darstellen‘ ein Videoausschnitt, der eine Gruppe von Kindern zeigt, eine Person ist dabei etwas abseits. Der O-Ton wird in zwei Varianten gegeben: Die erste Version ist eine Berichterstattung über eine Schülergruppe, die beim Talentwettbewerb Jugend forscht gewonnen hat, die zweite Cybermobbing. Die gezeigte Szene eignet sich aufgrund der Nähe zum Schulalltag gut für eine Einführung in die Materie. Die Vertiefung geschieht durch die geschichtlichen Beispiele eines Propagandafotos der Nationalsozialisten zur Verharmlosung des Überfalls auf Polen 1939 und eine manipulierte Aufnahme aus der Sowjetunion, bei der zwei in Ungnade Gefallene wegretuschiert wurden. Den Schülerinnen und Schülern wird dabei jeweils kurz erklärt, worin die Beweggründe hinter den Manipulationen lagen. Im Anschluss werden Täuschungsversuche aus der Vergangenheit eingeblendet; sowohl anhand des nationalsozialistischen Propagandafilms Theresienstadt, anhand retuschierter Bilder aus der DDR als auch am Beispiel einer Broschüre der Thüringer Landesregierung zum Besuch des damaligen Präsidenten der USA, Bill Clinton. Die bearbeiteten Fotos werden jeweils ihren Originalen gegenübergestellt und in ihren Bedeutungszusammenhang gesetzt. Die Lehr-DVD gewährleistet so auf spannende Weise, dass die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in die weitreichenden Zusammenhänge erhalten. Wie groß die Wirkungsmacht der Bilder ist, wird insbesondere im Kapitel ‚Bilder führen Krieg‘ eindrucksvoll dargestellt. Hier wird beispielsweise auf den Auslöser des Golfkriegs, das Mädchen ‚Nayirah‘, eingegangen. Die 15-Jährige hatte 1990 vor laufenden Kameras ausgesagt, dass irakische Soldaten kuwaitische Säuglinge aus ihren Brutkästen geholt und hingerichtet hätten. Die Macht der Bilder führte zur Entscheidung, gegen den Irak in den Krieg zu ziehen. Erst später wurde bekannt, dass es sich lediglich um eine PR-Kampagne handelte, um die amerikanische Bevölkerung von einem Krieg gegen den Irak zu überzeugen. Hier wird verdeutlicht, welchen Einfluss die Darstellung des Materials auf die Glaubwürdigkeit besitzt und dass auch Erwachsene der Macht der Bilder unterliegen. Den Produzierenden gelingt es gut, die Rezipierenden dafür zu sensibilisieren, die Interessen der Absenderinnen bzw. Absender von Bildern zu hinterfragen. Denn wer abschätzen kann, aus welchen Beweggründen ein Foto oder Video veröffentlicht wird, dem wird es auch leichter fallen, das Material einzuordnen. Im folgenden Kapitel lernen Schülerinnen und Schüler, welche (politischen) Interessen und Quellen zu beachten sind. Der Film beschreibt, welche Medien über Demonstrationen in Russland oder einen Hungerstreik syrischer Flüchtlinge vor dem griechischen Parlament (nicht) berichteten und nennt Beispiele, anhand derer sichere Internetquellen identifiziert werden können. Dies bietet einen guten Ansatz für Lehrkräfte, um weitere Erkennungsmerkmale sicherer und unsicherer Quellen herauszuarbeiten. Es wird auch erwähnt, dass etwa die Sperrung von Internetseiten in China zum Alltag gehört. Die dahinter liegenden Beweggründe werden jedoch nicht im Detail beschrieben, sodass vor allem Rezipierende mit ausreichend Hintergrundwissen zum eigenständigen Nachdenken angeregt werden. Mit denjenigen, die diese Verbindungen (noch) nicht verstehen, sollte an gegebener Stelle eine begleitete Einordnung erfolgen. In der letzten Einheit werden Bilder erneut kritisch hinterfragt und die angesprochenen Möglichkeiten der Manipulation wiederholt. Zur Festigung des Gelernten wird außerdem der Arbeitsauftrag gegeben, mit Bildern eine eigene Kampagne zu einem selbstgewählten Thema zu entwickeln. An den Lehrfilm schließen sich Materialien für den Unterricht an. Hierzu gehört ein sehr umfangreiches Glossar. Allerdings entstammt der Großteil der Definitionen Wikipedia-Artikeln, was dem eigentlichen Anliegen der Sensibilisierung für seriöse Quellen widerspricht. Des Weiteren finden sich – neben einer nicht besonders umfangreichen Bildergalerie – fünf Arbeitsblätter, die nach dem Film bzw. den einzelnen Sequenzen bearbeitet werden können. Hierbei ist darauf zu achten, dass manche Aufgaben für jüngere Kinder zu anspruchsvoll sein könnten. Hierzu gehört etwa, ein Foto von sich in historische Szenen zu integrieren. Auch interaktive Aufgaben sind im Umfang enthalten. So sind die Schülerinnen und Schüler hier angehalten, zu kurzen Filmsequenzen einen Lückentext auszufüllen und dabei zwischen manipulierten und authentischen Bildern zu unterscheiden. Diese Aufgaben bieten sich zwar zur Selbstreflexion an, die Ergebnisse können allerdings nicht an die Lehrkraft weitergegeben werden, wodurch diese keinen Einblick in die Lernfortschritte erhält. Durch das Sichtbarmachen verschiedener Manipulationen schärft das Lehrvideo den kritischen Blick der Rezipientinnen und Rezipienten und fördert so die Medienkompetenz der Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte. Wünschenswert wäre, dass auch Beispiele der letzten Jahre aufgegriffen worden wären. Gleichzeitig ergibt sich hier eine Anschlussstelle für weitere Unterrichtsstunden etwa in der Sekundarstufe I, wofür sich insbesondere die hilfreiche Liste mit weiterführenden Links eignen würde. Durch die zahlreichen historischen Beispiele ist etwa der Einsatz im Geschichtsunterricht denkbar. Aufgrund der Wichtigkeit der Materie könnte die Lehr-DVD aber grundsätzlich auch beispielsweise im Sozialkundeunterricht und anderen Fächern verwendet werden.
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Dana Neuleitner
Beitrag als PDFEinzelansichtMonika Himmelsbach: How we roll online. Digitale Tools im Rollenspiel
Die Zeit ist vorbei, in der Rollenspielerinnen und -spieler abgeschottet im Keller sitzen und angeblichem Teufelswerk nachgehen. Zumindest in bestimmten Kreisen haben Spiele wie Dungeons & Dragons, Das Schwarze Auge und Midgard das Internet erobert. Spielsessions werden auf YouTube und Twitch1gestreamt, Foren beschäftigen sich mit den Entwicklungen der Szene und Websites helfen Spielleitenden, ihre Welt zu erschaffen. Schon lange bilden Stift und Papier nicht mehr die einzige Grundlage für ein Rollenspiel. Seinen Anfang hatte das Rollenspiel im Jahre 1974 mit der ersten Edition von Dungeons & Dragons in den USA. Mittlerweile gibt es unzählige andere Systeme wie Vampire: Die Maskerade, Der Herr der Ringe oder Shadowrun. Gemeint sind hier übrigens sogenannte Pen-&-Paper-Rollenspiele, nicht etwa das sozialtherapeutische Rollenspiel in der psychosozialen Arbeit. Pen-&-Paper-Rollenspiele sind eine Mischung aus Improvisationstheater, Erzählung und Gesellschaftsspiel. Teilnehmende nehmen eine von zwei Rollen ein: Die Spielleitung, die die Welt und die darin lebenden Wesen handhabt, gibt Situationen vor und entscheidet über den Ausgang von Handlungen. Die Spielenden übernehmen währenddessen Charaktere in jener fiktiven Welt und erleben Abenteuer. Alle Fähig- und Fertigkeiten der Heldinnen und Helden befinden sich meist auf einem als Charakterbogen bezeichneten Dokument. Mithilfe der Werte auf dem Blatt Papier und Würfelaugen wird der Ausgang einer Aktion entschieden: Schafft es die Elfe, über die Mauer zu klettern oder rutscht sie ab? Trifft der Schlag des Ritters? Kann der Zwerg den Schützen davon überzeugen, ihm zu helfen? Anhand des Würfelergebnisses bestimmt die Spielleitung, welche Folgen sich für den Charakter ergeben. So schafft die Elfe es zwar zum Beispiel, über die Mauer zu klettern, tritt bei der Landung jedoch ungünstig auf und verletzt sich. Die Visualisierung der Geschehnisse findet hauptsächlich in den Köpfen der Teilnehmenden statt. Zur atmosphärischen Darstellung werden unter anderem Welt- bzw. Umgebungskarten, Figuren und Musik eingesetzt. Aufgrund der Digitalisierung werden Karten nicht mehr nur gekauft oder selbst auf Papier gezeichnet, sondern auch am PC erstellt. Würfel können digital geworfen, Spielfiguren virtuell dargestellt und Effekte animiert werden. Gerade in den letzten Jahren sind diese Tools immer ausgefeilter geworden, nicht zuletzt durch die Möglichkeiten der digitalen Vernetzung über lange Distanzen mit (Un-)Bekannten mit denselben Interessen. Bevor die Möglichkeit zum Videochat aufkam, gab es Rollenspielgruppen, die über Textchat spielten. Diese Art des Spiels wird noch immer genutzt, wobei sich neben Browserversionen auch Apps für mobile Endgeräte etabliert haben. So ist zum Beispiel Role Gate auch auf Smartphones verfügbar. Diese Anwendung ermöglicht neben dem Chatten das Würfeln, den Zugriff auf den Charakterbogen, das Schicken von Bildern oder das Erstellen von stark vereinfachten Karten. Websites wie Fantasy Grounds oder Roll20 hingegen werden meist zusammen mit Voice-Chatdiensten genutzt. Unter den Angeboten, die der Visualisierung helfen sollen, haben sich diese zwei Plattformen – neben Astral Table Top und D20Pro – etabliert. Abbildung 1 zeigt, wie dies aussehen kann: In der Mitte befindet sich die Karte, in diesem Fall die Innenansicht einer Taverne. Auf dieser können Tokens2 platziert werden. In Situationen, in denen die genaue Platzierung von Objekten und Personen wichtig wird, ist dies besonders praktisch. Am rechten Rand befinden sich der Chat, der auch die Würfelwürfe anzeigt, eine Jukebox sowie ein Journal mit Informationen zu unter anderem Personen und Orten. Auch bietet die Website den bereits genannten Voice- und Videochat an. Vieles ist mit einem kostenlosen Account zugänglich, für Funktionen wie animierte Effekte oder den vollständigen Zugang mit mobilen Geräten bedarf es eines Bezahlabonnements. Die seit 2004 verfügbare Plattform Fantasy Grounds ist nur für Windows, macOs sowie Linux verfügbar, konnte sich aber mehr offizielle Rollenspielsystemlizenzen sichern als Roll20. Nutzende mit kostenfreien Zugängen können nur Spielen von bezahlenden Mitgliedern beitreten, was bedeutet, dass zumindest eine Person einer Spielgruppe eine monatliche oder einmalige Gebühr bezahlt haben muss. Die Angebote der bezahlten Versionen sind meist für länger bestehende oder auf längere Zeit ausgelegte Gruppen interessant. Da ist Fantasy Grounds günstiger, da es die Option gibt, mit einer einmaligen Zahlung alle Features zu nutzen. Roll20 hingegen verfügt nur über das Abomodell – bei Kampagnen über mehrere Jahre wird das teuer. Vor allem in den letzten Jahren gab es einen Boom um sogenannte Worldbuilding-Tools wie Dungeonfog, WorldAnvil (Abb. 2) oder ArkenForge. Diese sollen durch die Erschaffung von Enzyklopädien das Verschriftlichen und Verwalten von selbsterstellten Welten erleichtern. Aufzeichnungen über Geschichten, Personen oder Völker können miteinander verknüpft und durch Bilder ergänzt werden. Anfangs können die Möglichkeiten und Schaltflächen überwältigend wirken, nach einer Eingewöhnung sind sie jedoch Gold wert. Gerade der Spielleitung erleichtern sie es, den Überblick zu behalten: Wie heißt der Verkäufer noch einmal? In welcher Stadt hat er seinen Laden? Zudem regen die Schaltflächen an, kreativ tätig zu werden und die selbst erstellte Welt weiterzuentwickeln. Wer ins Rollenspiel hineinschnuppern möchte, ohne (viel) Geld auszugeben, dem spielt die digitale Entwicklung entgegen; analoge Regelbücher oder Figuren sind nämlich wesentlich teurer. Viele Spiele systeme bieten verkürzte Regeln als GratisPDF an, Würfel können online geworfen und Karten sowie Tokens digital erstellt werden. Dies bietet auch Personen Zugang, denen es sonst Schwierigkeiten bereitet, an Rollenspielsitzungen teilzunehmen. Sei es durch physische oder psychische Beeinträchtigungen oder die Distanz. Seit ein paar Jahren werden Pen-&-Paper-Rollenspiele auch immer häufiger in die therapeutische Praxis einbezogen, beispielsweise um Personen mit Depressionen, Angstzuständen oder Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) zu helfen. Auch in anderen (medien-)pädagogischen Kontexten ist der Einsatz gewinnbringend denkbar.
Anmerkungen:
1 Ein Live-Streaming-Videoportal, das vorrangig zur Übertragung von Videospielen genutzt wird.
2 Spielfiguren für Charaktere, Monster und unbelebte Gegenstände.
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Monika Himmelsbach
Beitrag als PDFEinzelansichtAndrea Stephani: Mit dem Hörstift auf Entdeckungsreise
Der digitale Hörstift BOOkii ist ein spielerisches Lernmedium für Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren, das Neugier erweckt, Kreativität fördert und das Erschließen neuer Welten eröffnet. Mit dem Stift werden die passenden Bücher durch digitale Inhalte ergänzt. Durch Antippen des Buches liest der integrierte optische Infrarot-Sensor den aufgedruckten, mit bloßem Auge kaum wahrnehmbaren Code aus und startet das Vorlesen der Texte oder bringt Geräusche hervor und lässt Figuren sprechen. Im Lieferumfang eines Starter-Sets enthalten sind ein Hörstift, ein paar Aufnahmesticker, ein Aufbewahrungsetui mit Ladekabel und ein Buch. Je nach Buchthematik variiert auch die angesprochene Altersgruppe. Mit Einblicken in Demografie und Politik, Natur und Tiere, Geschichte und Kultur verschiedener Länder ist beispielsweise COLUMBUS Globus für Kinder ab acht Jahren umgesetzt, während sich Zähle die Tiere von 1 bis 10 bereits für Kinder ab drei Jahren eignet. Auch der Einsatz im Kindergarten oder in der Schule wird von Tessloff empfohlen. Als Nachfolger des TINGHörstifts bietet BOOkii bereits eine Vielzahl an unterschiedlichsten relevanten und unterrichtsbezogenen Themen. Wer noch alte TINGBücher besitzt, kann auch diese mit BOOkii auslesen. Neben fachbezogenen Schwerpunkten wie Geografie, Mathematik oder Englisch gibt es auch lebensnahe, alltagsrelevante Themen wie den Arbeitsalltag von Feuerwehrfrauen und -männern oder das Leben auf einem Ponyhof. Damit behandelt BOOkii direkt auch Wunschberufe und Interessen von Kindern. Bevor eine Leserunde gestartet werden kann, ermöglicht eine kurze Anleitung eine Einführung in den Spielverlauf. Diese wird bei jeder neuen Frage oder Aufgabe wiederholt, kann jedoch auch vorgespult oder übersprungen werden. Wird der Stift nach dem Antippen entfernt, fängt der Text wieder von vorn an; das passiert leider auch schon beim leichten Verrücken. Mit Hilfe einer kleinen Einführung seitens eines Erwachsenen finden sich Kinder ab acht Jahren sicher schnell mit der Handhabung zurecht, die Dreijährigen benötigen bestimmt noch mehr Unterstützung von Erwachsenen oder Geschwistern. Nach dem gemeinsamen Lesen oder Anhören erster Texte sind jedoch auch sie in der Lage, sich selbstständig auszuprobieren. Auf ausgewählten Seiten stehen Fragen zum Text zur Verfügung, die von den Kindern mit richtig oder falsch beantwortet werden können. Bei aufmerksamen Leserinnen und Lesern kann sich schnell der Wissenserwerb steigern und Erfolgserlebnisse stellen sich bei der Beantwortung der Fragen zügig ein. Neben den Wissensquizzen gibt es auch spielerische Aufgaben, bei deren Bewältigung Kinder nicht nur ihre Feinmotorik, sondern auch die Hand-Augenkoordination und das reflexive Denkvermögen verbessern können. Bei der Abbildung von Menschen am Strand werden die Kinder zum Beispiel gebeten, alle Mädchen oder Sandspielzeuge anzutippen. Doch während im Vorlesemodus das einmalige Antippen genügt, um die gesamte Erzählung anzuhören und somit ein intensiveres Erkunden einzelner Seiten elemente möglich ist, erfordern Spiele eine höhere Aufmerksamkeit und das wiederholte Antippen für weitere Fragen bzw. Aufgaben. Dabei treten innerhalb der Quizze einige Fragestellungen häufiger auf, bevor im Anschluss neue Fragen gestellt werden. Eine Information über die Anzahl der Fragen bei der Spielanleitung wäre jedoch sinnvoll, um das Suchen nach neuen Fragen einzugrenzen und die Frustrationstoleranz niedrig sowie den Spaß am Spiel aufrechtzuerhalten. Mit den mitgelieferten BOOkii-Aufnahmestickern sind die Kinder und auch ihre Eltern und Erziehenden in der Lage, ihre eigenen Geschichten und Lieder aufzunehmen. Die vertrauten Stimmen stehen somit jederzeit zur Verfügung und können auch dann angehört werden, wenn die Bezugspersonen gerade nicht anwesend sind. Tessloff empfiehlt die Sticker besonders zur Nutzung in Schulheften, auf Lernkarten, als Grußbotschaft, als Reisetage-Hörbuch oder, um eine Schnitzeljagd zu veranstalten. Die Aufnahmefunktion der BOOkii-Hörstifte unterscheidet sich deutlich von den tiptoi-Stiften, die ausschließlich mit CREATE-Produkten nutzbar sind und auf die Freiheit zur Selbstgestaltung der Aufnahmethemen verzichten. Mit dem Aufbewahrungsetui und dem kurzen Ladekabel ist der Hörstift auch ohne großen Aufwand für Reisen geeignet. Ausgestattet mit einer MP3-Funktion können die aufgenommenen Geschichten und Lieder beispielsweise mit Kopfhörern auch während der Autofahrt angehört und die Lautstärke dabei beliebig reguliert werden. Zu den weiteren interessanten Aspekten gehört unter anderem die BOOkii-App. In Verbindung mit einem internetfähigen Smartphone oder Tablet können so via Bluetooth weiterführende Videos und Weblinks geöffnet werden. Beim Konzipieren der App wurde Wert auf eine kindersichere Gestaltung gelegt. So haben Kinder nur Zugriffsrechte auf die von Tessloff freigegebenen, für sie geeigneten Videos und Weblinks und können mit der App bedenkenlos alleine spielen. Zudem ist der Hörstift mit einem Akku ausgestattet, der sechs Stunden Laufzeit garantiert. Integriert ist eine automatische Energiesparfunktion, die das Gerät nach fünf Minuten Nichtnutzung wieder ausschaltet. Insgesamt bietet BOOkii – Der Hörstift eine tolle Ergänzung im Kinderzimmer, in der Schule oder im Kindergarten. Der Stift fördert das selbstständige Spielen der Kinder ohne kontinuierliche Hilfestellung der Eltern und unterstützt ihre kreative Entwicklung. Innerhalb der Beschäftigung mit den BOOkii-Ausgaben lässt sich immer wieder Neues entdecken, sodass die mitgelieferten Bücher auch bei mehrmaligen Durchgängen der Seiten nicht langweilig werden. BOOkii kann in der Schule, im Kindergarten oder in der Familie auch wunderbar von mehreren Kindern gleichzeitig genutzt werden und fördert auf diese Weise die gemeinsame soziale Interaktion. Auch für Kinder, die des Lesens noch nicht mächtig sind, eignet sich der Hörstift gut zum Trainieren des Hörverstehens und der Erhöhung der Lesekompetenz, indem zusammen mit der Erzählerstimme mitgelesen werden kann. Damit macht der Hörstift das Lernen zu einer spielerischen Angelegenheit für die Kinder. Trotz der zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten, die der Hörstift anbietet, steht das Buch weiterhin im Mittelpunkt des Spiels und ist auch ohne die digitalen Inhalte nutzbar. Der BOOkii-Hörstift ist für alle Erziehenden, Eltern, Lehrende oder pädagogischen Fachkräfte empfehlenswert, die ihren Kindern, Schülerinnen und Schülern, einen abwechslungsreichen Alltag ermöglichen möchten.
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Andrea Stephani
Beitrag als PDFEinzelansichtJerome Wohlfarth: Komm, spiel mit!
Die Messe für Brett- und Kartenspiele Internationale Spieletage SPIEL in Essen konnte im vergangenen Oktober knapp 209.000 Interessierte begeistern. Mit über 1.200 Ausstellenden und beinahe 1.500 neuen Spielen gab es in jedem Genre etwas Neues zu entdecken. Diese Zahlen sind beeindruckend und zeigen erneut: Die analoge Brettspielbranche wächst parallel zum Erfolg digitaler Videospiele.
Bildungsmöglichkeiten durch Brettspiele
Zum ersten Mal hat im Rahmen der SPIEL der Educators Day stattgefunden. Neben grundsätzlichen Informationen über die Verbindung von Brettspielen und Bildung haben verschiedene Vorträge und Workshops Interessierten die Möglichkeit geboten, sich über Tätigkeiten und Mitgestaltungsmöglichkeiten von BrettspieleAGs zu informieren; oder welche Spiele als pädagogisch wertvoll einzustufen sind. Anhand einer Diskussionsrunde zu Gesellschaftsspielen im Iran erhielten Besucherinnen und Besucher auch Einblicke in die Wahrnehmung von Spielen in anderen Ländern. Das Spielesortiment des Verlags Genius Games, der sich dem Thema Bildung besonders angenommen hat, basiert auf Thematiken, Mechanismen oder Strukturen, mit deren Hilfe komplexe Inhalte vermittelt werden. So versetzt Cytosis Spielende in das Innere einer Zelle, worin sie den Stoffwechsel unter Kontrolle halten müssen. Ein weiteres Beispiel unter den MINT-Games ist Periodic, das zeigt, aus welchen Elementen bestimmte Stoffe bestehen. Auch historische Themen kommen nicht zu kurz: Lovelace & Babbage behandelt zum Beispiel Computerarbeit zur Zeit des Zweiten Weltkrieges und zeigt auf, wie erste Rechenmaschinen und Frauen für einen Großteil der Berechnungen zuständig waren.
Brettspiele in der Familie
Die Trennung analoger Brettspiele und digitaler Videogames ist in der Entwicklung von Neuheiten noch immer sehr ausgeprägt, doch gibt es immer mehr Ideen, diese Grenzen aufzuweichen. Zu Beginn waren dies häufig Apps, in denen bereits bekannte analoge Spiele wie Die Siedler von Catan, Zug um Zug oder Monopoly digital und auch mobil gespielt werden konnten. Dieses Konzept scheint jedoch eher bei den mittlerweile erwachsenen Gamerinnen und Gamern anzukommen, die ihre früheren Lieblingsspiele auch gerne auf dem Weg zur Arbeit oder entspannt auf dem Sofa spielen möchten. Andere Ansätze erfordern die Nutzung einer App zum Erleben des analogen Spielgeschehens, wie das Game World of YoHo. Spielende übernehmen die Rolle eines Schiffsführenden und steuern Schiff und Seeleute. Alle Aktionen können an einem mobilen Endgerät ausgeführt werden. Solche Spiele richten sich vor allem an eine jüngere Zielgruppe, mit dem Versuch, durch den Einsatz digitaler Medien neues Interesse für Brettspiele zu wecken. XCOM: Das Brettspiel basiert wiederum auf dem gleichnamigen Videospiel, in dem Spielende in verschiedenen Rollen versuchen, die Welt zu retten. Die App fungiert als Spielleitung und übernimmt die Steuerung aller Nicht-Spielerinnen bzw. -Spieler hinsichtlich Charakter, Bewegung oder Aktionen. Spielenden kann so mitgeteilt werden, was geschieht, wenn sie mit der Spielwelt interagieren. Auch können so Zeitspannen vorgegeben werden, innerhalb derer Aufgaben gelöst werden müssen. Die ständigen Veränderungen und das kooperative Zusammenarbeiten der Gruppe unter Zeitdruck sind Faktoren, die erst durch die App-Komponente überschaubar und damit nachvollziehbar in das analoge Brettspielerlebnis implementiert werden können. Apps übernehmen auch in Fantasy-Genres unter den Brettspielen öfter das Narrativ. Neben Herr der Ringe: Reise durch Mittelerde zählen auch Detektiv-Spiele zu den didaktisch interessanten Beispielen, welche den Einsatz digitaler Elemente mit analogen Spielwelten verknüpfen: Chronicles of Crime und Detective versorgen Spielende zum Beispiel beim Lösen fiktiver
Fälle mit Hinweisen in Form von VR-Elementen und kurzen Video sequenzen. Auch müssen die Ermittelnden auf Internet-Datenbanken und echte Plattformen wie Google Maps zugreifen, um Aussagen zu überprüfen. Knallhartes Fachwissen ist dagegen beim analogen Kennerspiel des Jahres 2019 Flügelschlag gefragt, welches erlaubt, in die Rollen von Vogelliebhaberinnen bzw. -liebhabern zu schlüpfen, um spielerisch mit einem größtmöglichen Maß an ornithologischen Kenntnissen zu glänzen.Eindrücke von der Messe
Beim Durchstreifen der Messehallen lässt sich bald erkennen, dass ein besonderer Trend in diesem Jahr auf sogenannten Legacy-Spielen liegt. Kern dieses Spielprinzips ist das Treffen von Entscheidungen, die den weiteren Spielverlauf maßgeblich beeinflussen und dauerhaft verändern. Unter Umständen wird dabei auch Spielmaterial zerstört, sodass zwar ein sehr individuelles, aber auch unumkehrbares Spieleerlebnis entsteht. Aufgrund der Fülle an Informationen, die sich über die einzelnen Kapitel verteilen, wird hier die Achtsamkeit der Teilnehmenden besonders gefordert. Das bekannteste LegacySpiel ist Pandemic Legacy, bei dem Spielende versuchen, den Ausbruch einer weltweiten Epidemie zu verhindern. Auch die Themen Klimawandel und Artenschutz wurden durch einige Verleger in Szene gesetzt, insbesondere durch Spiele, die sich in vielfältiger Weise mit Bienen beschäftigen, wie Ambrosia, Line Up! Bees oder Bee Lives: We Will Only Know Summer. Spielende erkunden hierin die Produktion von Honig oder das Bestäuben von Blüten. Neben Spielspaß bieten sie damit die Möglichkeit, sich Wissen zum Insektensterben, dem Klimawandel und zu den Ursachen sowie Folgen des Bienensterbens anzueignen und dafür sensibilisiert zu werden. Die Verbindung von analogen und digitalen Spielelementen bietet Spielenden ein besonderes Erlebnis. Doch ob digital oder analog – Spiele gestatten in all ihren Formen Spaß für viele Stunden.
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Jerome Wohlfarth
Beitrag als PDFEinzelansicht
publikationen
Antje Müller: Ingold, Selina/Maurer, Björn/Trüby, Daniel (Hrsg.) (2019). CHANCE MAKERSPACE. Making trifft auf Schule. München: kopaed, 352 S., 22,80 €.
Chance Makerspace – Making trifft auf Schule klingt nach einem aussichtsreichen Versprechen oder einer leisen Vorwarnung: „Bedeutet das nun, dass unsere Kinder den ganzen Tag löten und ‚Makey Makey‘ spielen sollen oder ist das wieder eine dieser neumodischen Ideen, um die öde Schule attraktiv zu machen …“ Aber: Es steckt doch so einiges mehr dahinter. Entwicklungen im Bildungssystem, insbesondere die Einführung des Modullehrplans Medien und Informatik in Schweizerischen Volksschulen, geben Anlass, die Gestaltung von Schule und Lehrplänen zu reflektieren und über eine „lustvollere“ Gestaltung nachzudenken. Das Überdenken schulischer Rahmen bedingungen und die Ergründung möglicher Verbindungen von Schule und Making haben im Herbst 2018 Anlass zur Tagung Chance MakerSpace gegeben, welche die Basis für den gleichnamigen Tagungsband stellt. Dabei lag den Veranstaltenden am Herzen, Einstiegs- und Nutzungsszenarien sowie Herausforderungen zur Heranführung von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften an das Maker-Mindset zu skizzieren und geeignete Weiterbildungsformate aus schuladministrativer Perspektive zu diskutieren. Didaktisch, interdisziplinär und anschlussfähig, aber auch praktikabel, sinnvoll und innovativ sollten sie sein. VUCA1-maßstabsgetreu und ganz im Zeichen der 21st Century Skills trägt das Herausgeberteam Selina Ingold, Björn Maurer und Daniel Trüby die geballte Ladung an Wissen zu den erörterten Chancen des Lernraums MakerSpace zusammen. Mit Chance MakerSpace schaffen sie ein kompaktes Erinnerungsband und konzi pieren zugleich ein Manifest, das zum Aktiv werden einlädt. Ihrer Leitfrage folgend gliedern sie den Band in vier Teile: (1) Making: Begriffe und Perspektiven, (2) Impulse aus der außerschulischen Praxis, (3) Making: Erfahrungen aus dem Schulalltag, (4) Konkrete Umsetzungsbeispiele. Neben der anwendungsbezogenen Nutzung wollen sie zur Auseinandersetzung mit Wert- und Persönlichkeitsbildung mündiger Bürgerinnen und Bürger anregen. Doch im Verlauf der ansteckend intensiven Auseinandersetzung mit den in Einklang zu bringenden Rahmenbedingungen der in die Jahre gekommenen Institution zeichnen sich auch widerständige Herausforderungen ab. Strukturelle Zwänge, Druck auf Lehrkräfte, mangelnde materielle wie personelle Ressourcen und immer wieder die Frage nach mitzubringenden, zu vermittelnden oder zu erwerbenden Kompetenzen – all das bildet einen deutlichen Gegenpol zum Entfaltungsbestreben eines experimentellen, kreativitätsfokussierten, kollaborativen und eigeninitiativorganisierten MakerSpace. Der Band beginnt mit einem gelungenen Auftakt zu heranführenden Begriffen und Perspektiven des Making. Was Making will und vor allem kann, wird nachvollziehbar verknüpft mit den veränderten ökonomischen Bedingungen, die nach modernen Fähigkeiten verlangen und nicht zuletzt auch für die allseits beliebten Schulleistungsmess- und Prüfsystemen eines PISA-Tests oder einer OECD-Studie interessant zu sein scheinen. Denn fest steht offenbar: Maschinen übernehmen zwar viel; aber komplexes Denken, situierte selbstverantwortliche Entscheidungen und Beziehungsfähigkeit zählen zurzeit eher noch nicht dazu. Solch „willensgebundene Fähigkeiten“ müssen mit der Komplexität gesellschaftlicher Probleme Schritt halten und sich der kollektiven Intelligenz bedienen, so eines der Resümees. Und da die Reformmüdigkeit in der Schule hinreichend bekannt ist, wird das Kernthema direkt an den Wurzeln angepackt. Es sollte sich eben nicht in der Kritik an Veränderungen verloren werden, sondern Entwicklung aktiv vorangetrieben und Bildungsziele an Ansprüche wie Emanzipation, Autonomie und Handlungsfähigkeit angepasst werden. Doch wie wäre wohl die Schule, wenn sie sich selbst gestalten könnte? Spätestens auf den letzten Seiten ist das entsprechende Handwerkszeug bereitgestellt – mit einer Reihe sich im Kern ähnelnden Ansätzen, angereichert mit einer beeindruckenden Menge an Erfahrungen um und mit Making im Schulalltag und zuletzt auch konkreten Umsetzungsbeispielen. Dabei werden durchaus auch selbstkritisch Rahmenbedingungen, Machbarkeit oder Übertragbarkeit von Maker-Bedingungen auf Schule eingeordnet. Aber reicht ein ursprünglich unternehmerisch-geprägtes Design Thinking für die Überarbeitung des vermittelten Wertesystems in (Volks-/Grund-/Primar-)Schule und dem dortigen pädagogisch-erzieherisch begleiteten Heranwachsen mündiger Bürgerinnen bzw. Bürger aus? Kann ein analog-digitales Tüfteln und Selbermachen (DIY) unter Berufung auf kollaborative Intelligenz zur Lösung immer komplexer werdender Lebenswelten die Antwort auf eine Veränderung der gesamten Grundbildung geben? Bringen Peer-to-Peer-Ansätze, tutorielle Unterstützung oder die fortschrittliche Einbindung von Coachs und (Groß-)Eltern in einer von Noten befreiten Werkstattatmosphäre nicht auch neue Zwänge und Herausforderungen mit sich? Ohne Gleichen sind Fähigkeiten wie analytisches Denken, Interaktionsaffinität und der Wissenstransfer auf neue Zusammenhänge mehr denn je gefragt. Nicht abstreiten lässt sich das schulreformierende Potenzial eines MakerSpace, das die in Vergessenheit geratenen Qualitäten handwerklicher Fähigkeiten in ein neues Licht rückt und fächerübergreifende, überfachliche Kompetenzen schulen will. Doch besitzt der ganzheitliche Ansatz von Menschenzentriertheit, Coevolution, Fehlertoleranz, Kollaboration, Transparenz, Build-to-think und Handlungsorientierung die Kraft für ein ganzes Curriculum, das auf ein lebenslanges Lernen in einer unsicheren Zukunft vorbereitet? Der Band begeistert insgesamt durch sein Plädoyer für mehr Selbstbewusstsein und Stärkung der aktiven und kollektivorientierten Rolle junger Tüftlerinnen und Tüftler, genauso wie durch die Darlegung der Anschlussfähigkeit des Making für die Bearbeitung aktueller Diskurslagen wie Nachhaltigkeit und ökologisches Denken für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Durch die vielen Parallelen zur aktiven Medienarbeit bietet die Publikation zahlreiche spannende Ansätze, Fächerdenken, Lehr- oder Lernräume und Prinzipien zu überdenken, und sich einem schulischen Maker-Experiment zu öffnen. Adressiert werden schulbehördliche oder pädagogische Fachkräfte, genauso wie alle Fachleute, Maker-Engagierte und -Interessierte. Chance MakerSpace überzeugt schließlich auch durch eine Fürsprache für eine neue Haltung an Schulen, die „Scheitern als Lernchance“ kultiviert und innovatives Material für offenkundige Leerstellen in Schule bereithält. Ein nicht reibungsloses Unterfangen, das kritische Stimmen sicher auch weiter in Bezug auf eine mangelnde Reflexion von Inhalt und digitalem Wandel oder sozial-ethische Fragen laut werden lässt. Eine sich lohnende Reise, die auch abseits von Kreativitätsförderung und Nützlichkeitsgedanken anregt, Grund-, Fort- und Weiterbildung zu überdenken und mit Making zu breit einsetzbaren Ansätzen weiterzuentwickeln.
Anmerkung
1 VUCA ist ein Akronym für volatility, uncertainty, complexity und ambiguity.
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Antje Müller
Beitrag als PDFEinzelansichtClaus Tully: Seifert, Robert (2018). Popmusik in Zeiten der Digitalisierung. Veränderte Aneignung – veränderte Wertigkeit. Bielefeld: transcript. 368 S., 39,99 €.
Musik spiegelt gesellschaftlichen Alltag wider, Stilwechsel kündigen gesellschaftliche Veränderungen an. Dies gilt auch für Popmusik. Sie steht für gesellschaftliche Umbrüche ab den 1950erJahren. In acht Abschnitten behandelt das Buch Popmusik in Zeiten der Digitalisierung Popmusik und ihre Einbettung in die Kontexte Sozialisation, Kultur, Technologie sowie Ökonomie. Im Zentrum der Betrachtungen stehen Veränderungen der Bedeutung wie auch der Nutzung von Popmusik, zuletzt durch Digitalisierung. Denn die digitale Transformation führt unter anderem zu neuen Formen der Aneignung. Robert Seifert arbeitet mit fünf Fallbeispielen und zeigt auf diese Weise, wie Popmusik zu Beginn des 21. Jahrhunderts auf unterschied lichen Ebenen funktioniert. Demnach gestalten verschiedene Einzelphänomene – seien es technologische Innovationen, neue Geschäftsmodelle oder besondere Formen der Aneignung – nicht nur den Umgang mit und die Wertigkeit von Popmusik, sondern ebenso deren Bedeutung. Der Alltagsgegenstand Popmusik folgt nach Seifert gesellschaftlich und soziologisch beschreibbaren Metaentwicklungen. Angeführt werden in diesem Zusammenhang Globalisierung (vgl. Giddens 1999), Metamorphose (vgl. Beck 2016), Multioptionalität (vgl. Gross 1994), Beschleunigung (vgl. Rosa 2005), Fluidität (vgl. Bauman 2012), Reflexivität und Individualisierung (vgl. Beck 1993) sowie Mobilität (vgl.Tully/Baier 2006). Jedoch weist Popmusik im Kontrast zu anderen Medienformen gewisse Besonderheiten auf. Diese lassen den Umgang mit ihr stellenweise geradezu anachronistisch erscheinen, da „Orte, Räume, Zeiten und Objekte [im System Popmusik] medial mit Bedeutungen aufgeladen, aber gleichzeitig konkret individuell angeeignet“ (S. 166) werden. Die Popmusikerfahrung wird in diesem Aneignungsprozess verdinglicht, körperlich wahrnehmbar und damit real. In ihrer Zusammensetzung aus Musik, Objekten und Orten wird sie fluide, und ihre Konsumentinnen bzw. Konsumenten sind hierdurch – je nach Vorwissen, Erfahrungen, Erlebnisintensität und Geschmack – in der Lage, daraus einen individualisierten Nutzen zu ziehen. Auf diese Weise generieren technische Möglichkeiten neue Modi der Aneignung und erzeugen für Seifert einen neuen Umgang mit Popmusik sowie neue Strategien für Bewertungen (vgl. S. 317). Verbreitung und Aneignung von Popmusik werden systematisiert dargestellt. In der Übersicht (vgl. S. 15) werden unter anderem Bedeutungen von Medienträgern, Wiedergabegeräten sowie Verbreitungsmedien auf Phasen der Popmusikentwicklung bezogen (vgl. S. 196 ff.). Verdeutlicht wird, dass Popmusik im Laufe der Entwicklung, und umso mehr unter dem Eindruck der digitalen Transformation, einfacher handhabbar und ubiquitär geworden ist. Ihre Besonderheit konstituiert sich heute in einer orts- und zeit unabhängigen Nutzung und unbegrenzten Verfügbarkeit. Seifert betont hier die Portabilität und Flexibilität von Popmusik, die – wie die Kommunikation – Teil „einer Mobilitätsgesellschaft [und] deren Ausdruck ist“ (S. 317). Als relevante Dimensionen der Popmusik erörtert der Autor unter anderem Popularität, Politik, Unterhaltung und Vergnügen. Er arbeitet einerseits soziale Konstruiertheit und andererseits mediale Verfasstheit des Mediums sowie die Entstehung der Vielfalt von Genres heraus. Seiferts Popmusikbegriff ist dabei „offen, aber nicht allumfassend“ (S. 142). Er ist offen, weil er eben nicht nur die populären, leicht zugänglichen Inhalte umfasst, sondern auch die Verhandlung (politisch) relevanter Vorgänge in der Gesellschaft miteinbezieht. Abseits des Mainstreams zielt Seiferts Verständnis von Popmusik gleichermaßen auf die Musik der Sub- und Netzkulturen, die eben auch Hinter- und Untergründiges thematisieren. Dennoch ist sein Popmusikbegriff bestimmt – und zwar indem notwendigerweise Popmusik als „eine westliche, also anglo-amerikanisch geprägte“ (ebd.) verhandelt wird. Die Publikation verbindet medienbezogene, kulturbezogene und musiktheoretische Zugänge und spürt Aneignungsweisen sowie -kontexten nach. Die Geschichte von Popmusik wird als Ausdruck von Technikentwicklungen wie auch als Repräsentation ökonomischer und sozialer Entwicklungen gesehen. Hervorgegangen ist der Band aus einer wissenschaftlichen Arbeit und ist, angesichts seines Entstehungs zusammenhangs, erfreulich lesbar. Damit liegt ein informativer Beitrag zur Kontextualisierung von Musik vor dem Hintergrund von Technikentwicklungen vor, der nachzeichnet, wie neue Medientechnologien eben auch neue Präsentations- und Produktionsformen generieren. Adressatinnen und Adressaten sind sicherlich nicht allein kultur- und musikwissenschaftlich interessierte Studierende und Lehrende, sondern umfassen ebenso einen breiten Kreis von Studierenden, der an der sozialisierenden Wirkung von Musik sowie am Zusammenhang von Musik- und Gesellschaftsentwicklung interessiert ist. Auch Musikbegeisterte finden Anregungen und Einblicke und können durch die Lektüre einen neuen Blick auf ihre Musikpräferenzen gewinnen. Die Publikation zeigt: Neue gesellschaftliche Strömungen sind immer auch eine notwendige Rahmung von Musikentwicklung und -aneignung. Musik ist nicht nur, sie wird vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Erwartungen und Gegebenheiten (Ökonomie, Technologie, Kultur) gemacht.
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Claus J. Tully
Beitrag als PDFEinzelansichtDana Neuleitner: Weber, Patrick/Mangold, Frank/Hofer, Matthias/Koch, Thomas (Hrsg.) (2019). Meinungsbildung in der Netzöffentlichkeit. Aktuelle Studien zu Nachrichtennutzung, Meinungsaustausch und Meinungsbeeinflussung in Social Media. Baden-Baden: Nomos.
Das Internet ist eine unendlich groß scheinende Informationsquelle, in dem wir überflutet werden mit den neuesten Erkenntnissen, Klatsch und Tratsch, (Falsch-)Meldungen und Meinungen aus aller Welt. Doch welche Informationen werden tatsächlich wahrgenommen? Wie bewusst oder unbewusst entscheiden wir uns für die Rezeption bestimmter Artikel oder Kommentare? Und wie geschieht Meinungsbildung in der Netzöffentlichkeit? Unter anderem mit diesen Fragen setzt sich Meinungsbildung in der Netzöffentlichkeit auseinander, unterteilt in drei Blöcke: Nachrichtennutzung auf Facebook, Meinungsartikulation sowie Meinungsbeeinflussung und -macht in der Netzöffentlichkeit. Der Begriff Meinungsbildung ist allerdings sehr breit gefasst – von der Wahrnehmung über die Bildung bis hin zur Artikulation eigener sowie kollektiver Einstellungen. Anstatt alle Aspekte anzusprechen ist das Ziel der Publikation, herauszuarbeiten, auf welche die kommunikationswissenschaftliche Rezeptions- und Wirkungsforschung momentan ein besonderes Augenmerk legt. Um einen Eindruck zu vermitteln, inwiefern sich die öffentliche Kommunikation seit den 1990er-Jahren verändert hat, differenzieren Weber und Mangold fünf Analysedimensionen und erweitern somit die von Neuberger aufgestellten Dimensionen; verwirrend ist in diesem Einleitungskapitel, dass zwar von fünf Dimensionen gesprochen wird, jedoch nur vier kenntlich gemacht werden. Dennoch schafft dieses Grundlagen - und Übersichtskapitel eine gute Basis für die folgenden Studien – und liefert viele weiterführende Verweise auf andere Autorinnen und Autoren, die sich beispielsweise mit Disintermediation oder Journalism Bypassing beschäftigen. Im ersten Block der Publikation steht Facebook im Fokus der Studien. Beginnend mit einer Untersuchung der Zufälligkeit der Nachrichtennutzung wird in zwei qualitativen Studien herausgearbeitet, welche Nutzenden wie auf welche Nachrichten treffen, und welche sie wahrnehmen. Damit schließt der Band eine Lücke, da Studien bisher nur das Potenzial von Social Media bei der beiläufigen Nachrichtennutzung fokussiert hatten. Ein interessanter Aspekt dabei ist, dass Facebook offenbar häufig einen exklusiven oder primären Zugang für regionale Nachrichten bietet und oftmals bei Eilmeldungen eine erste Quelle darstellt. Auch die große Bedeutung von Bildern bei der Aufmerksamkeitsgenerierung wird herausgestellt. Doch trotz des Ergebnisses, dass Nutzende durch Nachrichten auf Facebook nicht besonders gut informiert werden, widmet sich der Großteil des Bandes insbesondere diesem Sozialen Netzwerk. Wenn darüber hinaus davon ausgegangen wird, dass Facebook Wissensklüfte durch zufällige Nachrichtenkontakte nicht schließen kann, wäre interessant gewesen zu erfahren, ob andere Soziale Netzwerkdienste hier Abhilfe schaffen könnten. Die Beiträge rund um die Nachrichtennutzung auf Facebook ergänzen sich – trotz einiger inhaltlicher Redundanzen – aber insgesamt gut und liefern wichtige Informationen, die dabei helfen können, das entsprechende Nutzungsverhalten auf der Plattform zu verstehen und den Wert der vermeintlichen Nachrichtenrezeption einzuschätzen. Der zweite Block beschäftigt sich mit der Artikulationsbereitschaft im Zuge der Migrationsdebatte sowie dem Einfluss der Beziehungsnähe zum Publikum auf politische Meinungsäußerungen. Im Rahmen der zusammengetragenen Studienergebnisse wird herausgestellt, dass die Wirkweise der Schweigespirale auch in Verbindung mit Social Media durchaus von Bedeutung ist. Das zeigt sich am Beispiel der Migrationsthematik, die monatelang durch Diskussionen begleitet wurde. Echokammern dagegen würden im öffentlichen Diskurs sehr überschätzt. Demnach hielten sich politisch Moderate sowieso nicht in ihnen auf. Die beiden Beiträge widmen sich somit vorwiegend kommunikationswissenschaftlichen Theorien und den Reaktionen in Bezug auf politische Themen, während andere gesellschaftliche Bereiche, wie Netzkultur, nicht genauer beleuchtet werden. Die Studienergebnisse lassen dazu die Befürchtung aufkommen, dass sich insbesondere politisch Extreme in Sozialen Medien bewegen, miteinander vernetzen und mit ihren Beiträgen das Meinungsklima verzerren. Ein weiteres interessantes Ergebnis umfasst die Auswirkung des Publikums auf die Kommunikation, etwa auf preisgegebene Informationen oder dem sprachlichen Stil, die Nähe zu ihm, aber nicht auf das Äußern politischer Meinungen auf Facebook. Schließlich werden Influencer-Marketing sowie die Methode der Meinungsbeeinflussung und damit verbundene Chancen und Risiken, Quellenglaubwürdigkeit und wahrgenommene Machtverhältnisse aufgegriffen. Hier finden Lesende auch informative theoretische Grundlagen, wie etwa zu parasozialen Interaktionen und Produktplatzierungen, die helfen, die Beliebtheit und den Erfolg der Influencerinnen und Influencer zu verstehen. Die Ergebnisse zeigen unter anderem, dass Glaubwürdigkeit und negative bzw. positive Schlagzeilen auch das Image durch sie beworbener Produkte oder Marken signifikant verschlechtern bzw. verbessern können. Die aufgegriffenen Studien leisten dadurch einen Beitrag, die noch wenig vorhandene Literatur hierzu zu bereichern. Abgeschlossen wird der Band durch einen Beitrag zu Machtverhältnissen in der öffentlichen Meinungsbildung und der Frage, ob etwa die Macht menschlicher Akteurinnen und Akteure in Anbetracht von Social Bots geringer wird. Die in diesem Band versammelten Studien fußen auf der Jahrestagung der Fachgruppe Rezeptions und Wirkungsforschung der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft (DGPuK) aus dem Vorjahr und bieten einen guten Überblick über Nachrichtennutzung, Meinungsartikulation und Meinungsbeeinflussung. Dank vieler Grafiken und Tabellen sind die Ergebnisse gut nachvollziehbar. Wünschenswert wäre es gewesen, abseits von Facebook und Instagram weiteren Social-Media-Angeboten ähnlich viel Beachtung zu schenken. Insgesamt bietet Meinungsbildung in der Netzöffentlichkeit Anreize für die Kommunikationswissenschaft, für den Journalismus und die öffentliche Kommunikation. Aber auch Medienpädagoginnen und -pädagogen erhalten wertvolle Informationen – beispielsweise zur Beeinflussung durch Influencerinnen und Influen cer.
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Dana Neuleitner
Beitrag als PDFEinzelansichtDana Neuleitner: Ahrens, Jörn (2019). Überzeichnete Spektakel. Inszenierungen von Gewalt im Comic. Baden-Baden: Nomos. 338 S., 64 €.
Krach, Zisch, Päng! In den bunten Bilderwelten von Comics geht es oft ziemlich rasant zu. Seit langer Zeit werden sie mit Gewalt assoziiert. Der Kultursoziologe Jörn Ahrens setzt sich in seinem Band Überzeichnete Spektakel mit den Inszenierungen von Gewalt in Comics auseinander und stellt fest: Eine überzogene Darstellung ist das zentrale Wesensmerkmal eines Comics und zeichnet das Genre aus. Auf diese Weise kann der Comic mit den Grenzen zwischen Fiktionalität und Realität spielen. In der Studie untersucht der Autor etwa Frank Millers Sin City, Winshluss‘ Pinocchio und die Arbeiten von Baru und Hermann Huppen. Als Grundlage seiner Untersuchung widmet er sich zunächst den Begriffen ‚Bild‘ und ‚Medium‘ sowie den zentralen Elementen ‚Spektakel‘, ‚Gewalt‘ und ‚Ästhetik‘. Dabei befasst er sich mit den bereits Mitte des 20. Jahrhunderts kritischen gesellschaftlichen Positionen gegenüber dem Genre Comic. Den Lesenden wird über relevante Zäsuren bezüglich einer Verknüpfung von Gewalt und Comic mit Hilfe von spannenden geschichtlichen Ausführungen und weiteren Forschungsansätzen ein Überblick geboten. Die Kapitel sind sehr ausführlich und behandeln auch Titel abseits des Mainstreams. An passenden Stellen werden relevante Auszüge aus den besprochenen Comics eingebracht, welche die Aussagen des Autors belegen, allerdings der notwendigen Präsenz eines Comics nicht gerecht werden. Zur besseren Nachvollziehbarkeit wären zudem kurze Zusammenfassungen der ausgewählten Comics hilfreich, wenngleich der Autor auch nach und nach notwendige Informationen über das Geschehen in den entsprechenden Erläuterungen einfließen lässt. Ahrens widmet sich einem bisher vergleichsweise wenig beachteten Forschungsgebiet und bietet etwa Medienwissenschaftlerinnen bzw. -wissenschaftlern die Möglichkeit, sich intensiver mit dem Thema Gewalt in Comics, aber auch mit den formalen und medienimmanenten Gegebenheiten samt Realitätsnähe von Comics auseinanderzusetzen. Hier ergeben sich Ansatzpunkte für Medienpädagoginnen und -pädagogen, die Lesenden helfen können, diesen Unterschied zu erkennen. dn
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Dana Neuleitner
Beitrag als PDFEinzelansichtAndrea Stephani: Geisler, Martin (2019). Digitale Spiele in der Medienpädagogik. Einstellungen, Erfahrungen und Haltungen von Spielleitenden. München: kopaed. 257 S. 18,80 €.
Digitale Spiele sind aufgrund ihres immanenten Bildungspotenzials nicht ausschließlich im Freizeitbereich zu verorten. Sie sind auch als ein nutzbares Gut für die Medienbildung zu betrachten. Zu spielen eröffnet den Nutzerinnen und Nutzern die Fähigkeit zur Entwicklung und Entfaltung. Hierfür bedarf es der Bereitschaft der Zielgruppe, bei digitalen Spielen mit Interesse und Aufmerksamkeit teilzunehmen. Auch eine angemessene Betreuung und Führung sowie Projektarbeitsgestaltung seitens der Anleitenden ist notwendig. Aus diesem Grund legt Martin Geisler in seinem Buch Digitale Spiele in der Medienpädagogik den Fokus ausschließlich auf die Projektleitenden. Hierfür stellt er in einem ersten Schritt Ergebnisse einer quantitativen Online-Befragung vor. Dabei wird ein Profil von Spielleitenden in der Medienpädagogik anhand von demografischen Daten, Praxiserfahrungen und Qualifikationen skizziert. Außerdem wurde nach der individuellen Spielerfahrung gefragt, wie auch nach den eingesetzten Spielformen und bevorzugten Spielgenres. Dabei ist hervorzuheben, dass keiner der Befragten angegeben hat, gar keine eigenen Spielerfahrungen zu haben. 56 Prozent geben an, leidenschaftlich oder sogar professionell zu spielen.
Aus den Ergebnissen der qualitativen Erhebung mit zehn Expertinnen und Experten zu ihren Erfahrungen in der Gestaltung von Projekten schlussfolgert der Autor, dass es keine standardisierte Herangehensweise geben kann. Die Projektleitenden müssen sich bei der Planung und Führung an verschiedenen Faktoren wie Zielgruppe oder Gruppengröße orientieren. Jedoch sollen die Ergebnisse der Befragung neue Impulse setzen und zur Reflexion gegenüber digitalen Spielen anregen. Eine praktische Zusammenfassung aller Empfehlungen der Expertinnen und Experten rundet das Werk ab. Damit schafft der Autor einen sehr gehaltvollen Überblick zu den wichtigsten Aspekten, welche bei der Planung und Durchführung medienpädagogischer Angebote mit digitalen Spielen zu berücksichtigen sind. Insbesondere für Fachkräfte, die digitale Spiele in Bildungskontexten bereits einsetzen oder den Einsatz in Zukunft planen, bietet dieses Buch eine umfassende Orientierung. asBeitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Andrea Stephani
Beitrag als PDFEinzelansichtHeinrike Paulus: Grimm, Petra/Keber, Tobias O./ Zöllner , Oliver (Hrsg.) (2019). Digitale Ethik. Leben in vernetzten Welten. Ditzingen: Reclam. 252 S., 8,80 €.
Immer mehr digitale Phänomene bedürfen hinsichtlich ihrer Gefahren und Potenziale eines ethischen Diskurses: Angefangen bei künstlicher Intelligenz und Arbeit 4.0 über Datenschutz bis hin zu Onlinespielen. Den Alltag von Mediennutzerinnen und -nutzern bestimmen zudem vielfach Verletzungen und Übergriffe durch Online-Gewalt wie etwa Cybermobbing, Beleidigungen, Drohungen, Hate Speech oder auch Doxing, dem Veröffentlichen von privaten Daten im Netz. Ein Forschungszweig der angewandten Ethik, der all das reflektiert, ist die digitale Ethik. Sie gleicht einem Kompass, der durch die verschlungenen Wege der digitalen Welt navigiert. Dieses Wissen um ethische Herausforderungen, Regeln und Wertmaßstäbe wird gerade für Menschen aller Generationen immer notwendiger – für Heranwachsende ganz besonders. Die Publikation Digitale Ethik richtet sich an Schülerinnen bzw. Schüler sowie all jene Interessierte, die einen fundierten Einblick in dieses hochaktuelle Themenfeld erhalten möchten. Strukturiert wird ein angemessener Umgang mit den Technologien und ihren Auswirkungen diskutiert. Neben grundlegenden Theorieansätzen erklären die neun Autorinnen und Autoren sowie Mitarbeitende des Instituts für Digitale Ethik (IDE) an der Hochschule der Medien in Stuttgart schülergerecht in 13 Kapiteln zentrale Aspekte dieser Disziplin. Unerlässlich für die Lektüre ist jedoch das Glossar mit den neuesten relevanten Fachbegriffen der gegenwärtigen Forschung, wie etwa Privacy Paradox oder Quantified Self. Der Band eignet sich insbesondere für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. Einige Kapitel, wie etwa jenes Fake News, lassen sich bereits in der Mittelstufe einsetzen. Reflexionsfragen am Ende jedes Kapitels helfen, das erlernte Wissen anzuwenden – ohne dabei das praktische Alltags- und Kommunikationshandeln aus den Augen zu verlieren. Neben Ethik und Religion ist der Band auch für weitere Unterrichtsfächer empfehlenswert, darunter Wirtschaft und Recht, Sozialkunde oder Deutsch. Die Publikation verdeutlicht, dass das Wissen um digitale Ethik gerade im schulischen Kontext mehr berücksichtigt werden muss. Es bleibt daher zu hoffen, dass dieses Know-how ebenso wie Goethes Faust oder der Satz des Pythagoras zu einem festen Bestandteil der schulischen Bildung werden. hp
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Heinrike Paulus
Beitrag als PDFEinzelansichtDana Neuleitner: Hauser, Stefan/Opilowski, Roman/ Wyss, Eva L. (Hrsg.) (2019). Alternative Öffentlichkeiten. Soziale Medien zwischen Partizipation, Sharing und Vergemeinschaftung. Bielefeld: transcript. 318 S., 29,99 €.
Die öffentliche Kommunikation erfährt durch Soziale Medien und deren Veränderungen einen Strukturwandel. Mit den so entstandenen alternativen Öffentlichkeiten beschäftigt sich die Publikation. Die in diesen Sphären herrschenden verschiedenen Arten des Teilens sowie des Teil-Seins werden in den Beiträgen hinsichtlich privater, öffentlicher und politischer Kommunikation untersucht. Dabei besitzen diese Öffentlichkeiten eine große Macht, da sie beispielsweise politische Akteurinnen und Akteure unter Druck setzen können. In diesem Band widmen sich die Autorinnen und Autoren strukturellen Fragen dieser Handlungsräume unter den Gesichtspunkten der neuen Nutzungsentwicklungen und der sprachlichen Ausgestaltung. Besonders hervorzuheben für den medienpädagogischen Bereich sind die Beiträge zur Debatte über Machtmissbrauch und Sexismus im Internet unter #MeToo sowie zur Trauerarbeit in Sozialen Netzwerken und Blog-Plattformen. Letztere lassen annehmen, dass Trauer vermehrt in der Öffentlichkeit ausgedrückt wird – Sprachlosigkeit würde in den auf Mitteilung basierenden Sozialen Medien demnach wohl nicht akzeptiert werden. Daneben bietet auch die Untersuchung zur Interaktionsvermeidung durch Mediennutzung in der Öffentlichkeit einen interessanten Anreiz, die vermeintlich verbindenden digitalen Medien im Sinne Goffmans aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Inwieweit wird beispielsweise das Smartphone genutzt, um mich mit der Öffentlichkeit nicht zu vernetzen, sondern von ihr abzugrenzen? Dagegen widmet sich ein weiterer Beitrag der Teilhabe durch Soziale Medien, beispielsweise für Selbsthilfegruppen, die sich in „leichter Sprache“ besser wahrnehmbar machen können. Dies stellt ein im Zuge der Inklusion bedeutungsvollen Aspekt dar, der hier gerne etwas ausführlicher hätte behandelt werden können. Der Band zeigt auf, welche zentrale Rolle dem Internet bei der Entstehung von Gemeinschaften zukommt und vereint viele interessante Ansätze. Er richtet sich vor allem an Medienlinguistikerinnen bzw. -linguistiker und Sozial- und Kulturwissenschaftlerinnen bzw. -wissenschaftler. Aufgrund des Spektrums verschiedener Zugänge zum Forschungsgebiet finden sich auch Anhaltspunkte für andere Interessierte. dn
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Dana Neuleitner
Beitrag als PDFEinzelansichtMonika Himmelsbach: Pirsching, Manfred (2019). Bluff-Menschen. Selbstinszenierungen in der Spätmoderne. Weinheim: Beltz Juventa. 326 S., 29,95 €.
In einer Welt, in der Individualisierung und gleichzeitig Konformität gefordert werden, muss sich jedes Subjekt Strategien überlegen, um sich in dieser Umgebung verorten zu können. Schlussendlich wird zum Bluff gegriffen. Bei diesem Begriff handelt es sich laut Pirsching um Denk- und Handlungssysteme, bei denen alle Beteiligten wissen, dass die Spielregeln Fiktionen, Imaginationen und Metaphern enthalten. Ihm zufolge weiß aber nicht nur jede Person von diesem Verfahren – es wird von jeder und jedem auch erwartet, dieses zu beherrschen. Denn ohne diese Fähigkeit wäre es den Menschen nicht möglich, eine Überbrückung zwischen ihrem individuellen und anschlussfähigen Wesen zu schaffen. In Bluff-Menschen will Pirsching beispielhafte Anwendungen dieser Mechanismen aus Religion, Gemeinschaft, Politik und Wissenschaft darlegen. Dabei geht es dem Autor nicht darum, in irgendeiner Form therapeutische oder moralische Wegweiser von dieser Entwicklung weg zu bieten. Vielmehr geht es um die Aufdeckung der Erscheinungsformen. Besonders hervorzuheben sei die ‚Generation Me‘. Ihr werde vermittelt, dass sie einzigartig und wertvoll sei, und große Eigenständigkeit verdiene. Entscheidungsfreiheit kann jedoch auch zu Unsicherheit führen, und begünstigt so die Entwicklung eigener Bluffstrategien. Wie in der Einführung angegeben, verfügt der Band über keine (direkten) Hinweise zu möglichen Verhaltensweisen, die dem entgegenwirken. Dies – zusammen mit den negativ konnotierten Entwicklungen von heute und positiveren Schilderungen von damals – lässt die Leserschaft leider etwas frustriert zurück. Bluff-Menschen eignet sich als Überblick über verschiedene Ausprägungen und Ausbreitungsgebiete des beidseits wahrgenommenen Bluffs. Da keine Hinweise zur Durchbrechung dieser Strukturen vorgestellt werden, können die Erkenntnisse eventuell schwer ohne Mehrarbeit in der Praxis oder Forschung angewandt werden. Der Autor richtet sich vor allem an Soziologinnen und Soziologen. Der Band ist jedoch auch für Tätige in der Pädagogik, Kommunikationswissenschaft und anverwandte Bereiche geeignet. Die Publikation ist übrigens eine komplette Neufassung von Das Selbst, die Maske, der Bluff. Über die Inszenierungen der eigenen Person (2009). mh
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Monika Himmelsbach
Beitrag als PDFEinzelansichtStefanie Neumaier: Zweig, Katharina (2019). Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl. Wo künstliche Intelligenz sich irrt, warum uns das betrifft und was wir dagegen tun können. München: Wilhelm Heyne Verlag. 319 S., 20,00 €.
Unsere Daten sind überall. Mit diesen Informationen können Data Scientists wie Katharina Zweig so einiges herausfinden, zum Beispiel dem Datensatz einer Streamingplattform entnehmen, welche Serien und Filme uns vorgeschlagen werden sollten. Anhand von Alltagsthemen zeigt die Autorin auf, dass Sorgen bei algorithmischer Entscheidungsfindung in den meisten Fällen nicht notwendig sind, sich aber dennoch ein Blick hinter diese Abläufe zur besseren Nachvollziehbarkeit lohnt. Die Autorin und Informatik-Professorin Katharina Zweig beschreibt in ihrem Buch Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl umfassend das Wirkfeld künstlicher Intelligenz. Zugleich sind die inhaltlichen Ausführungen anschaulich dargestellt und somit auch für Fachfremde leicht verständlich. Die Lektüre gibt unter anderem Einblicke in die unterschiedlichen Anwendungsfelder von Algorithmen wie auch zu den Schwäche- und Stärkegraden künstlicher Intelligenzen. Hierbei schlägt Zweig vier Werkzeuge vor, um es mit der mystifizierten Thematik aufzunehmen. Durch wissenschaftliche Ansätze wie Diskriminierungsanalysen zur Entscheidungsfindung und der Erörterung des Menschenbildes in Bezug auf algorithmische Entscheidungssysteme halten auch ethische Überlegungen Einzug. Mit einem Plädoyer für die Sozioinformatik und dem engen Bezug zu den Anwendenden wird die Notwendigkeit interdisziplinärer Wissensbestände unterstrichen. Insgesamt bietet die Publikation einen anschaulichen Einstieg in die Thematik, gleichzeitig lässt sie ihre Leserinnen und Leser durch die Vermittlung spezifischen Fachwissens brillieren. Die Autorin führt die Leserschaft mit einer wohltuenden Leichtigkeit durch die Welt der Algorithmen. Dabei ist Zweigs Grundüberzeugung und Faszination für die Wissenschaft als „die beste Mischung aus Detektivspiel und ernsthafter Suche nach Erkenntnis“ hochgradig ansteckend. sn
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Stefanie Neumaier
Beitrag als PDFEinzelansicht
kolumne
Klaus Lutz: Wer soll dein Herzblatt sein?
Trotz der Verlockungen des Beziehungsmodells der 68er-Generation wählen die meisten das klassische Beziehungsmodell der Paarbeziehung als Lebensentwurf. Sogar Rainer Langhans hat in einer TV-Show bedauert, dass es ihm nicht gelungen ist, Uschi Obermaier fest an sich zu binden. Es ist aber eine durchaus schwierige Entscheidung, den richtigen Partner zu wählen. Man ist hin- und hergerissen zwischen all den großartigen Persönlichkeiten, die für eine feste Beziehung zur Wahl stehen. Da hilft oft nur – wie bei anderen kniffligen Entscheidungen –, sich mit einer Pro- und Contra-Liste etwas mehr Klarheit zu verschaffen. Zugegeben, ich gehöre nicht zu den Menschen, die allzu oft in so einer Zwickmühle stecken. Aber neulich war es dann doch soweit. Ich musste mich entscheiden, wer mein Herzblatt sein soll: Die Uschi? Oder doch die Bibi? Ein paar Worte zu Uschi: Sie ist schon lange an meiner Seite, denkt klar und strukturiert und ist äußerst verlässlich. In all den Jahren unserer Beziehung hat sie mich nur selten in die Irre geführt und ist immer gradlinig ihren Weg gegangen. Ja, sie ist nicht immer fehlerfrei und verliert auch schon einmal die Orientierung, wenn es darum geht, neue Wege zu wagen. Sie ist auch nicht immer ganz im Bilde darüber, was in ihrer Umgebung so vor sich geht. Auch macht sie ihre Probleme lieber mit sich selbst aus, was eine gewisse Beschränktheit ihrer Innovationsfähigkeit mit sich bringt. Aber auf ihr bekanntem Terrain bewegt sie sich sicher und souverän – sofern sie sich nicht zu Fuß fortbewegen muss. Und dann wäre da noch Bibi: Sie ist innovativ, ‚fresh' und immer bereit, Informationen anderer aufzunehmen und zu verarbeiten. Sie überrascht mich immer wieder mit neuen Gedanken und scheint – fast magisch – die Zukunft voraussehen zu können. Sie kann sich sehr feinfühlig auf die Bedürfnisse anderer einstellen und hat gleichwohl eine rationale Analyse für vielschichte Problemstellungen parat. Sie ist praktisch mit allem und jedem vernetzt und bereichert so den Alltag mit immer neuen Ideen. Sie kennt jede Kneipe, jedes Hotel und jede Tankstelle in der Umgebung und kann zuversichtlich auch noch die Öffnungszeiten sowie den Ruhetag benennen. Schwierig gestaltet es sich allerdings, wenn die Verbindung zu ihr abreißt: Dann geht nichts mehr, es herrscht völliger Stillstand – von sich aus meldet sie sich nie. Leider kommt das immer wieder vor. So, Klaus! Wer soll denn jetzt dein Herzblatt sein? Uschi, die immer treu an deiner Seite steht, kaum Fehler macht und auch in Zukunft eine verlässliche Partnerin sein wird. Oder Bibi, die deinen Alltag mit neuen Ideen bereichert, offen und aufgeschlossen mit allen kommuniziert, aber auch manchmal den Kontakt völlig abreißen lässt. Tja, Klaus, jetzt musst du dich entscheiden. Ich habe mich für Bibi entschieden. Mir war es doch wichtiger, mit meiner Umgebung vernetzt zu sein, in Echtzeit Alternativen zu längst vertrauten Wegen zu entwickeln und immer wieder neue Fähigkeiten zu entdecken. Deshalb künftig also nur noch Navigation mit dem Handy und mit GoogleMaps. Bibi macht das schon, und die fest eingebaute Uschi hat ausgedient. Ach ja, hatte ich erwähnt, dass alle meine Navigationssysteme weibliche Vornamen haben? Das ist – wie viele Männer wissen – einfach der Gewohnheit (erstes Navi im Auto: die eigene Ehefrau) und der Höflichkeit (irgendwie muss ich sie ja ansprechen, wenn ich mit ihnen streite) geschuldet. Die einzige Frage, die für mich offen bleibt: Wie sprecht ihr Frauen eigentlich eure elektronischen Helferlein an?
Beitrag aus Heft »2020/01 Wie analog ist digitale Gewalt?«
Autor: Klaus Lutz
Beitrag als PDFEinzelansicht
Ansprechperson
Kati StruckmeyerVerantwortliche Redakteurin
kati.struckmeyer@jff.de
+49 89 68 989 120
Ausgabe bei kopaed bestellen
Zurück