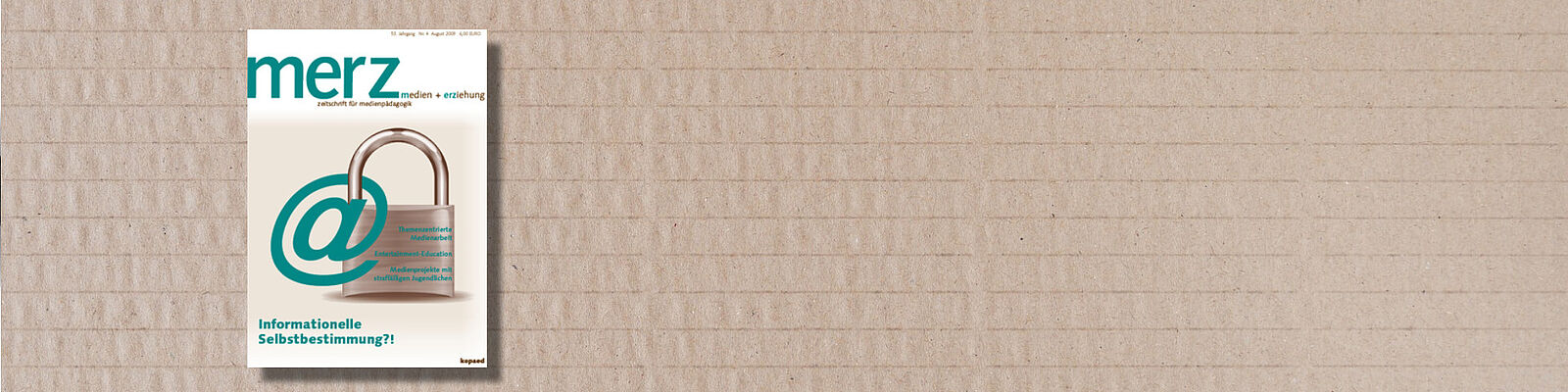2009/04: Informationelle Selbstbestimmung?!
Facebook und MySpace, Google Earth und Yasni – nie war das Privatleben der Menschen einer so großen Öffentlichkeit ausgesetzt wie in Zeiten von Mitmach-Internet und Social Software. Persönliche Daten sind, für jedermann zugänglich, in rauen Mengen online zu finden. Gerade Jugendliche machen sich dies zunutze, richten sich online regelrecht ein und pflegen dort Freundschaften. Viele Datenschützer dagegen warnen vor Gefahren wie Datenmissbrauch und Cybermobbing. In der aktuellen Ausgabe von merz | medien + erziehung beschäftigen sich die Autorinnen und Autoren mit diesem Konflikt. Sie stellen den Status Quo im Web 2.0 dar, zeigen Möglichkeiten und Vorteile für Nutzende aber auch Gefahrenpotenziale auf und präsentieren bisherige Herangehensweisen zum (medienpädagogischen) Umgang mit dem Phänomen.
aktuell
stichwort creative commons
Urheberinnen und Urheber verwenden das Lizenzierungsmodell Creative Commons, um ihre Werke (Ton, Text, Foto oder F ilm) im Internet zu verteilen und der Gemeinschaft zu schenken. Creative Commons (CC) heißt übersetzt Schöpferisches Allgemeingut und füllt die Lücke zwischen ‚alle Rechte’ und ‚keine Rechte vorbehalten’, wenn es um die Verwertung von kulturellen Gütern geht. Eine Künstlerin bzw. ein Künstler, der sein Schaffen unter CC veröffentlicht, verzichtet bewusst auf Verwertungsgesellschaften, erlaubt den kostenlosen Download seines Werkes, die Verbreitung (digitale Kopie) und öffentliche Aufführung bzw. Vorführung. Er kennzeichnet es entweder mit der Lizenz by-nc-nd oder by-nc-sa. CC-Inhalte mit der ersten Lizenz stehen für: Namensnennung (by), nicht-kommerzielle Nutzung (nc), keine weitere Bearbeitung (nd) und bieten sich für den Einsatz in Medienproduktionen mit Kindern und Jugendlichen an. CC-Musik darf im Podcast oder in der Jugenddisko gespielt werden, CC-Fotos können in Weblogs oder Fotoalben auftauchen, solange kein Geld mit dem Einsatz dieser CC-Medien verdient wird. CCMedien mit der Lizenz sa (share alike) dürfen genauso eingesetzt werden, mit dem Unterschied: Der Urheber erlaubt ausdrücklich die Bearbeitung (Remix, Mash-up) des Originals, solange das neue Werk unter denselben Bedingungen wieder veröffentlicht wird. Man konsumiert nicht nur Gratis-Medien, sondern stellt der Allgemeinheit mit Creative Commons selbst ein neues Werk zur Verfügung – kostenlos.
Beitrag aus Heft »2009/04: Informationelle Selbstbestimmung?!«
Autor: Marco Medkour
Beitrag als PDFEinzelansichtnachgefragt: Mathias Schindler, Vorstandsmitglied, Pressesprecher und Projektmanager Wikimedia Deutschland
Seit 2001 gibt es Wikipedia in Deutschland, doch obwohl das Portal erst acht Jahre alt ist, hat es eine rasante Entwicklung hinter sich – treffenderweise, denn mit „rasant“ oder „schnell“ wird auch das hawaiianische Wort „Wiki“ übersetzt. Der zweite Teil des Namens Wikipedia stammt von der englischen Schreibweise des Wortes „encyclopedia“. Mittlerweile 929 427 Artikel in deutscher Sprache kann die „Freie Enzyklopädie“ bereits aufweisen, täglich kommen zahlreiche hinzu. Verfasst werden die Artikel von freiwilligen und ehrenamtlichen Autorinnen und Autoren. Mathias Schindler ist Mitglied des Vorstandes bei Wikimedia Deutschland und Pressesprecher von Wikipedia. Gegenüber merz zeigt er die Entwicklung des Portals auf, äußert sich zur Problematik der Wissenschaftlichkeit der Artikel in Bezug auf Schule und Studium und stellt grundsätzliche Funktionsweisen des Portals vor.
merz
Wikipedia hat sich in relativ kurzer Zeit bereits zu einem der bekanntesten und beliebtesten Internetportale unter Jugendlichen zwischen zwölf und 19 Jahren entwickelt und wird von ihnen nicht zuletzt als zentrale Quelle zum Wissenserwerb, gerade bei der Vorbereitung ihrer Schulaufgaben, genutzt. Wie stehen Sie zu dieser Entwicklung?
Schindler
Alle sechs Monate bekommen wir Pressemitteilungen von Meinungsforschungsinstituten auf den Tisch, die besagen, dass die Nutzungszahlen von Wikipedia noch ein wenig mehr gestiegen sind, quer durch die Altersschichten. Bei Schülerinnen und Schülern sowie Studentinnen und Studenten sind Bekanntheit und Nutzung besonders hoch und dies ist grundsätzlich eine sehr positive Entwicklung. Was jetzt noch fehlt, ist eine viel größere Bekanntheit der Art und Weise, wie die Inhalte in Wikipedia erstellt werden, welche Mittel zur Qualitätssicherung existieren und wie Leserinnen und Leser möglichst einfach die Verlässlichkeit eines konkreten Artikels abschätzen können. In einer idealen Welt wäre Wikipedia nur der Start, nicht aber das Ende einer sorgfältigen Recherche. Positiv ist diese Entwicklung daneben auch unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit. Alle Wikipedia-Inhalte stehen unter einer Lizenz, die jedermann die Nutzung, Bearbeitung und Verbreitung der Inhalte ermöglicht. Damit stellen wir sicher, dass es Wikipedia-Inhalte auch noch in zehn oder 20 Jahren gibt. Dies ist nicht nur ein theoretischer Vorteil, wenn man bedenkt, dass man in diesen Tagen regelmäßig von Webseiten und Firmen hört, deren Geschäftsmodell weniger solide war als erhofft. Im Oktober 2009 wird etwa die Encarta offline gehen, das Meyers Lexikon ist es schon. Der Ansatz der Betreibergesellschaft Wikimedia Foundation, auf die Spendenbereitschaft der Leserinnen und Leser zu setzen, scheint bei solchen Nachrichten bislang das stabilste und nachhaltigste Modell zu sein.
merz
Die Tatsache, dass Wikipedia-Artikel keine wissenschaftliche Quelle darstellen, ist den meisten Schülerinnen und Schülern und sogar zahlreichen Studierenden noch immer nicht bewusst. Halten Sie es daher für notwendig, die Nutzerinnen und Nutzer verstärkt darüber aufzuklären?
Schindler
Wir raten traditionell davon ab, Wikipedia – und im Übrigen auch jedes andere Lexikon – als Ersatz für Primär- und Sekundärliteratur anzusehen. Unser Verein Wikimedia Deutschland würde hier sehr gerne eine Reihe von Veranstaltungen fortsetzen, die wir vor zwei Jahren begonnen haben. Im Schulprojekt besuchen Wikipedia-Referentinnen und -Referenten Schulklassen und ihre Lehrkräfte und gehen speziell auf die Eigenheiten dieses Nachschlagewerkes, den medienkompetenten Umgang mit Netzressourcen und erste Schritte für ein aktiveres Verhalten in kollaborativen Umgebungen ein. Im Moment suchen wir hier allerdings noch nach Förderern für diese Veranstaltungsreihe.
merz
Es hat den Anschein, dass immer mehr Wikipedia-Artikel für die (spontane) Bearbeitung gesperrt werden. Außerdem wurde 2008 das System der ‚Sichtung’ eingeführt. Das bedeutet, dass Artikel den Benutzerinnen und Benutzern nicht automatisch angezeigt werden, wenn sie nicht geprüft und gegebenenfalls geändert wurden. Steht dahinter die Bestrebung, Wikipedia mittelfristig zu einem ‚klassischen‘ Lexikon weiterzuentwickeln? Widerspricht das nicht der Grundidee eines freien Wissensaustausches?
Schindler
Bei Wikipedia gibt es zwei Stufen der Seitensperrung. Bei einer Vollsperrung kann ein Artikel ausschließlich von Administratorinnen und Administratoren bearbeitet werden. Dies kommt dann zum Einsatz, wenn gerade große Unstimmigkeiten zu einem bestimmten Text herrschen, die aber zuerst von allen Benutzerinnen und Benutzern auf der jeweiligen Diskussionsseite abgearbeitet werden müssen. Solche Vollsperrungen sind temporärer Natur. Zum anderen gibt es die Halbsperrung von Artikeln, bei der nur angemeldete Benutzerinnen und Benutzer die Artikel bearbeiten können, die schon wenigstens ein paar Tage dabei sind. Die Hürden für den Einsatz der Halbsperrung sind etwas niedriger, beispielsweise bei A-Prominenz, aktuellen Ereignissen oder einer längeren Historie des Vandalismus. Die Halbsperrung ist inzwischen etwas mehr als dreieinhalb Jahre alt und wir sehen bislang keinen signifikanten Zuwachs im Anteil halbgesperrter Seiten. Im Gegenteil, durch die Einführung der Halbsperrung 2005 konnten wir sogar teilweise hier bei einigen Artikeln auf dieses mildere Mittel zurückgreifen, wo früher nur eine Vollsperrung möglich gewesen wäre. Etwas neuer ist die Idee der gesichteten Versionen. Wir geben hier den Nutzerinnen und Nutzern die Wahl, ob sie entweder die tatsächlich jüngste Artikelversion sehen wollen oder aber die jüngste Artikelversion, die vonanderen Wikipedia-Autorinnen oder -Autoren kurz gegengelesen wurde. Es geht hier primär darum, einen Stempel zur Verfügung zu stellen, der anzeigt, dass diese Artikelversion frei von offensichtlichen Formen des Vandalismus ist. Mit diesem Werkzeug haben wir bis datogute Erfahrungen gemacht und nach einer Testphase sind die gesichteten Versionen nun eine dauerhafte Einrichtung der deutschsprachigen Wikipedia.
thema
Hans-Dieter Kübler: Editorial
Datenschutz – ein Menschenrecht?
Als im Dezember 1983 das Bundesverfassungsgericht nach mehr als 1.600 Beschwerden gegen die 1978 durchgeführte Volkszählung sein Grundsatzurteil fällte und darin als neues Grundrecht die informationelle Selbstbestimmung begründete, wurde diese Entscheidung als Erweiterung, mindestens als moderne Anpassung der unverletzlichen, vom Staat prinzipiell zu schützenden Menschenrechte gefeiert. Die Karlsruher Richter bezogen sich bei ihrem Urteil auf Art. 1 (1) (Menschenwürde) und Art. 2 (1) GG (allgemeine Handlungsfreiheit) und schufen so ein neues Persönlichkeitsrecht, zu dem neben dem Recht am eigenen Bild, dem Schutz der Privat- und Intimsphäre auch die informationelle Selbstbestimmung zählt. Und – aus heutiger Sicht recht vollmundig – begründeten sie: „Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wäre eine Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß“ – eine Maxime, die man bis heute gründlich genug bedenken muss.
Übrigens: Eine förmliche Einfügung eines Datenschutz-Grundrechtes in den Grundrechte-Katalog fand seither unter den jeweils politisch Handelnden keine Mehrheit. Vielmehr wurden in allen Ländern und im Bund Datenschutzgesetze erlassen und Datenschutzbeauftragte eingesetzt, deren jährliche – meist öffentlich unbeachtete – Berichte gemeinhin besorgte Auskunft über den tatsächlichen Stand des Datenschutzes hierzulande geben und jener Maxime des Bundesverfassungsgerichts häufig hohnsprechen. Die Widersacherinnen und Widersacher und diejenigen, die Beschwerde gegen die Volkszählung führten, die der damalige Innenminister Zimmermann sogleich als Verfassungsfeindinnen und Verfassungsfeinde diffamierte, argumentierten mehrheitlich noch eher mit inzwischen fast naiven Kategorien des Orwell‘schen Überwachungsstaates, stellten die staatlich beauftragten Fragestellerinnen und Fragesteller mit ihren umständlichen Fragebögen unter Generalverdacht und plädierten dafür, sie nicht ins Haus zu lassen oder allenfalls nur die amtlich schon bekannten Daten zu bestätigen. Die ‚normale’ Bürgerin und der ‚normale’ Bürger mussten hingegen – trotz des erheblichen, seither nicht mehr vergleichbar lauten Protestes, auch von Informatikern – erst allmählich lernen, dass es „personenbezogene“ Daten gibt, die sie erfassen, kenntlich machen und die deshalb geschützt werden müssen. Die häufige Reaktion damals lautete noch, man habe doch nichts verbergen, oder man gebe nichts preis, was der Staat und die Ämter nicht ohnehin schon wüssten.
Staatliche und private Datensammelwut
Aus heutiger Sicht muten diese Auseinandersetzungen recht rührend an – trotz oder gerade wegen der vielen öffentlichen Bekundungen darüber, wie umfassend und gründlich der Datenschutz hier gewahrt wird, wie sie etwa anlässlich des 25-jährigen Bestehens verlautbart wurden. Denn seiner verfassungsrechtlichen Aufgabe des umfassenden und wirksamen Datenschutzes ist der Staat seither kaum nachgekommen, ganz zu schweigen von einem offensiven Einstehen für die politische Ausgestaltung der informationellen Selbstbestimmung. Diese Kritik äußern Expertinnen und Experten des Daten- und Verbraucherschutzes trotz einiger Verbesserungen erneut anlässlich des am 1. September 2009 in Kraft tretenden neuen Datenschutzgesetzes. Allenfalls wirken die bestellten Datenschützerinnen und Datenschützer in diese Richtung; sie sind aber weitgehend machtlos angesichts eines unwillentlichen Gesetzgebers und einer oft bedenkenlos agierenden Bürokratie, und meist bleiben ihnen nur wirkungslose öffentliche Appelle. Vollends nach 09/11 und der seither grassierenden Terrorismusphobie hat sich der Staat mit dem Anspruch der Gewaltprävention vom Schützer zum Täter gewandelt und weitet unter dem vom Bundesverfassungsgericht zugestandenen Kriterium des Allgemeininteresses Einschränkungen oder (auch heimliche) Unterhöhlungen des Datenschutzes konsequent aus: Wer weiß heute denn noch wirklich, wer, was, wo, über wen sammelt. Die juristisch subtile Unterscheidung zwischen personalisierbaren und anonymisierten Daten, die man getroffen hat, um die Persönlichkeit zu schützen und zugleich der Statistik und formellen Datenerfassung freien Lauf zu lassen, hat die moderne Computertechnologie weitgehend unterlaufen: Mit der automatischen Rekonstruktion und Registrierung von Datenströmen lässt sich zwar noch nicht das einzelne Individuum eindeutig identifizieren, aber Typologien und Profile erstellen, die sehr präzise Populationen umkreisen und für die jeweiligen Zwecke oft sogar aussagekräftiger sind. Banken deklassieren so ganze Viertel, deren Bewohnerinnen und Bewohner keine Kredite bekommen oder für die sie zumindest teurer bezahlen müssen. Datenspuren werden mit jedem Griff an Tastatur und Maus angelegt, rasant und perfekt kombiniert, letztlich niemals gelöscht und inzwischen vielfach vermarktet. Mit Musterkennungen und visuellen Registriermethoden via Videokameras werden diesen Daten mittlerweile mehr und mehr Gesichter, Fingerabdrücke und andere optische Kennzeichen verliehen, die sich umstandslos mit den formellen Daten verknüpfen lassen und dann letztlich jeden und jede identifizieren. Diese neuen Phänomene sind rechtlich noch kaum erfasst, und ob sie es jemals zureichend werden, daran lässt sich angesichts der laufenden Gesetzgebung zweifeln. Auf Kredit-, Rabatt-, Kunden-, Mitglieds- und Gesundheitskarten werden längst persönliche ‚Datenbanken’ angelegt, die mit jeder Berührung einer Schnittstelle ausgelesen und weiterverbreitet werden können, ohne dass die Besitzerin oder der Besitzer dies möchte oder gar merkt. Vielen sind diese Entwicklungen inzwischen zwar vage bewusst, aber dagegen tun können sie wenig, selbst wenn die einschlägigen Gesetze Einsprüche und Widerstandsoptionen eröffnen. Womöglich rührt daher die häufig bekundete Hilflosigkeit der meisten, aber auch die Sorglosigkeit vieler, nicht nur Jugendlicher darüber, dass sie ihre Daten nicht nur heimlich entfleuchen lassen wollen, sondern absichtlich selbst auf Plattformen und bei Social Communitys einstellen – nach dem Motto: Wenn es schon überall und fortwährend passiert, dann will ich es zumindest auch mal selbst tun. Die vielen, nur zufällig aufgedeckten Skandale in Unternehmen, öffentlichen Räumen und staatsnahen Organisationen, die womöglich nur die Spitze des Datendeals und -missbrauches markieren, belegen erschütternd, dass es dagegen keinen wirksamen rechtlichen und politischen Schutz mehr gibt. Allein zivilgesellschaftliches Bewusstsein und öffentliche Wachsamkeit bis hin zum kollektiven Ungehorsam können langfristig noch etwas bewirken. Auch wenn es schmerzt und betrübt: Nur die Einzelnen können sich dafür sensibilisieren, wappnen und etwas dagegen tun. Mit dieser Erkenntnis ist Pädagogik gefragt und Medienpädagogik muss sich auf dieses sicherlich schwierige, weil rechtlich komplizierte und politisch verminte Territorium wagen. Die folgenden Beiträge geben dazu vielfältige, auch inhaltlich und argumentativ unterschiedliche Orientierungen.
Zu den Beiträgen
Grundlegend führt Friedrich Krotz in die komplexe Thematik ein: Zum einen zeigt er in einer kompakten Skizze auf, wie sich Öffentlichkeit und Privatheit im Laufe der jüngeren Geschichte verändern, diffus aufeinander beziehen und auch überlappen. Dabei ist ihm wichtig, gesellschaftliche Bedingungsgefüge herauszuarbeiten und nicht einer simplen Verursachung durch technologische Zwänge das Wort zu reden. Zum anderen stellt er energisch in Frage, ob Jugendliche allein für ihren vorgeblich sorglosen Umgang mit ihren Daten verantwortlich gemacht werden sollen und warum der Staat seine Schutzfunktion nicht mehr genügend wahrnimmt. Seine Hoffnung, mit Kreativität und Solidarität dieser fatalen Entwicklung zu begegnen, werden viele teilen, auch wenn sie nicht sehr zuversichtlich klingt. Aus rechtlicher Sicht erläutert Marc Liesching als einschlägig spezialisierter Rechtsanwalt die rechtlichen Regelungen des Datenschutzes, insbesondere bezogen auf Online-Communitys; er expliziert die relevanten Begriffe und Sachverhalte, weist aber auch auf Grauzonen und Schwachstellen hin. So erkennt er etwa den allgemeinen Grundsatz der Datenvermeidung und -sparsamkeit, dem amtliche Stellen verpf lichtet sind, als„stumpfes Schwert“. Damit zeugt er von einem juristischen Problembewusstsein, das man auch gesetzgeberischen Kreisen wünscht.
Wie Jugendliche selbst das Spannungsfeld zwischen Privatheit und Öffentlichkeit bzw. ihre Privatsphäre in Online-Communitys sehen und dabei bewährte, auch juristisch normierte Setzungen konterkarieren – das wird im einem Forschungsprojekt am JFF authentisch erkundet und im Beitrag von Niels Brüggen anschaulich dargestellt. Offensichtlich erfahren Jugendliche diese virtuellen Räume mit ihren vielfältigen Mitmach- und Darstellungsofferten, mit ihren Foren für Austausch und Freunde als jugendautonome Interaktionsoptionen, ohne dabei zu bedenken, dass ihnen die gesamte Internetwelt zuschaut und dass diese Social Communitys aus recht durchsichtigen ökonomischen Interessen bereitgestellt und auch ausgebeutet werden. Wenn Tagebücher, Poesie- und Fotoalben, Briefe, selbst Telefonate in veränderter Form ins Netz wandern, werden Jugendliche insgeheim ihrer Privatheit beraubt, die sie in diesem Alter als Entwicklungsaufgabe gerade erst erobern und gegenüber Eltern und Schule behaupten müssen. Diese (un-)heimliche Dialektik mit ihnen zu erarbeiten, nicht von oben herab zu vermitteln, bedeutet sicherlich eine überaus anspruchsvolle Aufgabe für Medienpädagogik. Von Erfahrungen der medienpraktischen Arbeit aus beleuchten Sebastian Ring und Kati Stuckmeyer abschließend das Spannungsverhältnis zwischen Partizipation und Datenschutz, in das Jugendliche beim „Mitmach-Web“ ständig hineingeraten. Vier Problemfelder identifizieren sie: Durch Speicherung und Steuerung der Daten bei Dritten geht die „Kontrollmacht“ über die eigenen Daten verloren. Ferner können sich durch diverse Zugänge verschiedene Akteure der Daten bedienen. Drittens werden durch unbedachte Aktivitäten im Netz Personen und deren Recht beschädigt. Und endlich führt die leichte Zugänglichkeit von Daten zur Verletzung von Urheberrechten mit oft erheblichen Folgen. In zwei medienpädagogischen Projekten bearbeiten sie diese Probleme mit Jugendlichen und können zeigen, dass solche Initiativen durchaus kognitive und sensibilisierende Wirkungen zeitigen. Abschließend gibt Elisabeth Jäcklein einen Überblick über Good Practice-Angebote zum Thema Datenschutz.
Beitrag aus Heft »2009/04: Informationelle Selbstbestimmung?!«
Autor: Hans-Dieter Kübler
Beitrag als PDFEinzelansichtFriedrich Krotz: Die Veränderung von Privatheit und Öffentlichkeit in der heutigen Gesellschaft
Jugendliche geben ihr Leben immer häufiger im Internet preis. Was von vielen Seiten oftmals als Dummheit und Leichtsinn betitelt wird, gehört aber zur Entwicklung Heranwachsender. Ob sich nur das Medium verändert hat, in dem sich das Erwachsenwerden abspielt, oder ob sich der Wert von Öffentlichkeit und dessen Verhältnis zur Privatheit gewandelt haben, hängt von unterschiedlichen Perspektiven ab.
Literatur
Dewey, John (1927). The Public and its Problems. New York: Holt.Etzioni, Amitai (1999). The Limits of Privacy. New York: Basic Books.
Gerhards, Jürgen/Neidhardt, Friedhelm (1991). Strukturen und Funktionen moderner Öffentlichkeit: Fragestellungen und Ansätze. In: Müller-Doohm, Stefan/Neumann-Braun, Klaus (Hrsg.), Öffentlichkeit, Kultur, Massenkommunikation. Oldenburg: Bibliothek der Universität, S. 31-90.
Habermas, Jürgen (1987). Theorie kommunikativen Handelns, 2 Bände, 4. Auflage. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Habermas, Jürgen (1990). Strukturwandel der Öffentlichkeit. 2. Auflage. Frankfurt am Main: Suhrkamp.Krotz, Friedrich (2007). Mediatisierung. Fallstudien zum Wandel von Kommunikation. Wiesbaden: VS Verlag.
Lingenberg, Swantje (2009). Europäische Öffentlichkeit – Öffentlichkeit ohne Publikum? Ein pragmatischer Ansatz mit Fallstudien zur europäischen Verfassungsdebatte. Wiesbaden: VS Verlag.
Lippmann, Walter (1925). The phantom public. New York: Harcourt, Brace and Company.Schaar, Peter (2007). Das Ende der Privatsphäre. Der Weg in die Überwachungsgesellschaft. 2. Auflage. München: C. Bertelsmann.
Schulzki-Haddouti, Christiane (2004). Im Netz der inneren Sicherheit. Die neuen Methoden der Überwachung. Hamburg: EVA.
Sennett, Richard (1986). Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität. Frankfurt am Main: Fischer.
Singelnstein, Tobias/Stolle, Peer (2006). Die Sicherheitsgesellschaft. Soziale Kontrolle im 21. Jahrhundert. Wiesbaden: VS Verlag.Ström, Pär (2006). Die Überwachungsmafia. Das lukrative Geschäft mit unseren Daten. München: Wilhelm Heyne.
Beitrag aus Heft »2009/04: Informationelle Selbstbestimmung?!«
Autor: Friedrich Krotz
Beitrag als PDFEinzelansichtMarc Liesching: Datenschutz in Online-Communitys
Das Datenschutzrecht in Deutschland hat über Jahrzehnte eine komplexe Ausprägung in allgemeinen und speziellen gesetzlichen Regelungen gefunden. Gleichwohl sind zahlreiche Bestimmungen derart unbestimmt und in der Rechtsprechung bislang wenig konkretisiert, dass ihre praktische Anwendung auf neue Erscheinungsformen wie insbesondere Online-Communitys und Social Networks teilweise unklar und teilweise umstritten ist. Vor allem bei minderjährigen Nutzerinnen und Nutzern ergeben sich Problemstellungen, die allein durch das Recht kaum zu lösen sind und mithin auch Aufgaben an die pädagogische Betreuungsarbeit adressieren.
Beitrag aus Heft »2009/04: Informationelle Selbstbestimmung?!«
Autor: Marc Liesching
Beitrag als PDFEinzelansichtNiels Brüggen: „Privatsachen im Internet“ oder „Mein Privatleben geht nur mich was an“
Welche Vorstellungen haben Jugendliche von ihrer Privatsphäre bei Sozialen Netzwerk-Diensten wie SchuelerVZ.net, lokalisten.de oder werkenntwen.de? Bislang werden ihre Umgangsweisen mit diesen Angeboten vornehmlich aus der Perspektive Erwachsener betrachtet und bewertet. Die Perspektive jugendlicher Nutzender nachzuvollziehenbietet jedoch Ansatzpunkte für eine pädagogische Unterstützung ‚auf Augenhöhe‘ und verdeutlicht zum anderen einen gesamtgesellschaftlichen Diskussionsbedarf über Wert und Schutz von Privatheit angesichts veränderter medialer Öffentlichkeiten.
Literatur
Boyd, Danah (2008). Taken Out of Context. American Teen Sociality in Networked Publics. University of California, Berkeley. www.danah.org/papers/TakenOutOfContext.pdf [Zugriff: 19.01.2009]
Brüggen, Niels (2008). Kompetenter Medienumgang aus Sicht der Heranwachsenden. In: Wagner, Ulrike (Hrsg.), Medienhandeln in Hauptschulmilieus. Mediale Interaktion und Produktion als Bildungsressource. München: kopaed, S. 186–207.
Brüggen, Niels/Wagner, Ulrike (2008). Pädagogische Konsequenzen. In: Wagner, Ulrike (Hrsg.), Medienhandeln in Hauptschulmilieus. Mediale Interaktion und Produktion als Bildungsressource. München: kopaed, S. 223–246.
Busse, Kristina (2009). Attention Economy, Layered Publics, and Research Ethics. Herausgegeben von University of Texas. University of South Alabama. (Flow TV). flowtv.org/?p=3913#printpreview [Zugriff: 02.06.2009]
Fend, Helmut (2001). Entwicklungspsychologie des Jugendalters. Ein Lehrbuch für pädagogische und psychologische Berufe. 2. durchges. Auflage. Opladen: Leske + Budrich.
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.). JIM-Studie 2008. Jugend, Information, (Multi-)Media. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger. Stuttgart.
Palfrey, John/Gasser, Urs (2008). Generation Internet. Die Digital Natives Wie sie leben – Was sie denken – Wie sie arbeiten. München: Hanser.Schorb, Bernd/Kießling, Matthias/Würfel, Maren/Keilhauer Jan (in Vorbereitung).
MeMo_SON09 – Medienkonvergenz Monitoring Soziale Online-Netzwerke-Report 2009. Universität Leipzig, Lehrstuhl für Medienpädagogik und Weiterbildung. www.medienkonvergenz-monitoring.de.
Wagner, Ulrike (Hrsg.) (2008). Medienhandeln in Hauptschulmilieus. Mediale Interaktion und Produktion als Bildungsressource. München: kopaed.
Wagner, Ulrike/Brüggen, Niels/Gebel, Christa (2009). Web 2.0 als Rahmen für Selbstdarstellung und Vernetzung Jugendlicher. Analyse jugendnaher Plattformen und ausgewählter Selbstdarstellungen von 14- bis 20-Jährigen. Erster Teil der Studie „Das Internet als Rezeptions- und Präsentationsplattform für Jugendliche“ im Auftrag der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM). Unter Mitarbeit von Peter Gerlicher und Kristin Vogel. JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. www.jff.de/dateien/Bericht_Web_2.0_Selbstdarstellungen_JFF_2009.pdf [Zugriff: 25.06.2009]
Beitrag aus Heft »2009/04: Informationelle Selbstbestimmung?!«
Autor: Niels Brüggen
Beitrag als PDFEinzelansichtSebastian Ring und Kati Struckmeyer: Mitmachen im Web 2.0
Das Mitmach-Netz ist aus dem Alltag Jugendlicher längst nicht mehr wegzudenken. Dass Web 2.0-Plattformen für die Heranwachsenden aber nicht nur Risiken bergen, sondern durchaus auch medienpädagogische Potenziale, zeigen zwei Projekte des JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Neben der nötigen Aufklärung der Jugendlichen steht dabei vor allem die kompetente und selbstbestimmte Nutzung der Vorteile von Web2.0-Angeboten im Vordergrund.
Literatur
Grimm, Petra/Rhein, Stefanie/Clausen-Muradian, Elisabeth (2008). Gewalt im Web 2.0. Der Umgang Jugendlicher mit gewalthaltigen Inhalten und Cyber-Mobbing sowie die rechtliche Einordnung der Problematik. Berlin: Vistas.
Grimm, Petra/Rhein, Stefanie (2007). Slapping, Bullying, Snuffing! – Zur Problematik von gewalthaltigen und pornografischen Videoclips auf Mobiltelefonen von Jugendlichen. Berlin: Vistas.
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) (2008). JIM – Jugend, Information, (Multi-)Media. Stuttgart.
Schorb, Bernd/Theunert, Helga (Hrsg.). merz – medien + erziehung: Zeitschrift für Medienpädagogik. Ausgabe 02/2009. Selbstentblößung und Bloßstellung in den Medien. München: kopaed.
Wagner, Ulrike (2009). Web 2.0 als Rahmen für Selbstdarstellung und Vernetzung Jugendlicher. München. www.jff.de/index.php?BEITRAG_ID=5809 [Zugriff: 14.06.2009]
Wagner, Ulrike (Hrsg.) (2008). Medienhandeln in Hauptschulmilieus. Mediale Interaktion und Produktion als Bildungsressource. München: kopaed.
Beitrag aus Heft »2009/04: Informationelle Selbstbestimmung?!«
Autor: Sebastian Ring, Kati Struckmeyer
Beitrag als PDFEinzelansichtElisabeth Jäcklein-Kreis: Datenschutz im Internet – Hier werden Sie geholfen!
Schützt eure Daten! So klingt die Devise allüberall. Datenklau, Cybermobbing und der digitale Big Brother lauern scheinbar in allen Verknüpfungen des World Wide Web. Doch was tun? Zwar ist Selbsterkenntnis – so das viel bemühte gef lügelte Wort – bekanntlich der erste Schritt zur Besserung, allein die Mittel fehlen dem „willigen Geist“ nicht selten. Und nicht jeder, der sich schon einmal nebulös vorgenommen hat, seine Daten in Zukunft besser zu schützen, weiß sofort, dass dazu keine Bankschließfächer und Tresore notwendig sind.Da ist guter Rat gefragt – und der ist auch zu finden. Verschiedene Institutionen, Einrichtungen und Initiativen haben das Problem bereits erkannt und versuchen nun tatkräftig, es zu bannen, indem sie Hilfe suchenden Netz-Nutzerinnen und -Nutzern Informationen, Tipps und auch ganz praktisches Material an die Hand geben. Vom trockenen Aufsatz über Urheberrecht bis zum spannenden Datenschutz-‚Adventure’, von Tipps für die kleinsten User bis zu kompletten Handreichungen für Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie Pädagoginnen und Pädagogen, fast alles kann man finden. Wobei natürlich nicht alles informatives ‚Gold’ ist, was im Internet so steht und glänzt. Sinnvolle und kritische Auswahl der Angebote ist deshalb vonnöten.
www.bmfsfj.de – Publikationen
www.politischebildung.nrw.de – Multimedia – Podcasts
www.internauten.de
Beitrag aus Heft »2009/04: Informationelle Selbstbestimmung?!«
Autor: Elisabeth Jäcklein-Kreis
Beitrag als PDFEinzelansicht
spektrum
Sarah Lubjuhn und Martine Bouman: Entertainment-Education in den Niederlanden und den USA
Entertainment-Education (E-E) ist eine Kommunikationsstrategie, die unterhaltende und bildende Elemente in Medienbotschaften integriert. Dieser Artikel zeigt, wie die ‚Unterhaltungsseite’ und die ‚Bildungsseite’ in den Niederlanden und den USA zusammen gebracht werden, um gesellschaftliche Gruppen zu erreichen, die auf eine emotionale Art der Informationsvermittlung ansprechen. Es wird diskutiert, was diese Modelle für die Entwicklung und Umsetzung von Entertainment-Education in Deutschland bedeuten könnten.
Literatur
Beck, Vicki (2004). Working with daytime and primetime television shows in the United States to promote health. In: Singhal, Arvind/Cody, Michael J./Rogers, Everett/Sabido, Miguel (Hrsg.), Entertainment-Education and Social Change: History, Research, and Practice. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum and Associates Publishers, S. 207-224.
Bouman, Martine (1999). The turtle and the peacock. Collaboration for prosocial change. Wageningen, The Netherlands: Wageningen Agricultural University.
Bouman, Martine, (2005). Sex and Soaps: Entertainment-Education in niederländischen TV-Serien. Televizion, 18(1).
Kaiser Family Foundation (2008). Television as health educator. A case study of Grey’s Anatomy. Menlo Park, CA: Kaiser Family Foundation.
Lubjuhn, Sarah/Liedtke, Christa (2008). Eine Grounded-Theory-Studie zu personalen Typen, die Botschaften zum nachhaltigen Konsum vermitteln. Forum Qualitative Sozialforschung (im Reviewprozess).
Petty, Richard E./Cacioppo, John T. (1986). The elaboration likelihood model of persuasion. Advances in Experimental Psychology, 19, S. 123-205.
Singhal, Arvind/Rogers, Everett (1999). Entertainment-Education. A communication strategy for social change. Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates.
Beitrag aus Heft »2009/04: Informationelle Selbstbestimmung?!«
Autor: Sarah Lubjuhn, Martine Bouman
Beitrag als PDFEinzelansichtElisabeth Jäcklein-Kreis: What you see is what I say!?
„Mein Haus, meine Auto, mein Boot“ klingt die Fernsehwerbung in unseren Ohren nach. „Liebes Tagebuch ...“ schrieben neben Anne Frank wohl ungezählte Hände in ungezählte Hefte. „das bin dann mal ich, damit ihr bescheid wisst...“ (sic!) schreibt scotishgirl911 als Einleitung zu ihrem YouTube-Video. Ein Online-Video zur Selbstdarstellung? Dasallgegenwärtige Web 2.0 scheint sich nun auch den Lebensbereich Identitätsarbeit erschlossen zu haben. Die folgende Untersuchung geht diesem Phänomen im Rahmen eines medienpraktischen Projekts auf den Grund.
Literatur
Alby, Tom (2008). Web 2.0. Konzepte, Anwendungen, Technologien. 3., aktualisierte Auflage. München: Hanser Verlag.
Döring, Nicola (2003). Sozialpsychologie des Internet. Die Bedeutung des Internet für Kommunikationsprozesse, Identitäten, soziale Beziehungen und Gruppen. 2. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Göttingen: Hogrefe.
Erikson, Erik (1991). Identität und Lebenszyklus. Frankfurt/M.: Suhrkamp.Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) (2007). JIM-Studie 2007. Jugend, Information, (Multi-)Media. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland. Stuttgart. www.mpfs.de/index.php?id=110 [Zugriff: 20.08.2008]
Mikos, Lothar/Hoffmann, Dagmar/Winter, Rainer (Hrsg.) (2006). Mediennutzung, Identität und Identifikation. Die Sozialisationsrelevanz der Medien im Selbstfindungsprozess von Jugendlichen. Weinheim: Juventa Verlag.
Oerter, Rolf/Dreher, Eva (2002). Identität: das zentrale Thema des Jugendalters. In: Oerter, Rolf/Montada, Leo (Hrsg.), Entwicklungspsychologie. Weinheim: Beltz Verlag.
Beitrag aus Heft »2009/04: Informationelle Selbstbestimmung?!«
Autor: Elisabeth Jäcklein-Kreis
Beitrag als PDFEinzelansichtJan Keilhauer: Themenzentrierte Medienarbeit
Themenzentrierte Medienarbeit unterstützt Jugendliche dabei, Medien als Mittel zur analytisch-reflexiven Durchdringung eines gesellschaftlich relevanten Themas, zur Erarbeitung und medialen Artikulation eigener Sichtweisen und Positionen sowie zur Partizipation an gesellschaftlichen Diskursen einzusetzen. Ausgehend vom Potenzial themenzentrierter Medienarbeit werden praktische methodische Erfahrungen am Beispiel eines Modellprojektes mit Jugendlichen zur Thematik der Präimplantationsdiagnostik vorgestellt.
Literatur
Anfang, Günther/Bloech, Michael/Hültner, Robert (2006). Vom Plot zur Premiere. München: kopaed.
Reinhardt, Sibylle (2005). Politik-Didaktik. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor.
Schell, Fred (2003). Aktive Medienarbeit mit Jugendlichen. Theorie und Praxis. München: kopaed.Schell, Fred/Schorb, Bernd (1987). Medien zum Ermitteln,Erforschen und Darstellen. Der Stellenwert aktiver Medienarbeit im pädagogischen Prozess. In: merz 5/1987, S. 285-292.
Schorb, Bernd (2005). Medienkompetenz. In: Hüther,Jürgen/Schorb, Bernd (Hrsg.), Grundbegriffe Medienpädagogik. München: kopaed, S. 257-262.
Schorb, Bernd/von Holten, Susanne/Würfel, Maren/Keilhauer, Jan (2006). Modelle & pädagogische Hinweise für themenzentrierte aktive Medienarbeit zum Thema Gentests. www.gen-diskussion.de [Zugriff: 23.06.2009]
Schorb, Bernd/Keilhauer, Jan (in Bearbeitung). Themenzentrierte Medienarbeit mit Jugendlichen. Ein Modellprojekt mit deutschen und tschechischen Jugendlichen zum Thema Präimplantationsdiagnostik. München: kopaed.
Beitrag aus Heft »2009/04: Informationelle Selbstbestimmung?!«
Autor: Jan Keilhauer
Beitrag als PDFEinzelansichtBirgit Weichenrieder und Michael Bloech: Alles unter Kontrolle
Zur Bewährung hinter die Kamera – diese Idee wurde in jüngster Zeit gleich zweimal umgesetzt. Straffällig gewordene Jugendliche wurden dazu ‚verurteilt‘, sich mittels aktiver Medienarbeit mit ihren Vergehen auseinander zu setzen und diese in eigenen Filmen aufzuarbeiten. Dabei waren die Jugendlichen in der Umsetzung völlig frei, wurden aber von medienpädagogischer, juristischer und psychologischer Seite unterstützt – und verzeichneten überaus positive Ergebnisse.
Beitrag aus Heft »2009/04: Informationelle Selbstbestimmung?!«
Autor: Birgit Weichenrieder, Michael Bloech
Beitrag als PDFEinzelansichtChristine W. Wijnen: Gras drüber?
Gras drüber? ist der Titel eines Filmprojekt mit österreichischen Schülerinnenund Schülern im Alter von 17 bis 18 Jahren. Im Zuge dieses Projekts setzten sich die Heranwachsenden mit der dunklen Geschichte ihres Heimatorts während der NS-Zeit auseinander.
Literatur
Barthelmes, Jürgen/Sander, Ekkehard (2001). Erst die Freunde, dann die Medien. Medien als Begleiter in Pubertät und Adoleszenz. Medienerfahrungen von Jugendlichen. Band 2. München: DJI-Verlag.
Schmidt, Jan (2008). Was ist neu am Social Web? Soziologische und kommunikationswissenschaftliche Grundlagen. In: Zerfaß, Ansgar/Welker, Martin/Schmidt, Jan (Hrsg.),Kommunikation und Wirkungen im Social Web. Grundlagen und Methoden: Von der Gesellschaft zum Individuum (Band 1). Köln: Herbert von Halem. S. 18-40.
Stadler, Robert/Mooslechner, Michael (1986). St. Johann/Pg. 1938-1945. Das Nationalsozialistische `Markt Pongau`. Der `2. Juli 1944` in Goldegg: Widerstand und Verfolgung. Eigenverlag.
Weiß, Ralph (2000). „Praktischer Sinn“, soziale Identität und Fern-Sehen. Ein Konzept für die Analyse der Einbettung kulturellen Handelns in die Alltagswelt. In: M&K 1/2000 (48). S. 42-62.
Wijnen, Christine W./Seibt, Martin (2008). „Selber eineigenes Werk schaffen…“. Medienarbeit mit MigrantInnen. In: Akzente Salzburg (Hsrg.), Impulse. Handbuch für Jugendarbeit. Migration, Integration und interkultureller Dialog. Salzburg: Akzente Verlag. S. 66-70.
Beitrag aus Heft »2009/04: Informationelle Selbstbestimmung?!«
Autor: Christine W. Wijnen
Beitrag als PDFEinzelansicht
medienreport
Elisabeth Jäcklein-Kreis: Große Politik ganz cool?!
Das ZDF ganz jung, MeinVZ ganz vernünftig und Politik ganz nah zum Anfassen. Was irgendwie klingt wie verkehrte Welt ist tatsächlich ein aktuelles Projekt von ZDF und MeinVZ: Politik für alle im Open Reichstag. Ganz im Sinne eines „offenen Parlaments“ und einer „offenen Gesellschaft“, wie das ZDF verlauten ließ – und zudem wohl ganz im geistigen Erbe des amerikanischen Wahlkampfes – lädt das Projekt auf seiner YouTube-Seite www.youtube.com/openreichstag Wählerinnen und Wähler sowie Politikerinnen und Politiker ein, sich online über Wahl und Qual, über große Politik und kleine Sorgen und auch sonst über alles, was man mit mehr oder weniger Mühe mit der Bundestagswahl in Zusammenhang bringen kann, auszutauschen.
Ankermann des Online-Wahlspektakels ist Ex-MTV-Moderator Markus Kavka, der im schicken Anzug versucht, den Spagat zwischen seriösem Politik-Berichterstatter und jugendlichem Zielgruppen-Fischer zu meistern. Der präsentiert den Wahlkampf hier in vier Etappen: In Phase eins drehte sich von 7. Juni bis 19. Juli beim Open Reichstag alles um die „Sonntagsfrage“: Politikerinnen und Politiker verschiedener Parteien stellten jede Woche eine Frage zu einem politischen Thema, die die Wählerinnen und Wähler dann per Videobotschaft beantworten und natürlich möglichst engagiert diskutieren sollten. Ausgewählte Antwort-Videos wurden zusätzlich im ZDF-Programm gezeigt. Ab 19. Juli startete das Projekt in die zweite, die „Deine Meinung“-Phase. Diesmal lösen prominente Partner die Politiker beim Themen-Stellen ab, die Nutzerinnen und Nutzer sind wie gehabt fürs Diskutieren zuständig. Bis 9. August müssen sie damit aber fertig sein, dann nämlich ist die Diskussionsrunde beendet, rien ne va plus. Jetzt werden im Open Reichstag noch einmal die wichtigsten Themen und Meinungen zusammengefasst präsentiert, damit sich auch all diejenigen für ein Kreuzchen entscheiden können, die vorher beim Diskutieren nicht zum Nachdenken gekommen sind.
Ab 16. September schließlich fragt der Open Reichstag: „Debatte, was nun?“ Während und nach der Wahl soll dann aktuell berichtet werden, mögliche Koalitionen werden vorgestellt und immer die neuesten Entwicklungen berichtet. Zusätzlich zeigt die Seite während des ganzen Projektes Beiträge aus ZDF-Sendungen zu aktuellen politischen Themen. Hintergrundinfos zu Politikerinnen und Politikern und ihren Parteien steuert das MeinVZ auf verlinkten Seiten bei. Die Überraschung des Jahres ist diese ‚Wahl 2.0’ eher nicht – nachdem schon im vergangenen Jahr der werdende US-Präsident Barrack Obama schier allgegenwärtig durch das Web geisterte. Und schließlich, betrachtet man die Beteiligung gerade der jungen Wählerinnen und Wähler bei der zurückliegenden Europawahl im – zugegebenermaßen nicht ganz fairen – Vergleich zu ihrer Beteiligung an diversen Social Communitys und Plattformen online, so drängt sich der Verdacht auf, dass das Internet irgendetwas hat, was die Politik nicht hat. Warum also nicht das eine mit dem anderen verknüpfen? Politik + Web 2.0 = begeisterte Jungwählerscharen bei der Bundestagswahl. So oder so ähnlich rechnet bzw. hofft wohl das ZDF. Und die Nutzerinnen und Nutzer rechnen mit. Sie klicken sich zwar nicht invasionsgleich, aber doch recht fleißig in den Open Reichstag und hinterlassen dort ihre Kommentare, Meinungen und Videobotschaften unterschiedlichster – politischer, inhaltlicher und qualitativer – Couleur. Natürlich ist der Versuch, den Wahlkampf in den neuen Medien schmackhaft zu machen, für die Organisatoren ein neuer und so wackeln sie teilweise doch etwas unbeholfen in Kinderschuhen durch ihr Projekt. Markus Kavka scheint nicht ganz genau zu wissen, wieviel Gramm Musiksender-Coolness und wieviel Gramm Heute-Themen-Seriosität den perfekten Web 2.0-Wahl-Teig geben und auch das jugendliche Handschrift-Design der Seite wirkt unecht, wenn der angestrengt jung gelayoutete Text seine Leserinnen und Leser inhaltlich siezt. Das merken auch die Besucherinnen und Besucher der Seite und kritisieren in den – leider am Rand etwas schmal geratenen und nicht thematisch sortierten – „Channel Comments“ abwechselnd das formelle Siezen und das „Fingerfarben-Design“, den denglischen Namen und den negativ belegten Begriff „Reichstag“, die Linken und die Rechten, das ganze Projekt und seine Kritiker. Überhaupt finden sich durchdachte und engagierte politische Aussagen hier neben stumpfen Parolen, Spaßbeiträge neben tiefsinnigen Gedanken – und auch, wenn nicht alle Beiträge wirklich sendetauglich sind, so zeigt das Kaleidoskop der Meinungen doch, dass offenbar ein buntes Grüppchen an unterschiedlichsten Besucherinnen und Besuchern seinen Weg auf die Seite findet. Ob ein genauso buntes und großes Grüppchen auch wieder seinen Weg von der Seite weg in die Wahllokale findet, bleibt abzuwarten und zu hoffen.
Beitrag aus Heft »2009/04: Informationelle Selbstbestimmung?!«
Autor: Elisabeth Jäcklein-Kreis
Beitrag als PDFEinzelansichtTilmann P. Gangloff: Wege zum Ruhm
„Man braucht zwanzig Jahre, um über Nacht zum Star zu werden“, heißt es im Showbusiness. Das gilt allerdings nur für die geregelte Karriere. Seit einigen Jahren bietet das Fernsehen mit den Casting-Shows eine höchst reizvolle Abkürzung. Die kürzlich zu Germany’s Next Topmodel“ gekürte Sara Nuru aus Erding bei München oder der aktuelle „Superstar“ Daniel Schuhmacher aus Pfullendorf am Bodensee brauchten nur wenige Wochen, um berühmt zu werden. Wie lange ihr Ruhm anhält, ist eine ganz andere Frage. Tatsache ist jedenfalls: Sie haben es geschafft, ihre Fans ein ganzes Frühjahr lang in Atem zu halten. Gerade unter jungen Zuschauerinnen und Zuschauern gehört es quasi zum guten Ton, über die jüngsten Entwicklungen bei Deutschland sucht den Superstar (DSDS, RTL) oder dem Topmodel-Casting (ProSieben) informiert zu sein.
Genau dies ist laut Bernd Schorb, Professor für Medienpädagogik am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig und Vorstandsvorsitzender des JFF – Instituts für Medienpädagogik in Forschung und Praxis, der entscheidende Grund für die imposanten Zuschauerzahlen: „Man muss die Sendungen gesehen haben, um in seiner ‚Peergroup’, im gleichaltrigen Freundeskreis also, mitreden zu können.“ Junge Frauen nutzen Germany’s Next Topmodel seiner Meinung nach aber auch, um eine Identität aufzubauen: „Aussehen und Wirkung auf andere haben in diesem Alter eine große Bedeutung. In den Shows werden Entwürfe angeboten, mit denen man sich ohne jedes Risiko identifizieren oder die man ablehnen kann.“ Gewissermaßen Expertin für dieses von Medienpsychologen „parasoziale Interaktion“ genannte Phänomen ist Maya Götz, Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) München. Ihre Forschungen befassen sich seit vielen Jahren mit den Fernsehvorlieben von Kindern und Jugendlichen. Bislang suchten sich gerade weibliche Teenager ihre Vorbilder vor allem in sogenannten Daily Soaps wie Gute Zeiten, schlechte Zeiten (RTL). Die Castingshows haben den täglichen Serien etwas den Rang abgelaufen.
Für Götz hängt das vor allem mit dem Wertewandel der Zielgruppe zusammen: „Vor zehn oder zwanzig Jahren wären diese Sendungen längst nicht so erfolgreich gewesen wie heute. Seither sind die sozialen Ängste der Jugendlichen enorm gewachsen. Ihre Perspektiven sind ungewiss; sie müssen damit rechnen, dass sie den sozialen Status ihrer Eltern wahrscheinlich nicht erreichen werden.“ Tatsächlich sind die Unterschiede etwa zu den Achtzigern enorm. Ein gewisser Markus Mörl hat das Lebensgefühl jener Jahre durch seinen Schlager Gib Gas, ich will Spaß auf den Punkt gebracht. Mit ihrer Leistungsorientierung führen heutige Jugendliche ein deutlich konservativeres Dasein. Und da dieses Leistungsprinzip auch die Castingshows dominiert, dienen sie dem jungen Publikum quasi als Schule fürs Leben. Maya Götz hat allerdings festgestellt, dass die deutschen Formate im Gegensatz etwa zu den britischen oder amerikanischen Versionen extrem auf die zentralen Figuren Heidi Klum und Dieter Bohlen zugeschnitten sind: „Beide werden wie Meisterin und Meister präsentiert, was die Teilnehmer und damit auch die jungen Zuschauer automatisch zu Lehrlingen degradiert.“ Die Inszenierung gerade von DSDS unterstütze diesen Eindruck: „Auf diese Weise wird überzeugend nahegelegt, dass es gar keine Alternative zu den Deutungsmustern von Bohlen geben kann.“ Gerade Bohlen sorgt mit seinen verächtlichen Äußerungen zudem immer wieder für Empörung. Bernd Schorb hält dieses Verhalten des Musikproduzenten und früheren Popstars für höchst problematisch.
Der Pädagoge fürchtet, Bohlens Beleidigungen könnten zu einer „Entgrenzung“ führen: „In einer ohnehin verunsicherten Lebensphase fragen sich Jugendliche, denen es auf dem Schulhof ähnlich ergeht wie Bohlens Opfern, ob sie sich überhaupt gegen diese Erniedrigungen wehren dürfen, schließlich scheint so ein Verhalten ja ganz normal zu sein, wenn es im Fernsehen vorgemacht wird.“ Jan-Uwe Rogge, einer der bekanntesten Erziehungsberater des Landes, hat allerdings „kein Verständnis für die Arroganz und Besserwisserei mancher Erwachsenen, die vor Jahrzehnten selber ‚Bravo’-Poster in ihren Zimmern aufgehängt und von einer Karriere als Popstar oder Mannequin geträumt haben.“ Rogge attestiert den Castingshows nicht nur handwerkliche Professionalität: „Sie gehen sehr konsequent auf latente Bedürfnisse und Sehnsüchte der Pubertierende ein.“ Natürlich würden die Teilnehmenden „mehr oder minder vorgeführt, aber genau das ist ja Teil der Inszenierung: Die Zuschauerinnen und Zuschauer fiebern, ja leiden mit ihnen. Sie sind Identifikationsobjekte, in die man eigene heimliche Wünsche legen kann.“ Irgendwann sei diese Zeit dann vorbei; wie sich ja auch heutige Eltern an einem bestimmten Punkt ihrer Entwicklung endgültig von ihrer Bravo-Phase verabschiedet hätten.
Beitrag aus Heft »2009/04: Informationelle Selbstbestimmung?!«
Autor: Tilmann P. Gangloff
Beitrag als PDFEinzelansichtDorothee Klemm: HOME
Rauchende Vulkane, glitzernde Eisberge in tiefblauem Polarmeer, türkisfarbene Korallenriffe, goldgelbe Felder und sattgrüne Wiesen, wandernde Tierfamilien und gigantische Wasserfälle – beeindruckende Bilder circa 90 Minuten lang aneinander gereiht, untermalt von rührseliger Musik. Der Flug über die Erde im Dokumentarfilm HOME zeigt Mutter Natur in ihrer ganzen Vielfalt und Einzigartigkeit, in einem Gleichgewicht, in dem sie sich vier Milliarden Jahre befunden hat – bevor der Mensch auf die Erde kam. Die Aufnahmen sind durchwegs aus der Vogelperspektive gefilmt, das Charakteristikum des eigentlichen Fotografen Yann Arthus-Bertrand, um die Schönheit unseres ‚Zuhauses’ noch bewusster hervorzuheben. Im Kontrast zu den ergreifenden Naturbildern stehen Aufnahmen, die die Verletzlichkeit des Planeten offenbaren, so wie ihn der Homo Sapiens, der „weise, vernunftbehaftete“ Mensch in den letzten 200.000 Jahren seines Daseins verändert und aus der Balance gebracht hat: brennende Wälder, smogverhangene Megacitys, verstopfte Straßen, überdimensionale Müllberge, Erdölraffinerien, schmelzende Eisberge. Jedoch mitunter aus der Luft so in Szene gesetzt, dass sich manch schillerndes Farbenspiel erst bei längerem Hinsehen und gezoomt als abstoßender Ölfilm oder anderweitige Umweltverschmutzung entpuppt. Erschreckend-schön ...
Kalt lässt es wohl auch niemanden, wenn man hinter den dunklen Schwaden einer Luftaufnahme nach ein paar Sekunden Hungernde erkennt, die in dampfenden Mülldeponien Essbares oder anderes Verwertbares suchen. Arthus-Bertrand spielt fast 80 Minuten lang mit diesen Gegensätzen. Die bestechende Schönheit und die Zerbrechlichkeit unseres Planeten auf der einen Seite und andererseits das, was der Mensch seinem Zuhause durch sein unüberlegtes Handeln, seiner Gier nach Luxus und Wohlstand bisher angetan hat. Der Fotograf lässt atemberaubende Bilder in seinem Flug über die Erde sprechen, um das Publikum in seinen Bann zu ziehen und aufzurütteln. Des Öfteren mag man fast an der Echtheit der Aufnahmen zweifeln, so unnatürlich schön sind sie. Doch manchmal wäre es sicherlich besser gewesen, die Aufnahmen kommentarlos für sich stehen und wirken zu lassen. Aber dies ist den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht vergönnt. Der eindringliche Tonfall der englischen Kommentatorin (Glenn Close) in der Internetfassung mit dem Tenor, der ach so weise Homo Sapiens sei durch seine unvernünftige Lebensweise schuld an der ganzen Misere, erzeugt auf Dauer bei manchen Beobachterinnen und Beobachtern vermutlich den Eindruck einer 90-minütigen Moralpredigt.
In der deutschen Fernsehfassung ist dies besser gelungen, da der Sprecher in einem weniger emotional überladenen Ton – wie es für Dokumentarfilme üblich ist – die Reise über 53 Länder der Erde neutraler kommentiert. Schuldbewusstsein ruft dennoch auch die deutsche Fassung hervor. Zusammen mit der bewusst eingesetzten schwülstigen Musik ergibt sich aber in beiden Versionen vor allem gegen Ende des Films ein starkes Abgleiten in die Pathetik, wenn beispielsweise zu den Klängen Vivaldis „Cum Dederit“ (Psalm 126) in weißen Lettern auf schwarzem Hintergrund die Fakten des momentanen Zustands der Erde aufgelistet werden. Mit erhobenem Zeigefinger wird dem Publikum immer wieder vor Augen geführt, dass es als Verursacher der Misere nur noch zehn Jahre Zeit hat, die von ihm angestiftete Apokalypse zu verhindern. Doch konstruktive Vorschläge, wie fortschreitender Klimawandel und Umweltzerstörung aufzuhalten sind, fehlen bis zu diesem Zeitpunkt des Films völlig. Der Mensch wird aufgefordert, sich zu ändern, aber wie er dies tun soll, bleibt ihm vorenthalten. Seinen theatralischen Höhepunkt erreicht der Film in den letzten zehn Minuten, wenn der Kommentator in die Rolle des Fotografen schlüpft. Er berichtet von Flüchtlingslagern und Mauern, die er gesehen hat, von der größer werdenden Kluft zwischen Arm und Reich. Aber noch gäbe es Hoffnung, das Schicksal abzuwenden, denn jeder Mensch könne einen Beitrag leisten. Der filmprägende Satz, „Es ist zu spät, um Pessimist zu sein!“ wird besonders in dem Teil des Filmes ermüdend oft erwähnt, in dem Arthus-Bertrand verheißungsvolle Maßnahmen aufzeigt, die Mensch und Natur in Einklang bringen sollen. Hier finden sich auch erstmals positive Beispiele: Die Verwendung erneuerbarer Energien, Nationalparks, Windräder, Seeschlangen und Solaranlagen geben ihm Anlass zur Hoffnung, zumindest in kleinen Schritten dem Untergang der Welt entgegenzutreten. „Wichtig ist nicht, was verloren ist, sondern was bleibt!“ Und so legt er das Schicksal der Zuschauerinnen und Zuschauer in deren eigene Hände und fordert sie auf, nicht länger tatenlos zuzusehen. Denn „wir schreiben die Fortsetzung unserer Geschichte – gemeinsam.“ So anmutig, ergreifend und beeindruckend die Bilder in der Dokumentation von Yann Arthus-Bertrand auch sind und so bedeutend die Thematik Umweltschutz ist, etwas weniger Pathos und gehobene Zeigefinger-Mentalität hätten dem Appell des Films „Rettet die Umwelt!“ und dessen Erfolg wohl keinen Abbruch getan. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, Home anzusehen. Schon alleine wegen der atemberaubenden Bilder, egal ob zu Hause im Fernsehen, im Internet oder im Kino, wo sie vermutlich am besten zur Geltung kommen.
Doch nicht nur für den privaten Gebrauch, gerade auch aus schulischer Sichtweise, zum Beispiel in den Fächern Erdkunde, Biologie oder Ethik, kann der Film – eventuell aufgrund der Länge gekürzt – einen wertvollen Beitrag zum Verantwortungsbewusstsein von Schülerinnen und Schülern gegenüber unserem Planeten leisten. Der Dokumentarfilm Home will aufrütteln, und zwar alle Menschen, egal ob alt oder jung. „Jeder Einzelne muss an dieser gemeinsamen Anstrengung teilnehmen; und um so viele Leute wie möglich darauf aufmerksam zu machen, habe ich den Film HOME gedreht.“, begründet Arthus-Bertrand den Film. Um dies zu erreichen ging er zusammen mit dem Regisseur Luc Besson (Das fünfte Element) einen Weg, der in der Mediengeschichte bisher einmalig ist. Der Film sollte in fast allen Medien weltweit zur gleichen Zeit erscheinen. Neben der normalen Ausstrahlung in einzelnen Kinos fand die Weltpremiere online auf dem Videoportal YouTube statt. Pünktlich um 0 Uhr am 05. Juni 2009, dem Welt-Umwelttag – ein passenderes Datum hätte man für die Veröffentlichung wohl nicht finden können – hatte „die Welt ein Date mit dem Planeten“: Da stand der Film in voller Länge für Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern in mehreren Sprachen, leider nur als Untertitel, zur Verfügung. Dieses Novum in der Filmgeschichte wurde nochmals dadurch verstärkt, dass am selben Tag zusätzlich die DVD erschien, eine eigene Internetpräsenz startete (www.home-2009.com), einige Fernsehsender den Dokumentarfilm in ihr Programm aufnahmen und in größeren Städten Public Viewing-Veranstaltungen Publikumsmassen anlockten. Hoffen wir, dass Arthus-Betrand mit seinen einzigartigen Bildern die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht zu sehr verzaubert, sondern wirklich aufrüttelt. Denn wie wir spätestens nach dem Film wissen, es ist zu spät, um Pessimist zu sein!
Home Frankreich 2009, ca. 90 Minuten (Internet-, DVD-, TV-Fassung)
Regie: Luc Besson, Yann Arthus-Bertrand
Verleih: Universal Pictures Germany
Beitrag aus Heft »2009/04: Informationelle Selbstbestimmung?!«
Autor: Dorothee Klemm
Beitrag als PDFEinzelansichtDorothee Klemm: Lagerfeuerromantik und Bauhausgezanke von Mitte bis Ende August
Ein Sommermorgen in der Großstadt. Thomas (Milan Peschel) wacht auf, dreht die Anlage auf und tanzt ausgelassen durch die Wohnung, während seine Freundin Hanna (Marie Bäumer) wohl eher zum Typ ‚Morgenmuffel‘ gehört und ihm stumm, aber liebevoll die Zahnbürste reicht. Kleine Gesten und Rituale, die die Liebe und Zärtlichkeit des glücklichen Pärchens wortlos aber deutlich zeigen. Ihr Glück scheint perfekt: Mitte Ende August scheint die Geschichte zweier junger Menschen, die sich trotz oder wegen ihrer Gegensätze lieben und deren Romantik nichts stören kann. Um der sommerlichen Großstadthitze zu entfliehen und das gemeinsame Glück noch zu steigern und ungestört zu genießen, kaufen die Mittdreißiger ein Landhaus in aller Abgeschiedenheit. Das Haus stellt sich als heruntergekommen und renovierungsbedürftig heraus. Doch Hanna und Thomas freuen sich auf die Aufgabe, auch wenn sie bald feststellen müssen, dass neben Lagerfeuerromantik, Harmonie im Kerzenschein und Federball spielen in der Natur ihre Fähigkeiten in Sachen Renovierung stark begrenzt sind. Manch ein Besuch im kilometerweit entfernten Baumarkt stellt auch eine Bewährungsprobe für die Beziehung dar. Die anfänglich nur zu erahnenden Gegensätze formieren sich in mancher Baumarkt-Szene zu deutlichen Meinungsverschiedenheiten, in denen Hanna meist schweigend nachgibt („Schön, dass du (!) glücklich bist!“). So auch bei Thomas‘ Vorhaben, eine tragende Wand einzureißen, ohne sich über mögliche Konsequenzen Gedanken zu machen. Mit einem Vorschlaghammer macht er sich an die Arbeit, die Wand – und damit vielleicht auch seine Beziehung – zum Einsturz zu bringen. Die Zweisamkeit der Verliebten wird immens gestört, als Friedrich (André Hennicke), Thomas‘ älterer Bruder telefonisch um Asyl bittet und Thomas ihn ohne zu zögern einlädt, nachdem dieser von Frau, Kind und Architektenjob verlassen wurde. Nach einer handfesten Diskussion – schließlich hatte sich das Paar einsame Tage versprochen – besinnt sich die wütende Hanna jedoch auf das architektonische Können ihres Schwagers und lässt sich umstimmen, nicht ohne dann selbst für einen weiteren Gast zu sorgen.
Sie lädt ihre junge, quirlige Patentochter Augustine (Anna Brüggemann) ein, die mittlerweile doch schon sehr erwachsen ist. So wird aus der trauten Zweisamkeit erst ein Trio, dann ein Quartett voller Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Die ersten Tage laufen harmonisch: Man lacht viel, scherzt, schwimmt im See, genießt die Abende weinselig im Kerzenschein und kocht gemeinsam. Auch die Renovierungsarbeiten gehen durch Friedrichs Pläne gut voran und es scheint möglich, das Haus an Hannas nahendem Geburtstag gebührend zu feiern. Trotz der Harmonie und Ausgelassenheit entgeht es aber wohl niemandem, dass sich die Beziehungen verschieben. So finden sich immer mehr Gemeinsamkeiten zwischen Augustine und Thomas, der bei ihr endlich das Kind im Manne herauslassen und seiner Liebe zu McDonald’s nachgehen kann und wie ein Teenager, an manchen Stellen fast schon peinlich, um die Gunst der jungen, scheinbar Unschuldigen buhlt. Die reife Hanna dagegen fühlt sich bei Friedrich aufgehoben, der mit seiner ruhigen und ernsten Art ihren nachdenklichen und erwachsenen Zügen entspricht. Und so kommt es, wie es kommen muss und wie es wohl alle Kinobesucherinnen und -besucher schon geahnt haben. Die Spannungen zwischen Hanna und Thomas werden größer, man sucht die Nähe der anderen und flieht zu ihnen – zunächst in Gedanken, später im Rausch der Gefühle und Joints auch in Wirklichkeit. Es kommt zum Eklat und letztendlich stehen Thomas und Hanna wieder alleine vor ihrem Haus. Das Haus renoviert – ihre Beziehung in Trümmern. Doch vielleicht müssten auch sie in ihrer Beziehung nur wieder eingerissene Wände neu aufbauen?
Wer sich bei der einstigen Idylle auf dem Lande, der Viererkonstellation, den Renovierungsarbeiten und dem Beziehungswirrwarr von Mitte Ende August an Goethes Werk Die Wahlverwandtschaften erinnert, hat im Deutschunterricht gut aufgepasst. Denn der Regisseur des F ilmes, Sebastian Schipper, hat sich den Klassiker als Grundmauer seines Filmes hergenommen, um darauf seine eigene, leichte und lockere Adaption aufzubauen. Schippers Film, der am 30. Juli in die Kinos kommt, wirkt weniger durch gesprochene Worte, denn gerade die langen Dialoge wirken oft gestelzt und sperrig. Was den Film ausmacht, sind die kleinen Gesten und Mimiken der Darstellerinnen und Darsteller, Momentaufnahmen von Natur und Protagonisten. Man erfährt nicht viel über sie und kann manch unverständliches Verhalten nur aus bedeutungsvollen Blicken erklären. Auch die eigens für den Film komponierten Gitarrenklänge des US-amerikanischen Sängers und Komponisten Vic Chesnutt tragen einiges dazu bei, den schwelenden Konf likt zwischen den Akteuren ohne große Worte eindringlich anzukündigen. Wer sich ein tiefgehendes Drama von Mitte Ende August erwartet und hofft, pedantische Vergleiche zwischen dem Film und Goethes Wahlverwandtschaften ziehen zu können, wird wohl enttäuscht werden. Doch wer sich von der Einmannshow Peschels mitreißen lässt und sich einlässt auf ein leichtes Sommerdrama, das in den kleinen und stillen Momenten überzeugt, der wird sich in mancher Baumarktszene wiedererkennen, leise schmunzeln und bestätigen, dass es ganz schön kompliziert ist, eine Beziehung am Leben zu erhalten.
Mitte Ende August
Deutschland, 2009, 93 Minuten
Regie: Sebastian SchipperDarsteller: Marie Bäumer, Milan Peschel, Anna Brüggemann, André Hennicke, Gert Voss, Agnese Zeltina
Produktion: Film 1 GmbH + Co. Berlin
Beitrag aus Heft »2009/04: Informationelle Selbstbestimmung?!«
Autor: Dorothee Klemm
Beitrag als PDFEinzelansichtElisabeth Jäcklein-Kreis: Mit Brainmonster zum Weltenretter und Mathekönig
Das Land Trillion ist mit einem Bann belegt! Überall hat der böse Magier Godron Unheil und Chaos gestiftet und jeder mutige Held, der es beseitigen will, wird mit kniffligen Aufgaben traktiert, die es zu lösen gilt. Da reicht kein weißes Ross und kein scharfes Schwert, um den schlauen Zauberer zu besiegen – ein Held mit hellem Köpfchen muss her, um Trillion zu retten. Einer wie Bernard oder Celestine, oder der freche Drache 2weistein.Natürlich ist Trillion kein echtes Land auf dem Planeten Erde, sondern eine virtuelle Welt: 2weistein – das Geheimnis des roten Drachen heißt das Spiel, in dem sich alles um Godrons finstere Pläne dreht. Es kommt aus dem Hause Brainmonster, geistert seit 2008 durch die Computerspielewelt und hat dort auch schon abenteuerliche Fußstapfen hinterlassen: Das österreichische Spiele-Magazin GAMINGXP etwa kürte es zum „Kinderspiel des Jahres 2008“, bei TOMMI, dem deutschen Kindersoftwarepreis, rätselten und kniffelten sich 2weistein und Co. auf Platz zwei und der Pädagogische Interaktivpreis Pädi sowie die Österreichische Bundesstelle für die Positivprädikatisierung von Computer- und Konsolenspielen BuPP versahen das Adventuregame auch gleich noch mit ihren Gütesiegeln. Doch 2weistein hat noch mehr zu bieten als ein paar protzige Siegel auf der Verpackung. Wer Bernard und Celestine aus ihrer CD-Hülle befreit und in Trillion laufen lässt, begibt sich damit tatsächlich mitten in ein aufregendes Abenteuer.Immer neue Orte mit spannenden Aufgaben warten auf unerschrockene Spielerinnen und Spieler, die die Welt hüpfend und rennend erkunden und furchtlos retten. Manchmal müssen nur Kürbisse eingesammelt, manchmal auch harte Kämpfe mit den Gegnern ausgefochten werden – und natürlich muss immer wieder gerechnet, geknobelt, gezählt und kombiniert werden, um ans Ziel zu kommen und beispielsweise von Geisterhand verschlossene Türen wieder zu öffnen. Dabei ist von einfachen Zählaufgaben über Addition und Subtraktion bis zu verzwickten Knobelrätseln die ganze mathematische Palette dabei, die Grundschulkinder können könnten oder sollten. Nicht umsonst sind die Aufgaben in 2weistein an den Grundschullehrplan angepasst und eignen sich deshalb gut, um ganz nebenbei und fast unbemerkt auch noch in der Schule zum Mathekönig bzw. zur Mathekönigin zu werden.
Großer Pluspunkt ist hier auch die Möglichkeit, verschiedene Schwierigkeitsstufen zu spielen, so dass schon Siebenjährige Erfolgserlebnisse einfahren können und trotzdem auch Zehnjährige das Spiel nicht gelangweilt zu den Bibi Blocksberg-Kassetten schieben. Doch mathematische Aufgaben allein, mögen sie noch so viele Schwierigkeitsstufen haben, begeistern vermutlich bestenfalls Eltern und Pädagoginnen bzw. Pädagogen – die jungen Spielerinnen und Spieler selbst legen wohl andere Kriterien an ein Spiel. Bei Brainmonster scheint man das zu wissen: Trotz hoher pädagogischer Ansprüche kommt 2weistein nicht als halbherzig auf ‚cool’ getrimmtes Lernprogramm daher, sondern bietet sozusagen Spiel, Spaß und Spannung in einem. Trillion ist eine sinnvoll und ansprechend gestaltete Welt, in der es wirklich etwas zu entdecken und erleben gibt und in der man gerne unterwegs ist. Die Figuren sind kindgerecht und liebevoll gemacht und bieten dem Nutzer bzw. der Nutzerin an Tastatur oder eigens gestaltetem und (gegen Aufpreis) mitgeliefertem Gamepad viele Möglichkeiten zur Bedienung, statt stur von einer Aufgabe zur nächsten zu laufen. Die einzelnen Spiele werden verständlich erklärt, die Bedienung erschließt sich intuitiv und muss höchsten den jüngsten Abenteurerinnen und Abenteurern erklärt werden.
Für gelöste Aufgaben schließlich gibt es Lob und Anerkennung. Auch die Aufgaben selbst präsentieren sich nicht wie ungeliebte Mathe-Schulaufgaben sondern noch als kleine Spiele, in denen man beispielsweise auf richtige Lösungen springen oder Truhenschlösser knacken muss. Ein richtig spannendes Adventure mit Freizeitwert und Lerneffekt in einem also, das Kinder, Eltern und Lehrkräfte glücklich macht – und am Rande bemerkt bietet das Spiel sozusagen als Schmankerl sogar noch eine Optimierung für PC und Mac. Scheinbar eine wahrhaftige eierlegende Wollmilchsau unter den Computerspielen, die Brainmonster da für 39,99 €, mit Gamepad für 49,99 € anbietet. Obendrein schickt Brainmonster für alle Eltern, die nicht nur kluge Spiele kaufen, sondern selbst auch noch etwas lernen wollen, in der ausführlicheren „Trainigsversion“ des Spieles für 98 € nicht nur ein paar zusätzliche Levels sondern auch noch ein „Fachbuch“ mit, in dem theoretische und pädagogische Hintergründe zum Spiel, Wissen über Lerntheorien, aber auch AD(H)S und Dyskalkulie angeboten werden. Da bleiben keine Fragen, Wünsche und Matheschwächen offen.
Beitrag aus Heft »2009/04: Informationelle Selbstbestimmung?!«
Autor: Elisabeth Jäcklein-Kreis
Beitrag als PDFEinzelansicht
publikationen
Robertz, Frank J./Wickenhäuser, Ruben (2007). Der Riss in der Tafel. Amoklauf und schwere Gewalt in der Schule. Heidelberg: Springer Medizin Verlag. 185 S., 29,95 €
Columbine, Erfurt, Red Lake, zuletzt Emsdetten – diese Orte wurden zum Inbegriff für sogenannte ‚School Shootings’: Amokläufe und schwerste Gewalttaten durch Jugendliche in USA und Deutschland, wobei bewusst Schulen als Tötungsorte ausgesucht wurden. Scheinbar können sie überall, an jeder Schule und zu jeder Zeit, stattfinden. In Columbine hatten an einem Tag des Jahres 1999 zwei Jugendliche 13 Menschen getötet und 24 weitere verletzt. Im Folgejahr begingen die Mutter eines Opfers und ein Schüler Selbstmord; zahlreiche Menschen wurden schwer traumatisiert. Unzählige Nachahmungstaten wurden seither weltweit angedroht, etliche – wie wir schmerzvoll erfahren mussten – auch umgesetzt. Das vorliegende Buch appelliert auf 185 Seiten eindringlich an Lehrer, Eltern, Schulpsychologen, Sozialarbeiter und nicht zuletzt an die Politik, die Gefahr für weitere ‚School Shootings’ ernst zu nehmen und rechtzeitig präventive Maßnahmen zu ergreifen. Dafür liefert es umfassende Orientierung und Hilfestellungen. So werden im ersten Kapitel die Merkmale und Besonderheiten dieser schweren Gewalttaten beleuchtet, um einen Weg zu einer tieferen Betrachtung der Ursachenkomplexe und Beweggründe zu bahnen, als ihn Medienberichte leisten.
Auch Daten der Häufigkeit, Verteilung und internationalen Tragweite von ‚School Shootings’ zwischen 1977 und 2007, besonders ab 1999, werden vorgestellt und in ihren Kontexten interpretiert. Im zweiten Kapitel widmen sich die Autoren dann den Merkmalen und Problemlagen der jugendlichen Gewalttäterinnen und Gewalttäter. Diese sollen einerseits für Beobachtungen im Vorfeld solcher Taten sensibilisieren, andererseits nützliche erste Grundlagen für Prävention und Intervention schaffen. Das familiäre und schulische Umfeld der Täter ist Betrachtungsgegenstand des dritten Kapitels. Hier zeigt sich, dass schwache, funktionsunfähige Beziehungsstrukturen die Entstehung von ‚School Shootings’ offensichtlich begünstigen. In Kapitel vier und fünf werden die Rollen von Filmen, Musik, Internet und Computerspielen hinterfragt und der Jugendmedienschutz in Deutschland dargestellt. Offenbar spielen die Vorstellungswelten der jugendlichen Täter eine wesentliche Rolle bei der Entstehung von ‚School Shootings’. Zahlreiche ‚School Shooter’ scheinen unmittelbar vor ihrer Tat eine kurzzeitige Vermischung von Realität und Irrealität zu erleben, die mit herkömmlichen Kategorien der modernen Psychiatrie nicht fassbar ist. Am Beispiel des Gewaltexzesses an der Columbine High School wird die Fantasie der zwei Täter anhand von Tagebucheinträgen, Filmen und Zeichnungen beleuchtet. Kapitel sechs nimmt Trittbrettfahrer und Nachahmer aufs Korn. Besonders wichtig sind die aufgestellten Richtlinien zur Presseberichterstattung, um keine Nachahmungstaten zu stimulieren. In Kapitel sieben kommen drei Experten zu Wort, die sich konkret anhand anschaulicher Beispiele zu den Möglichkeiten der Prävention und Intervention äußern. Kapitel acht zeigt Wege zur Traumabewältigung, zur Aufarbeitung der Geschehnisse. Es eröffnet anschaulich den Blick in die Vorgehensweise der modernen Traumatherapie. In einem abschließenden Kapitel verdeutlichen die Autoren am Fallbeispiel Emsdetten noch einmal die inhaltlichen Schwerpunkte ihres Buches: Tat, Täter, Lebensumfeld, Medien, Fantasie, Nachahmungstaten, Prävention, Intervention und Traumabewältigung werden als ein Prozess erfasst. In den einzelnen Kapiteln werden in hellgrau unterlegten Info-Boxen die im Text genannten Fachtermini und wichtigen Verhaltensregeln verständlich erklärt.
Zusätzlich zum umfangreichen Literaturverzeichnis schließt jedes Kapitel mit eigenen Angaben zu weiterführender Literatur. Ein Stichwortverzeichnis umfasst wesentliche Sachbegriffe zum Nachschlagen. Im Anhang befinden sich auf 44 Seiten zahlreiche Kopiervorlagen sowie Arbeitsblätter für Lehrerkollegien und Krisenteams, mit denen ein schulinterner Notfallordner erstellt werden kann und entscheidende Informationen aufgenommen werden können. Weitere Fachautorinnen und -autoren des Buches sind: Kriminaldirektor Peter Hehne, Dipl.-Kriminalist (Kap. VII); Dr. Jens Hoffmann, Dipl.-Psych., Experte für Bedrohungsanalysen und psychologische Täterprof ile (Kap. VII); Aida Lorenz, Dipl.-Psych., Schulpsychologin (Kap. VII); Dr. Georg Pieper, Dipl.-Psych., Experte für Traumabewältigung (Kap. VIII). Das erfolgreiche Bemühen der Autorinnen und Autoren um Verständlichkeit und um Nachvollziehbarkeit der komplexen Sachverhalte, die Verhaltensregeln und Hilfen, die sie ihrer Leser-Zielgruppe bieten, machen das Werk zu einem wertvollen Präventions- und Interventionsratgeber, Übungs- und Nachschlagewerk für Lehrerkollegien, Eltern und Krisenteams.
Böhn, Andreas/Seidler, Andreas (2008). Mediengeschichte: Eine Einführung. 1. Auf lage. Tübingen: Narr Francke Attempto. 211 S., 14,90 €
Die Geschichte der Medien ist nicht neu und wurde bereits von zahlreichen Autorinnen und Autoren ausführlich thematisiert. Dieses Buch hebt sich jedoch durch seine Adressatenspezifität von den anderen ab. Das Werk ist für Studierende gedacht und als Vorlesung mit 14 Einheiten bzw. vier Themenblöcken konzipiert, die jeweils mit Kontrollfragen abgeschlossen werden. Das Buch soll zum Selbststudium oder als Basis für eine Vorlesung dienen und ist in der Reihe Bachelor-Wissen erschienen. Den Autoren ist es wichtig, „die Entwicklung der Medien stets vor dem Hintergrund ihrer gesellschaftlichen Bedingungen und Folgen darzustellen [...] [sowie ihrer] sozial- und mentalitätsgeschichtlichen Konsequenzen.“ (S. XI) Die gesellschaftlichen Bedingungen werden gut beleuchtet. Die negativen Folgen, die durch die Medien entstehen (können), werden jedoch nicht umfassend dargestellt; als Beispiel sei die Zensur während des dritten Reichs bzw. die Manipulation der Medien durch totalitäre Regime genannt. Die Problematik der Medien, beispielsweise ihre Gefahren (s. o.), werden nur beiläufig erwähnt. Diese hätten jedoch mindestens einen Unterpunkt im jeweiligen Kapitel oder beim letzten Themenblock, „Übergeordnete Aspekte der Mediengeschichte“, verdient. Die Kontrollfragen sollen nicht Faktenwissen, sondern „das Verständnis von Zusammenhängen in der Entwicklung der einzelnen Medien überprüfen“ (S. XII).
Dies gelingt überwiegend, jedoch nicht immer. Die Fragen mancher Kapitel lassen sich durch einfaches Nachschlagen und Abschreiben aus dem Text beantworten, zum Beispiel: „Gibt es einen wortgeschichtlichen Zusammenhang zwischen den Ausdrücken Text und Textilie?“ (S. 57) Diese Frage ist leicht mit „ja“ zu beantworten. Andere Fragen erreichen das gesteckte Ziel und setzen voraus, dass man das Gelesene verstanden hat, beispielsweise: „Was versteht man unter einem Mediendispositiv? Erläutern Sie dies am Beispiel ,Nachrichtenmagazin‘.“ (S. 26) Positiv zu sehen ist die Bereitstellung von Lösungen sowie weiterer Themen auf der Internetseite www.bachelor-wissen.de [Zugriff: 21.07.2009]. Die Themenblöcke sind sinnvoll gewählt. Sie sind nicht nur auf die Medien an sich reduziert, sondern führen in die Grundzüge der Kommunikations- und Zeichentheorie sowie in den Medienbegriff ein. Der erste Themenblock beschäftigt sich mit den oben genannten theoretischen Grundlagen. Der zweite mit den sprachbasierten Medien. Hier wird zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit differenziert. Die jeweiligen Folgen werden hauptsächlich im Bezug auf die Schriftlichkeit in der Gesellschaft dargestellt – insbesondere der Buchdruck sowie Zeitungen werden thematisiert. Anschließend folgt das Kapitel „Sprache und Bild“, welches mitunter als Grundlage für den Themenblock 3 dient. Der dritte Themenblock wendet sich den modernen technischen Medien wie Film, Fotografie und digitale Medien zu. Er endet mit der Darstellung von Multimedia sowie der Erläuterung von Hypertexten, welche die Vernetzung von Inhalten beschreiben.
Der letzte Themenblock führt darüber hinaus und behandelt übergeordnete Aspekte der Mediengeschichte. Hier wird dargestellt, wie sich Medien selbst reflektieren; hauptsächlich im Hinblick auf ihren wachsenden Einfluss auf den Alltag der Menschen. Zur Zitierweise lässt sich anmerken, dass es komfortabler wäre, den jeweiligen Abschnitt mit einem Zitat zu versehen als am Ende eines jeden Kapitels die verwendete Literatur zu erwähnen. Durch ‚ausführlicheres’ Zitieren kann einfacher nachgeschlagen und es können bestimmte Themen vertieft werden, ohne mehrere Bücher ausleihen zu müssen, um das jeweilige Zitat zu finden. Positiv anzumerken ist die Verwendung geeigneter Bilder, die nicht nur als Auflockerung beim Lesen dienen, sondern als Verständnishilfen sinnvoll eingesetzt werden. Die Literatur ist durchgehend wohl überlegt gewählt, wobei bei den digitalen Medien in Bezug auf die Nutzungsmöglichkeiten des Internets auf eine veraltete Quelle zugegriffen wurde. Hier wird nämlich von MUDs (Multiple User Dungeons) gesprochen, die eher antiquiert als aktuell erscheinen. Zwar ist diese Form des Onlinespiels immer noch zu finden, doch sind Spiele, die auf reiner Texteingabe basieren, eher dem vergangenen ‚DOSZeitalter’ zuzuschreiben. Man spricht heute eher von MMOG (Massive Multiplayer Online Games), worunter (Online-)Ego-Shooter und Rollenspiele einzuordnen sind. Sie sind von den MUDs durch eine grafische Oberfläche bzw. durch die Steuerung mittels Maus und Tastatur abzugrenzen. Gerade für Studierende ist das konsequente Erklären von Fachbegriffen sehr hilfreich. Hierdurch wird das Nachschlagen erspart, was das Lesen bedeutend erleichtert. Trotz einiger kritischer Anmerkungen kann ich eine Leseempfehlung aussprechen. Die Einführung in die Geschichte der Medien gibt einen guten Überblick. Das Buch ist ansprechend geschrieben – was bei Fachliteratur nicht immer der Fall ist. Empfehlenswert ist die Einführung für diejenigen, die sich während ihres Studiums über Grundlagen und Anfänge der Medien informieren möchten. Auch Lehrkräfte können sich mit diesem Werk fortbilden, um ihren Schülerinnen und Schülern die Entwicklung und die gesellschaftlichen Folgen der Medien – von Höhlenmalereien bis zum Computer und zur heutigen Multimedialität – aufzuzeigen und herauszuheben, auf welche Grundlagen sie sich stützt.
Schenk, Ralf (Hrsg.) (2009). Worte/Widerworte. Volker Baer: Texte zum F ilm 1958 – 2007. Marburg: Schüren Verlag. 310 S., 24,90 €
Das Handwerk, die Liebe zum Journalismus erbte er vom Vater. Der leitete nach der Lizenzerteilung durch die amerikanischen Behörden von 1945 bis 1969 das Feuilleton der Nürnberger Nachrichten, abgelöst von Hans Bertram Bock. Der 1930 geborene Sohn, Volker Baer, erlebte in dem liberalen, kulturell aufgeschlossenen Elternhaus die Schattenseiten des NS-Regimes. 1951 nahm er das Studium der Theaterwissenschaft, Germanistik, Publizistik und Kunstgeschichte in Erlangen auf, setzte es in München und ab 1953 in Berlin fort. Während der Semesterferien folgten im Fränkischen die ersten Schreibversuche. „Da man als Nachwuchsmann den Film als ‚mindere’ Kulturgattung leichter bekam“, wählte Baer dieses Gebiet. 1957 rief die Hannoversche Allgemeine Zeitung, um die dortige Filmseite zu verantworten. Dort stand Unterhaltendes auf dem Plan, nicht kritische Information. 1960 lockte dann der unabhängige Berliner Tagesspiegel, und der gebürtige Nürnberger überlegte nicht lange. Die Inselsituation der Stadt mit Brückenkopfcharakter zwischen Ost und West garantierten ein aufregendes Arbeitsfeld. Eine regelmäßige Filmseite in der Sonntagsausgabe des Tagesspiegel – sie hieß zuerst „Filmspiegel“ – stellte damals einen Luxus dar, weil nicht wohlwollende ‚Werbung’ für die Kinobranche gefragt war, sondern kritische Distanz, künstlerische Impulse und gesellschaftsrelevante Berichterstattung.
Der Stadt an der Spree blieb Volker Baer auch nach 1992, dem Ende beim Tagesspiegel, treu. „Berlin hatte eine besondere Funktion: Es ging um das Verbindende, nicht um das Trennende und um die Informationspflicht, die vornehmste Aufgabe des Chronisten“, erklärt er rückblickend. Aus Volker Baers 50 Jahren engagiertem Filmjournalismus hat der im Osten Deutschlands aufgewachsene Kritiker Ralf Schenk (Jahrgang 1956) als Herausgeber für den Marburger Schüren Verlag aus 7.000 Zeitungs- und Zeitschriftenbeiträgen 115 Artikel für den vorliegenden Band mit dem Titel Worte/Widerworte ausgewählt. Einziger Fauxpas des lesenswerten Buchs: Der Einband kündigt Texte von 1958 bis 2007, der Innenteil ab 1959 an. In einem informativen Gespräch stecken die beiden Journalisten zunächst die wechselhaften Zeitumstände eines langen Berufslebens ab. Den Themenschwerpunkt legt der Herausgeber auf das besondere Umfeld des in der geteilten Stadt Berlin lebenden und arbeitenden Franken. Die Auseinandersetzung mit der Filmpolitik, die Berichte über verkrampfte Ost-West-Beziehungen zählen zu den Highlights. Im April 1961, wenige Monate vor dem Mauerbau, berichtete Volker Baer von der ersten sowjetischen Filmwoche in Westberlin auch für die Nürnberger Nachrichten und skizzierte wenig später unter der Überschrift Kaum Premieren hinterm Stacheldraht das Kulturleben des geteilten Berlin. 1965, auf einer Film-Reise nach Prag, dokumentierte er das Gesicht des jungen tschechoslowakischen Kinos. Von Westberlin nach Cottbus mit dem Tagespassierschein ging es erstmals 1972. Im Blick zurück bewegen den Leser bzw. die Leserin Beiträge, die das Vermächtnis des Films als Zeitgeschichte transportieren. So mahnte Baer immer wieder die Verpflichtung zum Schutz des deutschen Filmerbes an, begleitete die Gründung der Deutschen Kinemathek 1963 in Berlin, konfrontierte sein Publikum anhand des Rechtsstreits um Veit Harlans Film Jud Süß oder Leni Riefenstahls Versuche, sich aus der künstlerischen Verantwortung zu stehlen, mit der Auseinandersetzung der NS-Vergangenheit. Die Uraufführung von Stanley Kramers Film Urteil von Nürnberg verknüpfte der Journalist mit Willy Brandts Ansprache zur besonderen geistigen und kulturellen Verpflichtung Berlins. Und für neue Filmliteratur fand Baer auf seiner Filmseite immer Platz. Die Beschreibung seiner Arbeitsweise während der Berliner Filmfestspiele spricht Bände: „Ich erinnere mich, dass ich oft mehrere Vorstellungen am Tag besuchen und mehrere Kritiken schreiben musste. Wenn genug Zeit war, setzte ich mich auf einem Parkplatz oder in einem Parkhaus ins Auto, hatte eine kleine Schreibmaschine auf den Knien und fing an zu schreiben. In den großen Schreibbüros der Berlinale, die dann eingerichtet wurden, brachte ich keine Zeile zustande, das war furchtbar.“
Obwohl der Band nicht einmal zwei Prozent des journalistischen Schaffens von Volker Baer berücksichtigt, ist Schenks Auswahl durchaus als repräsentativ anzusehen. Die 59 schwarzweißen, meist in guter technischer Qualität abgedruckten Bilder unterstützen die Texte, rufen Filmbilder und Personen zurück ins Gedächtnis. Und dieser Rückblick, die Erinnerung an eine Zeit, die man als Leser mehr oder weniger regelmäßig miterlebt hat, glänzt mit einer engagierten, aufs Wesentliche konzentrierten Einschätzung. Volker Baer, der besonnene Journalist, pflegt einen präzisen, argumentativen Sprachstil, verzichtet auf gefällige Modernismen, erfüllt mit unerschütterlicher Leidenschaft seine Chronistenpflicht, lässt Augen und Ohren schweifen. Seine Mitarbeiter schickte er zu Ausstellungen, animierte sie zu filmhistorischen Themen oder Jubiläen. Unter dem ‚geteilten Himmel’ galt ein breitgefächerter Kanon als Leitmotiv seiner Arbeit. Mehr im Hintergrund als viele seiner Kollegen, suchte Baer nie das Rampenlicht, die narzisstische Selbstdarstellung. Er war und ist ein Journalist alter Schule, ein Generalist, unbestechlich im Urteil.
Witting, Tanja (2007). Wie Computerspiele uns beeinflussen. Transferprozesse beim Bildschirmspiel im Erleben der User. München: kopaed. 247 S., 18,80 €
Computerspiele stehen nicht erst seit dem jüngsten Amoklauf von Winnenden in harscher Kritik. Die Wirkung von Bildschirmspielen auf die Verhaltensweisen der Nutzerinnen und Nutzer wird schon jahrzehntelang untersucht. Auch Tanja Witting nimmt sich in ihrer Studie Wie Computerspiele uns beeinflussen der Problematik an und hat mit Hilfe qualitativer Interviews 80 aktive Spielerinnen und Spieler befragt und Transfereffekte bezüglich des Verhaltens und der ethischmoralischen Einstellungen herausgearbeitet.Die Ergebnisse aus den Interviews verdeutlichen, dass eine Pauschalisierung im Zuge der Wirkungsdebatte nicht möglich ist, da die Transferprozesse zwischen virtueller Spielwelt und Realität weitaus diffiziler und andersartiger sind, als viele Kritiker annehmen. So zeigt sich, dass die virtuellen Spielwelten zwar bei den Nutzerinnen und Nutzern Spuren hinterlassen, aber gerade in der problematisch angesehenen Übernahme von gewaltbetonten Handlungsmustern fast ausschließlich lediglich in der mentalen Welt der Spielenden.
Diese Gewaltfantasien bleiben für die reale Welt aber folgenlos. Als weiteres Ergebnis der Studie wird deutlich, dass der Konsum von Computerspielen auch zu wahrnehmungsorientierten Transfers führt. Die Spielerinnen und Spieler übertragen so oftmals spieltypische Wahrnehmungsschemata wie genaues Beobachten oder schnelles Reagieren auf ihr alltägliches Handeln. Zudem wird durch typische Redewendungen und Ausdrücke das Verbalverhalten der realen Welt beeinflusst. Im Bereich der ethisch-moralischen Transfers ergibt sich für Witting aus den Befragungen, dass eine klare Trennung zwischen realer und virtueller Welt für viele nicht möglich ist. So sind die User oftmals durch ihre realweltlichen Erfahrungen so stark geprägt, dass bestimmte Normen und moralische Sichtweisen in die virtuelle Welt transferiert werden. Von ethisch-moralischen Transfers von der virtuellen in die reale Welt berichten hingegen – begründet durch ihre moralischen Gefestigtheit – nur wenige Userinnen und User, anders als in den Wirkungsdebatten oft unterstellt wird. Als den Transfer begünstigende Aspekte ergeben sich zusammenfassend lange und intensive Spielsessions, subjektive Relevanz und Bedeutsamkeit der Spiele sowie Parallelen zur realen Lebenswelt.
Die Rahmungskompetenz der Spielerinnen und Spieler, die virtuelle Welt als eigenständigen Sinnbereich beurteilen zu können, wird als ein den Transfer hemmenden Aspekt von allen Nutzenden genannt. Jedoch kann diese Fähigkeit nicht vollständig Transfers verhindern, wie es die Interviews gezeigt haben, sie führt aber dennoch zu einer verlässlichen Unterscheidung zwischen virtueller und realer Welt. An ihre Grenzen gerät die Rahmungskompetenz aber vor allem im Bereich der ethischmoralischen Aspekte, da realweltliche Anschauungen Rahmungsbemühungen zerbrechen lassen, sobald Spiele zu realistische gewalthaltige Elemente enthalten. Witting kommt zum Schluss, dass die Rahmungskompetenz alleine nicht ausreicht, sondern aus medienpädagogischer Sicht die Komponente der kritischen Reflexion hinzukommen muss, um die Schranken zwischen virtueller und realer Welt noch zu stärken. Eine kritisch reflexive Rahmungskompetenz sollte deshalb Bestandteil von Medienbildung werden, um die Reflexionsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen im Umgang mit virtuellen Spielwelten zu fördern.
Hübner, Georg (2009). Musikindustrie und Web 2.0. Die Veränderung der Rezeption und Distribution von Musik durch das Aufkommen des „Web 2.0“. Frankfurt am Main: Peter Lang. 134 S., 24,50 €
Die Musikindustrie hat sich verändert. Durch die neuen Möglichkeiten, die in Zeiten von Web 2.0 und Internet für alles Userinnen und User entstanden sind, Musik auf einfache Weise zu konsumieren, sieht sich die etablierte Branche berechtigterweise in großer Gefahr. Hübner geht in seiner Masterarbeit den veränderten Rezeptionsmöglichkeiten und deren Auswirkungen auf Musikstile und die Musikindustrie auf den Grund. Er vergleicht die neuen Entwicklungen mit den beiden vorangegangenen Revolutionen des Jazz und Rock’n’Roll, die er mit den neuesten Entwicklungen der Musik hin zum Web 2.0 auf eine Ebene stellt. Der heutige Strukturbruch ist im Vergleich zu den früheren ausgelöst durch die neuen Rezeptions- und Distributionsmöglichkeiten des Web 2.0 wie beispielsweise Peer-to-Peer-Technologie und File-Sharing. Die Musikindustrie steht dadurch inmitten eines Paradigmenwechsels, wie es ihn schon in Zeiten des Jazz und des Rock’n’Roll gab.
Der große Unterschied zu diesen Revolutionen manifestiert sich aber in der Tatsache, dass auch noch heute – circa zehn Jahre nach Beginn der Umwälzung – noch kein neuer Musikstil aufgekommen ist und die Musikindustrie gefährdeter ist denn je. Die Web 2.0-Revolution besteht in der Änderung der Rezeption von Musik. Für Hübner teilt sich die gegenwärtige Revolution in zwei Stränge: eine Revolution der Produktionsmittel einerseits – die digitale Revolution – und andererseits eine der Kommunikationsmittel – die Revolution des Netzes. Er schlussfolgert letztendlich, dass die Tonträgerbranche in den Bereichen Distribution, Produktion und Marketing ihre Vormachtstellung als Mainplayer der Musikvermittlung verloren hat. Für Künstler (und deren Produzenten) bedeuten die neuen Möglichkeiten des größeren Publikums im Web 2.0 aber nicht nur Vorteile. Es heißt nun, aus der Informationsüberflutung herauszustechen und so der sinkenden Bereitschaft der Rezipientinnen und Rezipienten, für Musik Geld zu bezahlen, entgegenzuwirken. Doch in Zeiten, in denen Streaming-Angebote aus dem Internet-Boden sprießen und somit Musik kostenfrei verfügbar ist, stellt sich die Frage, wie das in Zukunft überhaupt gelingen soll. Nutznießer sind hier, so Hübner, die „Telekom-Branche“, Gerätehersteller und Musikportale. Und den Musikern bleibt nichts als zu hoffen ... auf Aufträge durch gratis verteilte Musik im Netz, auf Einnahmen durch Livekonzerte und vielleicht auch ein wenig auf Almosen – wie früher schon einmal im Mittelalter.
Keller, Harald (2009). Die Geschichte der Talkshow in Deutschland. Frankfurt am Main: F ischer Taschenbuch Verlag. 480 S., 14,95 Euro
Es gibt nicht viele Kritiker, die eine derart profunde Programmkenntnis aufweisen wie Harald Keller. Tatsächlich ist seine Abhandlung mitunter gründlicher, als einem lieb ist; zehn Seiten über „Gottschalk täglich“ sind des Guten fast zuviel. Aber natürlich hat das Methode, schließlich war die Talkshow prototypisch für eine ganze Gattung. Kellers Ziel istohnehin nicht die lückenlose Auseinandersetzung mit dem Genre; das würde jeden Rahmen sprengen. Kern des Buches ist zwar der Streifzug durch die Programmgeschichte, aber der Autor konzentriert sich auf jene Sendungen unter den Vorläufern heutiger Talkshows, die zeittypische Bedeutung aufgewiesen oder das Genre maßgeblich beeinflusst haben. Als Medienwissenschaftler geht er dabei natürlich bis zu den Anfängen zurück, weshalb die Zeitreise in Amerika beginnt.
Deshalb und dank einer Vielzahl von Exkursen erfährt man nicht nur eine Menge über die Geschichte des Fernsehens, sondern lernt nebenbei auch, wie das Medium funktioniert. In Deutschland vermieden es die Sender zwar tunlichst, den Begriff „Unterhaltung“ zu verwenden, aber natürlich liefen die Gesprächssendungen darauf hinaus. Keller illustriert dies mit einer Vielzahl an zitierten Fundstücken aus Kritiken, Repliken und Leserbriefen. Die Lektüre sei übrigens nicht zuletzt den Redaktionen empfohlen, schließlich belegen Kellers Ausführungen immer wieder die geringe Bereitschaft der Sender, sicheres Fahrwasser zu verlassen.
Marci-Boehncke, Gudrun/Rath, Matthias (Hrsg.)(2009). Jugend – Werte – Medien: Das Modell. Weinheim und Basel: Beltz Pädagogik (Stiftung Ravensburger Verlag). 207 S., 29,95 €
In Zeiten, in denen Medien den Alltag von Kindern und Jugendlichen immer intensiver dominieren, wird Medienkompetenz mehr denn je gefordert. Dass ein sinnvoller Umgang mit Medien auch in Schulen möglich ist – und zwar als generelle erzieherische Aufgabe –, zeigen Gudrun Marci-Boehncke und Matthias Rath in Jugend – Werte – Medien: Das Modell. Das Buch ist die fünfte Publikation im Rahmen des Forschungsprojekts „Ravensburger Jugend-Medienstudien“ und knüpft an die empirischen Ergebnisse der Studien an. Ziel ist es, die medialen Fähigkeiten von Jugendlichen wie paralleles Medienhandeln, Schnelligkeit, vernetztes Denken oder Selbstlernkompetenzen, die sie sich durch ihre intensive Medienrezeption angeeignet haben, in den schulischen Alltag mit einzubeziehen und neben ihrer Lesekompetenz auch diese Medienkompetenzen weiter auszubauen. An zehn Unterrichtsbeispielen für verschiedene Klassenstufen, Schularten und genderspezifische Vorlieben zeigen verschiedene Autorinnen und Autoren, wie Lehrerinnen und Lehrer pädagogisch sinnvoll Medieninteressen und Medienerfahrungen von Schülerinnen und Schülern aufgreifen können. Lehrende erhalten Bausteine zur pädagogisch-didaktischen Aufarbeitung aktueller Medienformate, -themen, -geräte, die an zeitgemäßen Medienbeispielen modellhaft vorgeführt werden, sich aber aufgrund der Schnelllebigkeit der Medienlandschaft auch auf andere Exempel anwenden lassen. Nach einer kurzen Zusammenfassung der Studienergebnisse und einem Beispiel einer kleinen Medienumfrage der Herausgeberin selbst werden die Unterrichtsanregungen aufgeführt.
Die zehn Unterrichtseinheiten setzen sich aus einleitenden Gedanken zum expliziten Medium, einer Verortung in der Medienmatrix, der Werte- und Kompetenz orientierung und dem konkreten Unterrichtsmodell zusammen. Besprochen werden unter anderem Animations- und Zeichentrickfilme wie Die Monster AG oder Könige der Wellen ebenso wie BRAVO Sport als gender-orientiertes Printmedium. Auch die jugendlichen Medienvorlieben Handy, Daily Soaps und Social Communitys werden anhand komplett ausgearbeiteter Ideen für einen Einsatz im Unterricht vorgestellt. Ergänzend zu den Unterrichtsskizzen im Buch können die jeweils dazugehörigen Arbeitsblätter auf den Verlagsseiten heruntergeladen werden.
Meyer, Erik (Hrsg.) (2009). Erinnerungskultur 2.0. Kommemorative Kommunikation in digitalen Medien. Frankfurt/New York: Campus Verlag. 239 S., 27,90 €
Radio, Fernsehen, Internet – unser Leben wird scheinbar von Jahr zu Jahr medialer und digitaler. Schon heute ist das Internet nicht mehr aus dem täglichen Leben wegzudenken,das ganze Leben ist davon beeinf lusst und die Zukunft wird maßgeblich von (digitalen) Medien mitgestaltet. Da bleibt eigentlich nur die Vergangenheit als ‚medienfreier’ Raum – oder? Glaubt man Erik Meyer und seinen Autorinnen und Autoren, so ist selbst die Vergangenheit längst medial beeinflusst. Digitale Medien prägen unsere Sicht auf Vergangenes, steuern und gestalten unsere Erinnerungen und nehmen so indirekt Einfluss auf die tatsächlichen Geschehnisse. Doch wie sieht sie aus, die „Erinnerungskultur 2.0“, in der wir heute leben? Im Rahmen der Tagung „Virtual Memory; Virtual History – Digitale Verbreitungsmedien: Konkurrenz und Komplementarität?“, die im November 2006 stattfand, machten sich Expertinnen und Experten darüber Gedanken und hielten ihre Befunde und Erkenntnisse nun im Band „Erinnerungskultur 2.0“ fest.
Exemplarisch wird hier am Zweiten Weltkrieg in einem medialen Rundumschlag untersucht, wie Vergangenheit in den digitalen Medien aufgearbeitet und präsentiert wird. So untersuchen Wulf Kansteiner und Gunnar Sandkühler zunächst, wie Videospiele und speziell Ego-Shooter die Geschichte darstellen, aufarbeiten und teilweise auch neu konstruieren. Bruno Arich-Gerz beschäftigt sich mit einem E-Learning Projekt, in dem Studierende das Wissen von Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges gesammelt und auf DVDs ‚haltbar’ gemacht haben und arbeitet Vorteile und Kritikpunkte an einer solchen Art der Erinnerungsarchivierung heraus. Angela Sumner und Marc Grellert stellen anschließend zwei Angebote vor, die ‚echtes’ Erinnern in eine virtuelle Welt verlagern: die „Virtual Wall“ des Vietnam Veterans Memorial Fund und die virtuelle Wiederherstellung zerstörter Synagogen. Zu guter Letzt schließlich zeigen Dörte Hein, Erik Meyer und Maren Lorenz, wie Geschichte im Web 2.0 präsentiert und aufbereitet wird. Dabei werden Seiten, die online an den Holocaust erinnern, auf ihre Qualität und Motive hin untersucht, Angebote wie Wikipedia kritisch beleuchtet und die Eigenheiten digitaler Historiendarstellungen – wie Individualisierung, Fragmentierung und Subjektivierung der Fakten – herausgearbeitet. Heraus kommt bei alledem kein umfassendes Werk über Geschichte im digitalen Zeitalter, dies macht die Breite des Themas sowie die Konzentration auf nur ein geschichtliches Ereignis schon unmöglich. Dennoch bietet das Buch einen Ansatz, die gängigen Darstellungen von Geschichte und auch das eigene, digital geprägte Bild der Vergangenheit in einem neuen Licht zu sehen und wirft interessante Fragen und Diskussionsansätze auf.
Sindern, Klaus H. (2009). Tamagotchi Schule. Warum Schule nicht gelingen kann. Leipzig: tologo. 128 S., 12,90 €
Der Mensch strebt von Natur aus nach Wissen, das ist uns seit Aristoteles bekannt. Diese natürliche Neugierde ist Voraussetzung für den Bildungserwerb und von Grund auf in jedem Kind verankert und sollte auch in Schulen gefördert bzw. weiter angeregt werden. Doch Klaus H. Sindern ist der Meinung, dass unsere Schulen als System nicht in der Lage sind, diese Bildungsprozesse anzuregen. Sie zerstören sie vielmehr und führen zu frustrierten Heranwachsenden. Gerade Amokläufe wie Erfurt oder Emsdetten zeigen ihm, dass das System Schule einen Fehler hat, wenn Schülerinnen und Schüler dort derartige Frustrationen entwickeln. Auch PISA verdeutlicht die Misere unseres Bildungssystems. Einen großen Fehler sieht er in der Tatsache, dass Schule Ländersache ist und so 16 Ministerien ihr eigenes Ding machen. Warum, fragt sich der Autor weiter, kann es nicht überall Versuchsschulen wie beispielsweise die Laborschule Bielefeld oder die Glocksee-Schule in Hannover geben, die doch auch funktionieren und das, wie bei den PISA-Tests gesehen, oftmals besser als alle anderen Schulen?
Doch der Alltag der deutschen Schulen sieht anders aus, das weiß Sindern und spricht dabei aus 30 Jahren Lehrerfahrung. Sinnloses Auswendiglernen und die Anhäufung unnötigen Wissens stehen auf der Tagesordnung von Schülerinnen und Schülern. Sie reproduzieren brav ihr Gelerntes, allein nach den subtilen Wünschen des Auftraggebers, der Lehrkraft. In der Schule vollzieht sich seiner Meinung nach eine Gehirnwäsche. Die Schule ist ein reiner Notenproduktionsbetrieb, an dessen Spitze die Lehrerin oder der Lehrer mit der Lizenz zur (subjektiven) Benotung steht. Und die Schülerinnen und Schüler haben sich längst diesen Produktionsmaßnahmen angepasst und arbeiten nach dem ökonomischen Minimalprinzip, weil die Schule dies und nichts anderes einfordert. Sindern kommt letztendlich zur Erkenntnis, dass Schule eine gigantische Zeit- und Ressourcenverschwendung ist und die gelingende Schule eine Utopie. Aber das System Schule wird weiter gefüttert und versorgt, obwohl es seinen Sinn schon lange verloren hat, eben wie ein Tamagotchi.
Zoch, Annette (2009). Mediennutzung von Senioren. Eine qualitative Untersuchung zu Medienfunktionen, Nutzungsmustern und Nutzungsmotiven. In: Meyen, Michael (Hrsg.), Reihe Mediennutzung, Bd. 13. Berlin: Lit Verlag. 216 S., 24,90 €
Das Mediennutzungsverhalten von Seniorinnen und Senioren scheint nahe zu liegen: die tägliche Morgenzeitung, nebenher läuft das Radio, ausschließliche Nutzung öffentlich-rechtlicher Fernsehsender, kein Interesse an Internet und Kino. Doch Ergebnisse aus der Mediennutzungsforschung sehen anders aus, denn ältere Menschen nutzen deutlich länger Medien als der Rest der Bevölkerung. Warum Menschen über 60 Jahren zu den intensiven Mediennutzerinnen und -nutzern gehören, welche Funktionen Medien für sie erfüllen und welche Erwartungen Seniorinnen und Senioren an Medien stellen, mit diesen Fragen beschäftigt sich Annette Zoch in ihrer Dissertation „Mediennutzung von Senioren“. Sie geht von der Tatsache aus, dass der Schritt heraus aus der Berufswelt in den Ruhestand für die ältere Generation verbunden ist mit vielen weiteren Anforderungen als nur dem alleinigen Arbeitsverlust. So werden soziale Netzwerke kleiner, materielle Probleme vergrößern sich, psychische Belastungen wie das nahende Lebensende kommen auf, die Mobilität sinkt und den Menschen bleibt mehr Zeit, sich den Medien zuzuwenden.
Zoch kommt in ihren Untersuchungen zum Mediennutzungsverhalten von Seniorinnen und Senioren (47 Befragte per Leitfaden-Interview) zum Ergebnis, dass Medien für ältere Menschen vor allem drei Hauptfunktionen erfüllen. Zum einen werden Medien konsumiert, um altersbedingte Defizite zu kompensieren, zum anderen dienen die Medien der beständigen Orientierung in der Gesellschaft, die sie aufgrund des Ruhestands ‚verlassen‘ mussten. Außerdem suchen ältere Menschen in den Medien eine emotionale Stabilisierung. Aufgrund der Interviews ordnet Zoch die älteren Mediennutzerinnen und -nutzer sechs Typen zu: den Pflichtbewussten, den Gelassenen, den Bildungshungrigen, den Indifferenten, den Genügsamen und den Abhängigen, je nach den Unterscheidungskriterien „Bedeutung der Medien im Alltag“ und „Erwartungshaltung gegenüber dem Medium“.
Insgesamt sieht Zoch als Einflussfaktoren strukturelle und positionelle Merkmale wie Bildung, Beruf, Geschlecht aber auch vor allem individuelle Determinanten (Gesundheit, Aktivität und Wohnform), die die Mediennutzung im Alter stark beeinflussen. Zoch kommt zum Fazit, dass Medien einen wertvollen Beitrag leisten, ältere Menschen auch nach ihrem Berufsleben an einem nützlichen, produktiven und der Gesellschaft zugehörigen Leben teilhaben zu lassen. Denn, so zeigen ihre Untersuchungen, Medien erleichtern einerseits die psychische Bewältigung des Alters mit all seinen Anforderungen und sie bilden andererseits auch einen Ersatz für verloren gegangene Gratifikationen aus dem vergangenen Arbeitsleben.
kolumne
Elisabeth Jäcklein-Kreis: Google, my brain!
„Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben …“Ja, ich gebe es zu – ich habe jemanden kennen gelernt. Er ist so höflich und zuvorkommend, so witzig und gebildet, so verständnisvoll und immer für mich da. Wenn ich ein Problem habe oder ratlos bin. Und er weiß so viel – zu jedem Thema. Google ist tatsächlich ein Freund, wie man ihn selten findet. Schneller Helfer bei Wissensfragen, geduldiger Zuhörer in der Not, unermüdlicher Beschäftigungstherapeut bei Langeweile und unerschöpfliche Fundgrube. Bin ich mit meinem Latein längst am Ende, hat er meist noch einige hunderttausend Tipps für mich und gibt mir alles, was ich brauche – von witzigen Postkarten-Sprüchen über gewiefte Diskussionsargumente bis zu klugen Bewerbungstipps. Wozu da noch selbst denken – Google als ‚externes Gehirn’ funktioniert doch hervorragend.
Ich weiß ohnehin gar nicht, wie Menschen jahrhundertelang leben konnten, woher sie ihre Informationen bekamen, wie sie Jobs finden, Autos kaufen, Telefonnummern und Adressen herausfinden, ihre Rechtschreibung überprüfen, gar studieren und Abschlussarbeiten schreiben konnten, ohne zu googeln. „Ich google das mal eben!“ ist mittlerweile so populär, dass sich sogar der Duden nicht mehr erwehren konnte, ‚googeln’ (‚im Internet, bes. in Google suchen“) in sein dickes gelbes Schriftwerk aufzunehmen. Allein, irgendwie spricht sich das Rechtschreib-Standardwerk damit ein bisschen selbst die Relevanz ab – denn wer blättert schon noch in dicken gelben Büchern, wenn er auch mit zwei Klicks die bunte Buchstabenreihe um Rechtschreibtipps bemühen kann? Ja, die vielen farbigen Os – die wahlweise auch als Tierchen oder Luftballons, als saisonaler Gruß oder Hommage an große Kunstwerke, als Braille-Punkte oder Aliens daher kommen – sind mehr als nur schnöde Buchstaben. Sie sind Freund und Helfer, sie sind – um mit Malte Herwig, laut Google „Journalist und Redakteur“, zu sprechen – „zur kulturellen Ikone geworden, ein digitales delphisches Orakel.“ Sollte jemand das Schulwissen zu den Schlagworten „Antike“ und „Griechenland“ schon aus dem eigenen Gehirn ausgelagert haben: ‚delphisches Orakel’ lässt sich googeln. Aber Vorsicht: Das ‚delphische Tarot’, das das digitale Hirn gleich als zweiten Treffer anbietet, schaut mehr esoterisch in die Zukunft als historisch- fundiert in die Vergangenheit. Überhaupt beschleicht mich manchmal das leise Gefühl, dass irgendetwas fehlt in meiner Beziehung zum Traummann Google.
Will ich mich etwa weiter mit ihm über das Orakel des Apollo unterhalten, möchte er mich stattdessen zum Optiker oder wahlweise ins Kino schicken. Sehr höflich finde ich das nicht. Auch habe ich manchmal den Eindruck, die Machtgefälle in unserer Beziehung sind ein bisschen einseitig. Oder woher sonst rührt das leicht verschämt-beklommene Schweigen, das in so mancher Gesprächsrunde nur allzu schnell entsteht, wenn keiner da ist, der das politische Tagesgeschehen schnell per iPhone googelt? Vielleicht sollte ich doch wieder etwas mehr Selbständigkeit gewinnen? Mal wieder das eigene Hirn entstauben und auch da das eine oder andere peu Wissen reinpacken? In guten alten Zeitungen, Telefonbüchern oder Enzyklopädien blättern, wenn ich Wissens- oder Informationsbedarf habe? Der Brockhaus zum Beispiel, vielleicht ist der der bewandtere (und galantere) Gesprächspartner, wenn es um griechische Antike geht. Aber woher nehme ich jetzt einen Brockhaus? Ich werde das mal googeln …Herwig, Malte (2005). Generation Google. In: Herwig, Malte. Eliten in einer egalitären Welt. Berlin: wjs Verlag.
Beitrag aus Heft »2009/04: Informationelle Selbstbestimmung?!«
Autor: Elisabeth Jäcklein-Kreis
Beitrag als PDFEinzelansicht
Ansprechperson
Kati StruckmeyerVerantwortliche Redakteurin
kati.struckmeyer@jff.de
+49 89 68 989 120
Ausgabe bei kopaed bestellen
Zurück