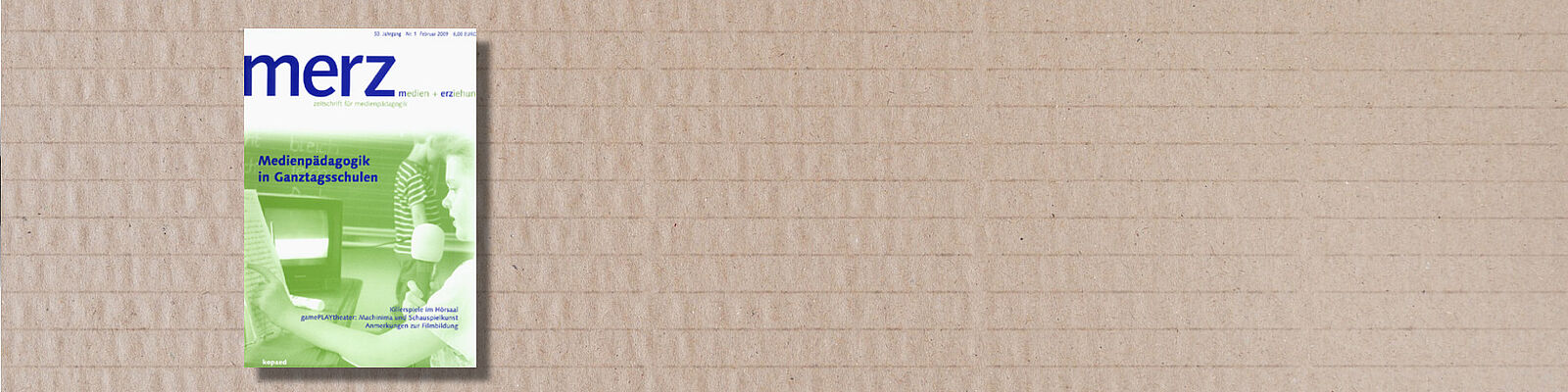2009/01: Medienpädagogik in Ganztagsschulen
Mit der zunehmenden Zahl von Ganztagsschulen in Deutschland steigt die Hoffnung der Medienpädagogik, ihren Platz im schulischen Alltag zu bekommen. Tatsächlich hat diese Entwicklung dazu geführt, dass in einigen Bundesländern Modelle entwickelt werden, mit dem Ziel, die Förderung von Medienkompetenz in der Schule zu verankern. Eines der wichtigsten Argumente für die Integration von Medienpädagogik in Ganztagsschulen ist, dass Schülerinnen und Schüler damit ein Angebot erhalten, bei dem sie Selbstwirksamkeit erfahren, das sie motiviert und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung nachhaltig stärkt. Damit unterstützt medienpädagogische Arbeit Entwicklungen, die mit dem Mehr an Zeit, die Kinder und Jugendliche in Ganztagsschulen verbringen, noch stärker als bisher zur Aufgabe von Schule werden. Noch ist die Politik in Deutschland in Bezug auf Ganztagsschulen sehr uneinheitlich. Umso genauer sollte man sich Modelle ansehen, die anderen Bundesländern besonders gut gelungen sind. Eine Auswahl innovativer Ideen wird in dieser merz-Ausgabe vorgestellt.
aktuell
stichwort Generationenabriss
Die pädagogische wie sozialwissenschaftliche Mediendebatte greift in jüngerer Zeit auch intensiv auf das soziologische Konzept der „Generation“ zurück, um neben Geschlecht, Schicht und Milieu eine weitere erklärende Variable für das Verständnis unterschiedlicher Muster der Mediennutzung und -wirkung zu testen. Diese Vorstellung hat mittlerweile auch die Gremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Sachen praktischer Rundfunkpolitik erreicht. So umschreibt Volker Giersch 2008 im ARD-Jahrbuch mit der dramatisierenden rhetorischen Formel vom „Generationenabriss“ den Sachverhalt, dass nicht nur bei den 15- bis 29-Jährigen, sondern auch bei den 30- bis 49-Jährigen niedrige und weiter sinkende Marktanteile beim Fernsehkonsum öffentlich-rechtlicher Programme zu beobachten sind.
Das Durchschnittsalter der ARD- und ZDF-Publika ist demnach auf gut 60 Jahre gestiegen – bei weiter steigender Tendenz. Im Kontrast dazu sind die durchschnittliche Zuschauerin und der durchschnittliche Zuschauer der privaten Anbieter satte 15 Jahre jünger. Sorge macht dem Autor insbesondere, mit welchem Tempo das Durchschnittsalter bei den Öffentlich-Rechtlichen ansteigt – altere doch das ARD-und ZDF-Fernsehpublikum mehr als dreimal so stark wie das Fernsehpublikum insgesamt. Die Älteren sehen öffentlich-rechtlich, die jüngeren privat. Meist genannter Grund ist das Medienverhalten der heutigen Jugendjahrgänge. Mit zunehmendem Alter gleicht sich das Medienverhalten rasch den Durchschnittswerten an.
Generationenabriss konnotiert also die Vorstellung, dass es im Zeitverlauf betrachtet weniger gemeinsame Medienerfahrungen zwischen den Generationen in Form des öffentlich-rechtlichen Fernsehens gibt. Das stellt nicht nur ein programm- und quotentechnisches Problem dar, sondern wirft auch die Frage nach der zukünftigen gesellschaftlichen Basis für generationale, intergenerative Sozialisation auf. Zur Vermeidung einer weiteren Forcierung des Generationenabrisses müsse daher das gesamte Programmangebot Schritt für Schritt und sensibel verjüngt werden.
thema
Ida Pöttinger, Karin Zinkgräf, Karin Schneider-Weber: SMEP oder Learning by Dewey
Das Schüler-Medienmentoren-Programm (SMEP) ist ein Projekt, das Schülerinnen und Schüler befähigt, an der eigenen Schule selbst Kurse zu Medienthemen anzubieten. Im Laufe eines Schuljahres erhalten sie Einblicke in multimediale Technik und außerdem das pädagogische Rüstzeug, eigene Arbeitsgemeinschaften zu leiten. Die Erfahrung zeigt, dass 75 Prozent der Schülerinnen und Schüler im Jahr darauf selbst aktiv werden.
Beitrag aus Heft »2009/01: Medienpädagogik in Ganztagsschulen«
Autor: Ida Pöttinger, Karin Zinkgräf, Karin Schneider-Weber
Beitrag als PDFEinzelansichtDaniela Bickler: Freie Lernorte - Ein pädagogisches Konzept entsteht
Im Projekt Freie Lernorte – Raum für mehr von Schulen ans Netz e. V. haben sich 60 Schulen aus ganz Deutschland auf den Weg gemacht, das Potenzial (neuer) Medien für Schule und Unterricht mit dem Mehr an Zeit an Ganztagsschulen zu verbinden. Am Anfang stand eine vage Idee von Freien Lernorten als attraktive Medienräume im Schulalltag. Das Resultat ist mehr als erhofft: Unter dem Motto Freie Lernorte ist ein ganzheitlicher pädagogischer Ansatz entstanden, der konsequent Schülerinnen und Schüler als Gestaltende ihres Lernprozesses in den Vordergrund rückt. Literatur:Appel, Stefan (2004). Was ist eine Ganztagsschule? In: Pädagogische Führung. Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung. 3/2004, S. 108–111.Bickler, Daniela (2008). Freie Lernorte – Raum für mehr. Ergebnis- und Erfahrungsbericht der medienpädagogischen Begleitung. Bonn. freie-lernorte.de/begleitprogramm/medienpaedagogischebegleitung/dokus/Freie_Lernorte_Ergebnisbericht.pdf [Zugriff: 4.12.2008].Bickler, Daniela/Gräve, Katja/Schopen, Michael/Throm, Anja (Hrsg.) (2008). Freie Lernorte. Lernen verändern – Medien nutzen – Schule entwickeln. Braunschweig: Westermann.Bundesjugendkuratorium (Hrsg.) (2004). Neue Bildungsorte für Kinder und Jugendliche; Positionspapier. www.bundesjugendkuratorium.de/pdf/2002-2005/ bjk_2004_neue_bildungsorte_fuer_kinder_u_jugendliche.pdf [Zugriff: 22.1.2008].Holtappels, Hans Günther (1994). Ganztagsschule und Schulöffnung. Perspektiven für die Schulentwicklung. Weinheim: Juventa.Holtappels, Hans Günter (1995). Ganztagserziehung in der Schule. Opladen: Leske und Budrich.
Katja Friedrich: Landesmedienanstalt goes Ganztagsschule
Die Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK) engagiert sich seit 2002 mit medienpädagogischen Projekten in der Ganztagsschule. Vor zwei Jahren hat sie die hundertprozentige Tochtergesellschaft medien+bildung.com gGmbH gegründet. m+b.com arbeitet zur Zeit mit 46 Ganz-, 20 Halbtagsschulen, drei Universitäten, einer FH, diversen Studienseminaren und zahlreichen außerschulischen Einrichtungen zusammen. Elf hauptamtliche Medienpädagoginnen und Medienpädagogen, kulturell und technologisch ‚stets am Ball’, haben den Auftrag, Medienbildung im Bildungsalltag verankern zu helfen.Literatur:Augsburg, Ralf (2004). Ganztagsschule – Ganztagsbildung: Politik – Pädagogik – Kooperation. In: Appel, Stefan/Ludwig, Harald/Rother, Ulrich/Rutz, Georg (Hrsg.), Jahrbuch Ganztagsschule 2005. Investition in die Zukunft. Schwalbach/Ts.: Wochenschau, S. 229-235.Friedrich, Katja (2006). Vom Tagungspodium in den schulischen Alltag. Wie medienpädagogische Konzepte in die Praxis umgesetzt werden. Funkkorrespondenz, 22, S. 8-9.Röll, Franz Josef (2008). Bemerkungen über den aktuellen Umgang mit dem Seh-Sinn. In: Lauffer, Jürgen/Rölleke, Renate (Hrsg.), Mit Medien bilden. Der Seh-Sinn in der Medienpädagogik. Handbuch 3, Bielefeld, S. 30-37.Schorb, Bernd (2006). Argumente für eine integrale Medienpädagogik. In: Helga Theunert (Hrsg.), Bilderwelten im Kopf. Interdisziplinäre Zugänge. München: kopaed, S. 17-21.
Beitrag aus Heft »2009/01: Medienpädagogik in Ganztagsschulen«
Autor: Katja Friedrich
Beitrag als PDFEinzelansichtJürg Fraefel: Schulisches Medienprofil und Ganztagsschule
Die öffentliche Schule muss im Übergang zur Wissensgesellschaft mit der Weiterentwicklung ihres Angebots reagieren, um attraktiv zu bleiben. Eine Schule kann sich verändern, indem sie ihr Schulprofil entwickelt. In diesem Veränderungsprozess kann die Medienpädagogik wichtige Impulse geben. Mit einem schulischen Medienprofil werden Medien systematisch in den Unterricht und in die schulischen Handlungsfelder integriert. Auch die Ganztagsschule entspricht dem gesellschaftlichen Bedarf. Das Medienprofil und das Ganztagsprofil lassen sich in idealer Weise verbinden.
Literatur:
Altrichter, Herbert/Schley, Wilfried/Schratz, Michael (1998). Handbuch zur Schulentwicklung. Innsbruck: Studien-Verlag.
Bosshammer, Herbert/Knauer, Sabine/Wegener, Sabine/Welker, Christian (2008). Öffentlichkeitsarbeit als Impuls zur (Ganztags-) Schulentwicklung. www.ganztaegiglernen.org/media/web/download/th09-internet.pdf [Zugriff: 6.12.2008]
Eickelmann, Birgit/Schulz-Zander, Renate (2008). Schuleffektivität, Schulentwicklung und digitale Medien. Jahrbuch Schulentwicklung Band 15. Institut für Schulentwicklungsforschung. Weinheim und München: Juventa Verlag: S. 157–193
Fraefel, Jürg (2008a). Wissensmanagement in heil- und sonderpädagogischen Einrichtungen im Spannungsfeld zwischen Mensch und Technik. Bern: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik. 9/2008. S. 14-21 www.cspsszh.ch/ fileadmin/data/1_szhcsps/7_zeitschrift/Archiv/2008.09. Fraefel.pdf [Zugriff: 6.12.2008]
Fraefel, Jürg (2008b). Computer im Klassenzimmer – wo bleibt der pädagogische Nutzen? Bildung Schweiz 11a/2008: S. 18+19. lch.ch/dms-static/93523378-ccd4-412d-8e29-f93aea748510/compi18_19.pdf [Zugriff: 6.12.2008]
Hettinger, Jochen (2004). Medienentwicklungsplanung für Schulen. Karlsruhe: Landesmedienzentrum Baden-Würthemberg. supportnetz.de/uploads/tx_dcfiles/ mep-broschuere.pdf [Zugriff: 6.12.2008]
Höhmann, Katrin/Kamski, Ilse/Schnetzer, Thomas (2006). Was ist eigentlich eine Ganztagsschule? Institut für Schulentwicklungsforschung. www.ganztaegiglernen.org/ media/web/download/th-06.pdf [Zugriff: 6.12.2008]
Holtappels, Heinz Günther/Voss, Andreas (2006). Organisationskultur und Lernkultur. Jahrbuch Schulentwicklung Band 14, Institut für Schulentwicklungsforschung.Weinheim und München: Juventa Verlag, S. 247-275.
Honegger Monique/Ammann, Daniel (2008). Medienkompetenz und literale Praxis in informellen Lernarrangements – ein schulisches Schreiblesezentrum mit elektronischer Lernumgebung. merz 6-08 (merzWissenschaft), S. 108-116.
Merz-Abt, Thomas (2004). Medienbildung in der Volksschule Grundlagen und konkrete Umsetzung. Zürich: Verlag Pestalozzianum.Moser, Heinz (2005). Wege aus der Technikfalle. eLearning und eTeaching. Zürich: Verlag Pestalozzianum.
Philipp, Elmar/Rolff, Hans-Günther (2006). Schulprogramme und Leitbilder entwickeln. Weinheim: Beltz.
Pöttinger, Ida/Zinkgräf, Karin (2008) Ganztagsschule: Der kürzeste Weg zur Medienkompetenz?! Karlsruhe, Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. www.mediacultureonline.de/fileadmin/handouts/schriftenreihe_ ganztagsschule.pdf [Zugriff: 6.12.2008]
Tulodziecki, Gerhard/Herzig, Bardo (2002). Computer & Internet im Unterricht.Medienpädagogische Grundlagen und Beispiele. Berlin: Cornelsen Scriptor.
Beitrag aus Heft »2009/01: Medienpädagogik in Ganztagsschulen«
Autor: Jürg Fraefel
Beitrag als PDFEinzelansichtGerhard Tulodziecki: Ganztagsschule und Medienbildungsstandards
Medienbildung stellt eine bedeutsame Aufgabe der Schule in der Informations- und Wissensgesellschaft dar. Allerdings wird diese Aufgabe bisher nicht in der notwendigen Breite und Tiefe wahrgenommen. Mit der zunehmenden Einrichtung von Ganztagsschulen verbessern sich vor allem die zeitlichen Bedingungen für eine Umsetzung der Medienbildung. Andere Probleme bleiben jedoch – wenn zum Teil auch in modifizierter Form – bestehen. Zugleich ergeben sich neue Problemlagen. Es stellt sich die Frage, wie möglichen Schwierigkeiten begegnet werden kann. Im Rahmen allgemeiner Lösungsansätze lassen sich hier Standards für die Medienbildung für einen konstruktiven Umgang nutzen.
Literatur:
Hoffmann, Bernward (2004). Alles Schule oder was? Medienpädagogik zwischen Jugendhilfe und Ganztagsgrundschule. In: Pöttinger, Ida/Schill, Wolfgang/Thiele, Günter (Hrsg.). Medienbildung im Doppelpack. Wie Schule und Jugendhilfe einander ergänzen können. Bielefeld: AJZ-Druck & Verlag, S. 106-120.
KMK (2005). Bericht über die allgemein bildenden Schulen in Ganztagsform in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland – 2002 bis 2003. Bonn: Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland.LMZ-Landesmedienzentrum Baden Württemberg (Hrsg.) (2008). Ganztagsschule: Der kürzeste Weg zur Medienkompetenz?! Karlsruhe: LMZ.
Müller-Goebel, Andrea (2004). Medienbildung in der Ganztagsschule: Konzepte und Erfahrungen aus Rheinland-Pfalz. In: Pöttinger, Ida/Schill, Wolfgang/Thiele, Günter (Hrsg.). Medienbildung im Doppelpack. Wie Schule und Jugendhilfe einander ergänzen können. Bielefeld: AJZ-Druck & Verlag, S. 121-133.
Niesyto, Horst (2004). Öffnung von Schule und partnerschaftliche Kooperation. Zur Zusammenarbeit von schulischer und außerschulischer Medienarbeit. In: Pöttinger, Ida/Schill, Wolfgang/Thiele, Günter (Hrsg.). Medienbildung im Doppelpack. Wie Schule und Jugendhilfe einander ergänzen können. Bielefeld: AJZ-Druck & Verlag, S. 39-49.
Pöttinger, Ida (2004). Ein Netz, das trägt. Medi@Culture-Netzwerk in Baden Württemberg. In: Pöttinger, Ida/Schill, Wolfgang/Thiele, Günter (Hrsg.). Medienbildung im Doppelpack. Wie Schule und Jugendhilfe einander ergänzen können. Bielefeld: AJZ-Druck & Verlag, S. 85-93.
Pöttinger, Ida (2008). Medienbildung als Credo, Konzept oder Teil von Bildungsstandards. In: LMZ (Hrsg.). Ganztagsschule: Der kürzeste Weg zur Medienkompetenz?! Karlsruhe: LMZ, S. 13-20.
Pöttinger, Ida/Schill, Wolfgang/Thiele, Günter (Hrsg.) (2004). Medienbildung im Doppelpack. Wie Schule und Jugendhilfe einander ergänzen können. Bielefeld: AJZ-Druck & Verlag.
Schill, Wolfgang (2008). Integrative Medienerziehung in der Grundschule. Konzeption am Beispiel medienpädagogischen Handelns mit auditiven Medien. München: kopaed.Schneider-Weber, Karin (2008). Kooperationen. Netzwerke mit außerschulischen Partnern. In: LMZ (Hrsg.). Ganztagsschule: Der kürzeste Weg zur Medienkompetenz?! Karlsruhe: LMZ, S. 49-52.
Schorb, Bernd (2001). Medien oder Kommunikation – wofür soll sich Kompetenz entfalten? In: Medienimpulse. 9/2001, 36, S. 12-21.
Spanhel, Dieter (2004). Chancen und Barrieren einer Kooperation von Jugendmedienarbeit und Schule aus pädagogischer Sicht. In: Pöttinger, Ida/Schill, Wolfgang/Thiele, Günter (Hrsg.). Medienbildung im Doppelpack. Wie Schule und Jugendhilfe einander ergänzen können. Bielefeld: AJZ-Druck & Verlag, S. 26-38.
Tulodziecki, Gerhard (2007). Was Schülerinnen und Schüler im Medienbereich wissen und können sollen – Kompetenzmodell und Bildungsstandards für die Medienbildung. In: Medienimpulse. 15/2007, 59, S. 24-35.
Tulodziecki, Gerhard/Herzig, Bardo (2002). Computer & Internet in Schule und Unterricht. Medienpädagogische Grundlagen und Beispiele. Berlin: Cornelsen Scriptor.
Tulodziecki, Gerhard/Herzig, Bardo/Blömeke, Sigrid (2004). Gestaltung von Unterricht. Eine Einführung in die Didaktik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Tulodziecki, Gerhard/Six, Ulrike (2000). Medienerziehung in der Grundschule. Grundlagen, empirische Befunde und Empfehlungen zur Situation in Schule und Lehrerbildung. Opladen: Leske + Budrich.
Beitrag aus Heft »2009/01: Medienpädagogik in Ganztagsschulen«
Autor: Gerhard Tulodziecki
Beitrag als PDFEinzelansichtIda Pöttinger, Günther Anfang: Editorial
Die Tendenz, dass in Deutschland immer mehr Ganztagsschulen eingerichtet werden, wird von Medienpädagoginnen und -pädagogen mit Freude wahrgenommen. Sie hoffen, dass sich dadurch die Chance erhöht, Medienpädagogik endlich in den Schulalltag integrieren zu können.Tatsächlich ist im Zuge der Ganztagsschuldiskussion in vielen Ländern Bewegung in die Förderung von Medienkompetenz gekommen: Einige Bundesländer investieren in die Zusammenarbeit von schulischen und außerschulischen Partnern, andere feilen an Standards zur Ergänzung von Bildungsplänen, wieder andere gründen Abteilungen, die gezielte Angebote an Schulen machen. Es tut sich etwas in der Medienbildungslandschaft, auch in Bezug auf die Stimmung.In den letzten Jahren erschienen sowohl auf Portalen als auch auf dem Fachbuchmarkt unzählige Projektbeschreibungen, Handreichungen und Medienmodule, die sich mehr oder weniger in Schule und Unterricht integrieren ließen. Während früher vor allem die außerschulische Medienpädagogik führend war, was Innovation und Kreativität anbelangt, so haben sich mittlerweile auch für den schulischen Bereich Neuerungen eingestellt. Die Beschreibungen sind so gut, dass sie auch Lehrkräften umsetzbar erscheinen. Auch die Angst, dass nur ausgewiesene Technikfreaks Medienprojekte an Schulen durchführen können, ist dank mehrjähriger Erfahrung der Lehrkräfte am eigenen PC einer größeren Gelassenheit gewichen. Für jeden ist in den Veröffentlichungen etwas dabei: Ob man nun den Zweiten Weltkrieg mit Medien plastischer darstellen möchte, ob man Arbeitsblätter zur Honigbiene braucht oder ob man Medien an sich thematisieren möchte. Jede und jeder findet im Netz oder bei Verlagen das, was sie oder er braucht. Das motiviert zumindest jene, die das Thema Medienkompetenz auf ihre Agenda gesetzt haben. Nicht immer kommt der Ruf nach Medienpädagogik an Ganztagsschulen aus der Ecke der Medieninteressierten. Einige Lehrkräfte haben das Potenzial von Medien in Bezug auf selbstgesteuertes Lernen mit Medien entdeckt. Die scharfe Trennung zwischen Mediendidaktik und Medienerziehung lässt sich nicht mehr aufrechterhalten. Der Umgang mit Medien wie PC und Internet zog eine Erosion des lehrerzentrierten Unterrichts mit sich. Und, auch wenn es manche nicht glauben, nicht allen Lehrkräften gefällt der Frontalunterricht. Sie genießen es, wenn Schülerinnen und Schüler selbständig in Gruppen arbeiten und eifrig nach eigenen Lösungen suchen. Es ist ihnen auch kein Dorn im Auge, wenn sie sich etwas beibringen lassen müssen und die kreative Gestaltung des Endprodukts einen Stellenwert einnimmt. Die Erkenntnis, dass Medienwissen zur Allgemeinbildung gehört, teilt vermutlich mittlerweile ein Großteil der Lehrkräfte.
Ein ähnliches Aufweichen der Fronten zwischen Schule und außerschulischer Bildung ist in Bezug auf Kooperationen zu beobachten. Nicht nur (aber auch) wegen Sparmaßnahmen oder dem Nicht-Vorhanden-Sein öffentlicher Mittel sind beide Partner mehr und mehr gezwungen, Kooperationen einzugehen. Das Gerangel um Eigenständigkeit ist einer praktisch, pragmatischen Sichtweise gewichen: Während anfangs versucht wurde, Kinder und Jugendliche im Rahmen von Nachmittagsangeboten in die Jugendhäuser zu lotsen, hat sich herausgestellt, dass es einfacher ist, die Geräte statt der Personen zu transportieren. Umgekehrt erkennen Schulen an, dass Medienpädagoginnen und -pädagogen nicht einfach durch Lehrkräfte oder billiges Hilfspersonal zu ersetzen sind. Eines der wichtigsten Argumente für die Integration von Medienpädagogik in Ganztagsschulen ist, dass Schülerinnen und Schüler damit ein Angebot erhalten, bei dem sie Selbstwirksamkeit erfahren, das sie motiviert und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung nachhaltig stärkt. Nicht das Wissen über die Funktionsweise von Medien spielt immer die entscheidende Rolle. Gerade in der Pubertät sind Experimente mit Ausdrucksmitteln und Identitätssuche entscheidend. Das Beispiel einer Brennpunkt-Hauptschule, in der mehrere Videokurse eingeführt wurden, zeigt, dass Gewalt auf Schulhöfen durch die vielfältigen Möglichkeiten der Medien zur Selbstdarstellung fast vollständig verschwand.Das entscheidende Argument vieler Planer von Ganztagsschulen ist, dass es endlich genügend Zeit gibt, um sich einem so wichtigen Thema wie Medienkompetenz zu widmen. Zwar gibt es noch eine Menge Verfechter von medienabstinenten Schulen, der Großteil der Menschen, die sich mit Zukunft und Bildung beschäftigen, wissen jedoch, dass zur Wahrnehmung eigener Interessen, zu einer vernünftigen Argumentationskultur, kurz zur Demokratie ein großer Fundus an Wissen über Medien gehört.Sowohl die Planer von Ganztagsschulen als auch Medienpädagoginnen und -pädagogen sollten in Zeiten des Umbruchs – also jetzt! – ihre Chance nutzen.
Die Politik in Deutschland ist in Bezug auf Ganztagsschulen sehr uneinheitlich. Umso genauer sollte man sich Modelle ansehen, die anderen Bundesländern besonders gut gelungen sind. Eine Auswahl innovativer Ideen wird in diesem Heft vorgestellt. Im einleitenden Artikel weist Gerhard Tulodziecki zunächst darauf hin, dass mit der zunehmenden Zahl von Ganztagsschulen vor allem die zeitlichen Bedingungen für eine Umsetzung der Medienbildung verbessert werden konnten. Allerdings bedarf es seiner Ansicht nach Standards für die Medienbildung, um sie auch in der notwendigen Breite und Tiefe an Ganztagsschulen umsetzen zu können. Eine ähnliche Ansicht vertritt Jürg Fraefel, der fordert, dass Schulen ihr jeweiliges Profil schärfen müssen. Eine Schule, die sich der Medienbildung verschrieben hat, muss somit Medien systematisch in den Unterricht und in die schulischen Handlungsfelder integrieren. Nur so kann gewährleistet werden, dass Medienbildung auch in allen Facetten an der Schule Fuß fasst und das Profil der Schule gestärkt wird. Wie Medienbildung konkret umgesetzt werden kann, zeigt das Beispiel der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK). Unter dem Titel „Landesmedienanstalt goes Ganztagsschule“ beschreibt Katja Friedrich, Geschäftsführerin von medien+ bildung.com (m+b.com), einer Tochtergesellschaft der LMK, wie in Rheinland-Pfalz Medienbildung im Bildungsalltag verankert werden konnte. Einen anderen Weg beschritt das Bundesland Baden-Württemberg mit seinem Schüler-Medienmentoren-Programm (SMEP), den Ida Pöttinger, Karin Zinkgräf und Karin Schneider-Weber beschreiben. SMEP ist ein Projekt, das Schülerinnen und Schüler befähigt, an der eigenen Schule selbst Kurse zu Medienthemen anzubieten. Im Laufe eines Schuljahres erhalten sie Einblicke in multimediale Technik und außerdem das pädagogische Rüstzeug, eigene Arbeitsgemeinschaften zu leiten. Die Erfahrung zeigt, dass 75 Prozent der Schülerinnen und Schüler im darauffolgenden Jahr selbst aktiv werden. Ein weiteres Projekt, das bundesweit vom Verein Schulen ans Netz e. V. erprobt wurde, stellt schließlich Daniela Bickler vor. Unter dem Motto „Freie Lernorte – Raum für mehr“ haben sich 60 Schulen aus ganz Deutschland auf den Weg gemacht, das Potenzial (neuer) Medien für Schule und Unterricht mit dem Mehr an Zeit an Ganztagsschulen zu verbinden. Aus der anfangs vagen Idee von ‚Freien Lernorten’ als attraktive Medienräume im Schulalltag wurde mehr: Entstanden ist ein ganzheitlicher pädagogischer Ansatz, der konsequent die Schülerin bzw. den Schüler als Gestalter des eigenen Lernprozesses in den Vordergrund rückt. Damit wird Schule nicht nur inhaltlich in Bezug auf die Einbindung von Medien umgestaltet, sondern auch pädagogisch in Form von selbstbestimmtem Lernen. In diesem Sinne, denken wir, kann Medienpädagogik an der Ganztagesschule eine Menge verändern. Wir hoffen, die Beispiele geben dazu einige Anregungen.Medienpädagogik in Ganztagsschulen: Ihre Meinung, Ihre Erfahrungen ... diskutieren Sie mit im neu eingerichteten Forum.
Beitrag aus Heft »2009/01: Medienpädagogik in Ganztagsschulen«
Autor: Ida Pöttinger, Günther Anfang
Beitrag als PDFEinzelansicht
spektrum
Esther Willbrandt, Martina Schoch: täxt - Die Jugend-Literatur-Community
Lese- und Schreibfähigkeit sind Grundvoraussetzungen für die aktive, partizipatorische Teilnahme an unserer Wissensgesellschaft. Immer mehr Jugendliche geben jedoch elektronischen Medien den Vorrang vor dem Buch. Eine erfolgreiche Leseförderung muss sich diese Freizeitinteressen der Jugendlichen zu Nutze machen. In Kooperation mit bundesweiten Partnern plant das Literaturhaus Bremen eine Online-Community, die Jugendliche spielerisch mit Literatur in Kontakt bringt und sie ermutigt, selbst sprachgestalterisch tätig zu werden.Literatur:Bamberger, Richard (1975). Zum Lesen verlocken. In: Die Grundschule. Braunschweig: WestermannHurrelmann, Bettina/Becker, Susanne/Nickel-Bacon, Irmgard (2006). Lesekindheiten. Familie und Lesesozialisation im historischen Wandel. Weinheim: Juventa.Landherr, Karl (1996). Das Kinder- und Jugendbuch in der Schule. Didaktische und methodische Grundlegung; Unterrichtsmodelle für Grundschule und Hauptschule, Sekundarstufe 1. 3. überarb. Aufl. Donauwörth: Auer.Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) (2007). JIM-Studie 2007. Jugend, Information, Multi-Media. Stuttgart.Stiftung Lesen (Hrsg.) (1996). Lesen. Grundlagen, Ideen, Modelle zur Leseförderung. Mainz.Stiftung Lesen (2006). Leseförderung auf Augenhöhe mit den Jugendlichen? Forschungsdienst Lesen und Medien, 28/2006.
Beitrag aus Heft »2009/01: Medienpädagogik in Ganztagsschulen«
Autor: Esther Willbrandt, Martina Schoch
Beitrag als PDFEinzelansichtBjörn Friedrich, Tobias Brutscher: gamePLAYtheater: Machinima und Schauspielkunst
Eine multimediale Theateraufführung, deren Handlung mit eigens dafür animierten Machinimas verknüpft war: Das war die Ergebnispräsentation des theater- und medienpädagogischen Projekts gamePLAYtheater von Pfalztheater Kaiserslautern und medien+bildung.com. Die Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer hatten sich eine virtuelle Welt erschaffen, in der sie dann agierten. Das Bühnengeschehen wurde abwechselnd von den Schauspielerinnen und -schauspielern und ihren Avataren dargestellt.
Literatur:
Baacke, Dieter (1996). Medienkultur – Jugendkultur, oder: Neue Mischverhältnisse. In: AG Interaktiv (Hrsg.) (2004). Leitziel Medienbildung. Zwischenbilanz und Perspektiven. München: kopaed.
Schumacher, Irene (2008). Machinima Filme drehen mit Computerspielen. In: Lauffer, Jürgen/Röllecke, Renate (Hrsg.). Berühmt im Netz? Neue Wege in der Jugendhilfe mit Web 2.0. Bielefeld: GMK, S. 98-108.
Beitrag aus Heft »2009/01: Medienpädagogik in Ganztagsschulen«
Autor: Björn Friedrich, Tobias Brutscher
Beitrag als PDFEinzelansichtMarkus Decker: Killerspiele im Hörsaal?
Wie werden Computerspiele von Lehramtsstudierenden eingeschätzt? Um diese Frage zu beantworten, wurde 412 Studierenden der Universität Siegen ein Fragebogen vorgelegt, in dem sie Fragen zu Besitz, Nutzung, Einschätzung und Kenntnisstand beantworten sollten. Schwerpunktmäßig werden hier zwei Fragen beleuchtet: Wie schätzen die Studierenden ausgewählte Aussagen zu Computerspielen ein? Inwieweit haben die Studierenden eigene Spieleerfahrungen?
Literatur:
Feierabend, Sabine/Klingler, Walter (2003). Lehrer/-innen und Medien 2003. Nutzung, Einstellungen, Perspektiven, Baden-Baden: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest.
Feierabend, Sabine/Rathgeb, Thomas (2006). JIM 2006 – Jugend, Information, (Multi-)Media. Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland, Stuttgart: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest.
Feierabend, Sabine/Rathgeb, Thomas (2007). KIM-Studie 2006. Kinder und Medien Computer und Internet. Basisuntersuchung zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger in Deutschland, Stuttgart: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest.
Spitzer, Manfred (2005). Vorsicht Bildschirm! Elektronische Medien, Gehirnentwicklung, Gesundheit und Gesellschaft, 2. Aufl., Stuttgart: Klett.
Beitrag aus Heft »2009/01: Medienpädagogik in Ganztagsschulen«
Autor: Markus Decker
Beitrag als PDFEinzelansichtThorsten Lorenz, Cornelia Glaser: Schrift als Medium. Typografie und Lesen im medialen Wandel
Unser modernes Text- und Lektüreverständnis beginnt im 12. Jahrhundert. Eine Autonomie der Lesenden und des Lesens wird durch neue Schrifttechnologien inszeniert. Unter dem Einfluss des Buchdrucks und der Zeitungen steuern typografische Gestaltungen die Lesenden später durch Informationsfluten. Heute werden die schriftkundigen Leserinnen und Leser möglicherweise an moderne Leseapparaturen verloren, die sich selbst lesen. Die Geburt, Steuerung und möglicherweise der Verlust einer Lesekultur stehen im Mittelpunkt einer Mediengeschichte der Schrift und ihrer Leserevolutionen unter dem Druck von Typografie und Bildschirm.
Literatur:
Andree, Martin (2005). Archäologie der Medienwirkung. Faszinationstypen von der Antike bis heute. München: Fink.
Blackwell, Lewis (2004). Schrift als Experiment. Typografie im 20. Jahrhundert. Basel: Birkhäuser Verlag. (Orig. 2004: 20th Century Type. London: Laurence King Publishing; 2nd edition).
Blum, Joachim/Bucher, Hans-Jürgen (1998). Die Zeitung: Ein Multimedium. Textdesign – ein Gestaltungskonzept für Text, Bild und Grafik. Konstanz: UVK Medien.
Giesecke, Michael (1991). Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien. Frankfurt: Suhrkamp.
Illich, Ivan (1991). Im Weinberg des Textes. Als das Schriftbild der Moderne entstand. Frankfurt am Main: Luchterhand.
Kittler, Friedrich/Roch, Axel (1996). Beam me up, Bill. Ein Betriebssystem für den Schreibtisch und die Welt. In: M/T/G – Medien/Theorie/Geschichte. Zeitschrift des DFG-Forschungsprojekts Theorie und Geschichte der Medien, Nr. 1 www.hydra.umn.edu/kittler/bill.html [Zugriff: 3.8.2008].
Kittler, Friedrich (2002). Schrift und Bild in Bewegung. In: Kittler, Friedrich. Short Cuts. Frankfurt: Zweitausendeins, S. 89-106.
Umbreit, Astrid (2003). Syntax. Die Neuauflage einer klassischen Schrift für Linotype Library. In: Typo PAGE. Sonderausgabe der PAGE. Digitale Gestaltung und Medienproduktion, S. 144-151.
Beitrag aus Heft »2009/01: Medienpädagogik in Ganztagsschulen«
Autor: Thorsten Lorenz, Cornelia Glaser
Beitrag als PDFEinzelansichtCarlo Avventi: Über die Missachtung einer Kunst
Obwohl der Film als Leitmedium des 20. Jahrhunderts gilt, dessen Akzeptanz und Wirkung vor allem auf Jugendliche unbestritten ist, führt er im Bildungsbereich und insbesondere in der Schule im Vergleich zu anderen Künsten wie Literatur, Musik oder Bildender Kunst ein Schattendasein. Woran liegt das? Welche Auswege gibt es aus der Filmbildungsmisere? Mit diesen Fragen setzt sich das folgende Plädoyer für die Achtung der Siebten Kunst auseinander.Literatur:Bergala, Alain (2006). Kino als Kunst. Filmvermittlung an der Schule und anderswo. Marburg: Schüren.Holighaus, Alfred (Hrsg.) (2005). Der Filmkanon. 35 Filme, die Sie kennen müssen. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung (bpb).Lauffer, Jürgen/Röllecke, Renate (Hrsg.) (2008). Dieter Baacke Preis Handbuch 3. Mit Medien Bilden. Der Seh-Sinn in der Medienpädagogik. Konzepte – Projekte – Positionen. Bielefeld: Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK).Niesyto, Horst (Hrsg.) (2006). film kreativ. Aktuelle Beiträge zur Filmbildung. München: kopaed.Vision Kino GmbH – Netzwerk für Film- und Medienkompetenz (Hrsg.) (2008). Schule im Kino. Tipps, Methoden und Informationen zur Filmbildung. Praxisleitfaden für Lehrkräfte. www.visionkino.de [Zugriff: 15.01.2009].Internetquellewww.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragterfuerKulturundMedien/Medienpolitik/Filmfoerderung/KulturellesFilmerbe/kulturelles-filmerbe.html [Zugriff: 15.01.2009]
Beitrag aus Heft »2009/01: Medienpädagogik in Ganztagsschulen«
Autor: Carlo Avventi
Beitrag als PDFEinzelansicht
medienreport
Sabine Bonewitz: "mec - der Medienpädagogische Erzieher/innenclub" - ein rheinland-pfälzisches Modellprojekt
„Computer, Fernsehen, Medienwelt,das ist es, was uns kids gefällt.Doch wichtig ist’s, das zu verstehenund RICHTIG damit umzugeh’n.Der mec erklärt uns WIE und WAS,er macht uns medienfit – und SPASS!!“Solche kreativen Ideen entwickeln Kinder, wenn sie spielerisch an medienpädagogische Themen herangeführt werden. Dieses Kurzgedicht haben Vorschulkinder vom „Haus des Kindes“ in Stadecken-Elsheim (Rheinhessen) verfasst und im Rahmen der mec-Auftaktveranstaltung im November 2008 in Mainz vorgetragen. In dieser Kita, einer von zehn sogenannten Konsultationskitas, die es verstreut in ganz Rheinland-Pfalz gibt, wird Medienarbeit großgeschrieben. Das ist nicht die Regel und es gibt immer noch Einrichtungen der Kindertagespflege, die einer aktiven Medienarbeit eher skeptisch gegenüber stehen.Der neu gegründete mec – Der medienpädgogische Erzieher/innenclub will hier Aufklärungsarbeit leisten und allen rheinlandpfälzischen Kitas Anleitungen für die praktische Medienarbeit mit Kindern im Vorschulalter zur Verfügung stellen.
Medien gehören zum Kinderalltag
Er unterscheidet sich in vielen Dingen von dem vergangener Zeiten – der Kinderalltag von heute. Es stehen weniger bzw. andere Spielräume zur Verfügung, in vielen Familien sind beide Elternteile berufstätig und eine Vielzahl von Medien übt eine große Anziehungskraft auf Kinder aus und beeinflusst ihren Tagesablauf: Computer, Fernsehen, Handy, Radio, i-Pod und auch Zeitschriften und Bücher. Mit großer Begeisterung wird gesurft, gespielt, gechattet, ferngesehen und auch gelesen – und am liebsten alles gleichzeitig. Diese Veränderungen spiegeln sich auch im Kita-Alltag wider und fordern von den pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Fachwissen im Umgang mit diesen Medien. Dabei spielt die Divergenz der unterschiedlichen Medien eine große Rolle. Entscheidend ist – und da sind sich alle Pädagoginnen und Pädagogen landauf und landab einig, dass Kinder den richtigen Umgang mit allen Medien lernen, je früher desto besser. Damit das gut gelingt, brauchen die Kinder medienkompetente Erwachsene.
Der mec und sein medienpädagogisches Angebot für die Praxis
Genau hier setzt der neu gegründete mec an, dessen offizieller Startschuss am 17. November 2008 in Mainz fiel. Gemeinsam mit medien+ bildung.com, einer Tochtergesellschaft der LMK (Rheinlandpfälzische Landeszentrale für Medien und Kommunikation), die den mec unterstützt, bietet die Stiftung Lesen diesen Service für Erzieherinnen und Erzieher an. Manfred Helmes, Direktor der LMK Rheinland-Pfalz meint zu dem neuen Projekt: „Angebote zur Orientierung in einem unübersichtlichen Mediendschungel für pädagogisches Fachpersonal und alle an der Erziehung von Kindern und Jugendlichen Beteiligten sind wichtige Bestandteile eines umfassend verstandenen Jugendmedienschutzes. Dieser gehört zu den Kernaufgaben der LMK. Darum unterstützen wir sehr gerne den mec, der genau hier ansetzt“.Dezentral und wohnortnah werden im Rahmen dieses einmaligen Netzwerkangebotes pädagogischen Fachkräften in Zusammenarbeit mit Fachberatungen und Weiterbildungsträgern Fortbildungsseminare angeboten. In mehr als 40 Kursen zu zehn verschiedenen Themenkomplexen können interessierte Erzieherinnen und Erzieher im kommenden Jahr ihr medienpädagogisches Know-how vertiefen und erweitern. Die Seminare sind vom rheinland-pfälzischen Bildungsministerium als zertifizierte Qualifizierungsmaßnahme anerkannt und gefördert.
Neben praktischen Anregungen zur Arbeit mit den Medien Fernsehen, Video und Computer, gibt es auch einen Schwerpunkt zur (Vor-)Leseförderung. Denn Bücher eignen sich besonders, um kleine Kinder auch in ihrer sprachlichen Entwicklung zu fördern. Ein Bilderbuch lädt zum Dialog ein, beim Vorlesen tauschen sich Vorlesende und Zuhörende aktiv aus, sprechen über das, was im Buch passiert. Dieser Aspekt liegt besonders der Stiftung Lesen am Herzen, die seit 20 Jahren Leseförderung für Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen betreibt. Somit ergänzen sich die beiden mec-Kooperationspartner gut: Der eine deckt den kreativen Umgang mit den audiovisuellen Medien ab und der andere richtet sein Augenmerk auf die Literacy-Erziehung. Ein vierteljährlicher mec-Newsletter, der über aktuelle Themen der frühkindlichen Bildung informiert, und die Homepage www.mec-rlp.de, die viele Infos zu den Themen „Medienpädagogik“ und „Medienerziehung“ vorhält, runden das Angebot ab. Alle rheinland-pfälzischen Erzieherinnen und Erzieher können kostenfrei Mitglied im mec werden und Materialien zu Literacy und Medienpädagogik erhalten. Ein wissenschaftlicher Beirat begleitet das Projekt.
Am mec interessierte Erzieherinnen und Erzieher aus Rheinland-Pfalz können sich gerne bei Birgid Dinges oder Sigrid Strecker melden. Kontakt: Birgid Dinges/Sigrid Strecker; mec – Der medienpädagogische Erzieher/innen Club; c/o Stiftung Lesen; Römerwall 40; 55131 Mainz; Dinges@medienundbildung.com; Sigrid.Strecker@stiftunglesen.de
Beitrag aus Heft »2009/01: Medienpädagogik in Ganztagsschulen«
Autor: Sabine Bonewitz
Beitrag als PDFEinzelansichtTilmann P. Gangloff: Werteverfall im Dschungelcamp?
Im Januar hat RTL neue Staffeln seiner beiden ebenso umstrittensten wie erfolgreichsten Formate gestartet: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! und Deutschland sucht den Superstar. Gerade Dieter Bohlens unsensible Bewertungen der mitunter allerdings in der Tat völlig talentfreien Darbietungen haben DSDS nicht nur in Verruf gebracht, sondern auch den Jugendschutz herausgefordert. RTL musste wegen mehrfacher Verstöße ein Bußgeld in Höhe von 100.000 Euro bezahlen. „Beleidigende Äußerungen und antisoziales Verhalten werden in dem TV-Format als Normalität dargestellt. So werden Verhaltensmodelle vorgeführt, die Erziehungszielen wie Toleranz und Respekt widersprechen. Das kann auf Kinder desorientierend wirken“, findet Wolf-Dieter Ring, Vorsitzender der Kommission für Jugendschutz (KJM).
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor schädlichen Medieninhalten müsse Vorrang vor Gewinnmaximierung haben; das sei keine Frage des Geschmacks. Auch Maya Götz, Leiterin des Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen (München), hält Sendungen wie Ich bin ein Star ... oder DSDS gerade hinsichtlich der Wertevermittlung für problematisch: „Bestimmte Dinge werden ganz selbstverständlich als bewundernswert herausgestellt. Gerade im Dschungelcamp bekommen ‚Leistungen’ einen Wert, die weder sinnvoll noch zukunftsfähig für Kinder und Jugendliche sind. Für sie ist eine medienkompetente Diskussion besonders schwer: weil niemand die grundlegende Frage nach dem Sinn stellt oder zum Boykott aufruft, sondern sich alle bloß mit Leidenschaft über Details aufregen.“Immerhin hat sich RTL reumütig gezeigt und versprochen, die Casting-Folgen künftiger DSDS-Staffeln vor der Ausstrahlung der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) vorzulegen. Joachim von Gottberg, Geschäftsführer der FSF und studierter Theologe, hat ohnehin erhebliche Zweifel an der Theorie des Werteverfalls: „Ältere Generationen denken dauernd, der Jugend kämen die Werte abhanden. Aber Jugendliche stellen in der Pubertät alle Werte in Frage, das gehört quasi zum entwicklungspsychologischen Standard zivilisierter Gesellschaften.“ Die Rolle des Fernsehens sieht er dabei sogar positiv: „Medien sind Werteagenturen.
Sie stellen verschiedene Fälle von gefühltem Werteverlust vor und zwingen uns als Publikum, uns zu positionieren.“ Gerade das Privatfernsehen provoziere zur öffentlichen Diskussion, weil es immer wieder Dilemmata präsentiere. Bei DSDS zum Beispiel sei dies das Dilemma zwischen innerer und äußerer Moral: „Viele der DSDS-Kandidaten sind völlig untalentiert. In unserer inneren Bewertung würden wir genauso urteilen wie Bohlen. Aber es ist etwas anderes, das dem Betroffenen ohne Umschweife ins Gesicht zu sagen. Darüber empören wir uns.“ Als Zuschauerin oder Zuschauer ist man also gezwungen,darüber nachzudenken, wie man mit Menschen umgehen soll, die sich offenkundig völlig überschätzen. Untersuchungen haben dieses Dilemma bestätigt: Man empfindet gleichzeitig Schadenfreude und Mitgefühl. Diese Gefühlsambivalenz, sagt der FSF-Chef, zwinge das Publikum zur Reflektion. Außerdem erlebten Jugendliche Menschen wie Bohlen ständig: in der Familie, in der Schule, in der Lehre. DSDS sei für sie in gewisser Weise also eine Simulation des Alltags, was unter anderem den Erfolg des Formats erkläre.
Den Erwachsenen wiederum biete das Konzept die Möglichkeit, ihren eigenen Stil auf einer Metaebene zu hinterfragen: „Ihnen wird vor Augen geführt, wie es wirkt, wenn man mit jungen Menschen etwas rauer umspringt.“Beide Sendungen, Ich bin ein Star ... wie auch DSDS, haben für Joachim von Gottberg, der seine Haltung zu dem Thema ausführlich in dem Buch „Verlorene Werte?“ erläutert, jedoch nichts mit Jugendschutz zu tun: „Wir kommen kaum weiter, wenn wir solche Sendungen mit Verboten bekämpfen, schließlich werden keine Grundrechte verletzt.“ Trotzdem begrüßt er es, dass sich Menschen über die Formate empören: „Wäre das nicht der Fall, müsste man sich um die moralische Verfasstheit der Deutschen Sorgen machen.“
Beitrag aus Heft »2009/01: Medienpädagogik in Ganztagsschulen«
Autor: Tilmann P. Gangloff
Beitrag als PDFEinzelansichtElisabeth Jäcklein: Von Mut, Tapferkeit, Zusammenhalt - und einem kleinen Wunder
Kaum sind die Schrecken des Zweiten Weltkrieges im Osten Polens im Jahr 1944 vorüber und die wenigen Überlebenden beginnen, ihr Leben in den zerstörten Dörfern neu aufzubauen, da passiert das Unfassbare: Mehr als tausend Menschen, Juden, tauchen wie aus dem Nichts auf, laufen zerlumpt, ausgelaugt, aber lebend einfach aus den nahen Wäldern. Doch es sind keine Geister, wie viele vermuten. Es sind Flüchtlinge, die sich in den Wäldern versteckten, dort drei Jahre lang ausharrten und wie durch ein Wunder überlebten.Die Geschichte beginnt 1941, als deutsche Soldaten in Osteuropa einfallen und unter den Juden dort ein schreckliches Massaker anrichten. Drei Brüder, Asael, Zus und Tuvia Bielski flüchten sich in die nahen Wälder, verstecken sich unter Büschen und hinter Bäumen, um den Soldaten zu entkommen. Doch sie bleiben nicht lange allein, immer mehr Menschen erfahren von den Brüdern und gesellen sich zu ihnen, ihre Gruppe wächst. Mit der Zeit entsteht eine Gemeinschaft von hunderten, schließlich über 1.000 Menschen, sie bauen sich Hütten im Wald, stehlen Essen von nahen Bauernhöfen, besorgen sich Waffen und ziehen immer weiter rastlos durch den Wald, immer auf der Flucht vor den Nazis. Die Geschichte ist so wahr wie unfassbar und war doch lange unbekannt. Erst Regisseur Edward Zwick verfilmte den Überlebenskampf der Bielski-Brüder in Defiance, der am 5. März auch in den deutschen Kinos zu sehen ist.
Die tapferen Überlebenden sind dabei hochkarätig besetzt: Daniel Craig mimt Tuvia Bielski, den charismatischen Anführer der versteckten Juden, Liev Schreiber gibt Zus Bielski, den etwas jüngeren, rabiateren Bruder und Jamie Bell ist Asael, der jüngste im Bunde. Während ihres gemeinsamen Überlebenskampfes durchleben die Charaktere dabei die ganze Bandbreite der Gefühle. Von der Freude über ihre Rettung bis zur Verzweiflung und Resignation angesichts der nahenden Feinde, von Freundschaft und Liebe im Lager bis zu Konkurrenzkämpfen unter den Brüdern und Hass unter den Flüchtlingen, von ausgelassenen Feiern und guten Zeiten bis Todesangst, Krankheit und Hunger. Schließlich siegen aber immer der Überlebenswille, Gemeinschaftsgefühl und Tapferkeit, so dass die Gruppe auch noch so widrigen Umständen trotzen, noch so übermächtige Hindernisse besiegen und den noch so starken Feind vertreiben kann.
Dass der Film dabei dick aufträgt, mit Special Effects, pathetischer Musik und dramatischen Szenen nicht geizt, ist kaum verwunderlich, schließlich lädt das Thema ja geradezu dazu ein. Ein tapferer Krieger am Rande seiner Kräfte, ein blutüberströmter deutscher Soldat oder ein gebrochenes, weinendes Mädchen weniger hätte auch gereicht – womöglich hätte weniger filmische Dramatik die tatsächliche Unfassbarkeit der Geschichte noch betont.
Doch auch so ist das Publikum gebannt und ungläubig. Aus der Flut der Weltkriegs-Dramen, die so oft sehr stereotyp daher kommen, hebt sich dieser Film hervor. Und bietet sich damit auch geradezu an, das Thema etwa in der Schule einmal von einer etwas anderen Seite zu beleuchten. Gerade für ältere Schülerinnen und Schüler, die von der „Weltkriegsthematik“ oft schon überflutet sind und die auch mit schockierenden Eindrücken umgehen können, dürfte dieser Film eine gute Möglichkeit sein, das Interesse am Thema neu zu wecken.
Aber auch um den Vergleich mit anderen ‚Helden’ dieser Zeit wie Sophie Scholl oder Anne Frank zu ziehen, ist der Film gut geeignet. Jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer dagegen können von der Dramatik des Filmes, besonders von den blutigen oder bedrohlichen Szenen und ihrer Realitätsnähe leicht überfordert und geängstigt werden.Im Ganzen also sicher ein sehenswerter Film über Mut, Zusammenhalt und Tapferkeit. Nicht unbedingt überragend in seiner Gestaltung, aber faszinierend in seiner Geschichte, die ganz wahr und doch ganz anders ist – und dem Kinopublikum ein bisschen Glauben an ein Wunder zurück gibt.
Defiance
USA 2008
Regie: Edward Zwick
Darsteller: Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell, Alexa Davalos, Allan Corduner, Mark Feuerstein
Produktion: Edward Zwick und Pieter Jan BruggeVerleih: Constantin Film
Beitrag aus Heft »2009/01: Medienpädagogik in Ganztagsschulen«
Autor: Elisabeth Jäcklein-Kreis
Beitrag als PDFEinzelansichtDie Wilden Hühner – Der Club der schlauen Köpfe. CD-ROM, Win 2000/XP/Vista; Mac OS X. Nach der Buchvorlage von Cornelia Funke. Hamburg: Oetinger, 2008, 9,95 €
Rechtzeitig zum Start des dritten (und letzten) Kinoabenteuers mit Cornelia Funkes Wilden Hühnern erscheint nicht nur Thomas Schmids Roman mit Filmbildern oder eine CD mit poppigen Bandenhits, auch die Website wildehuehner.de präsentiert sich in frischem Gewand und mit aktuellen Angeboten. Außerdem legt Oetinger eine neue Wilde-Hühner-CD-ROM mit 16 Denk- und Geschicklichkeitsspielen vor. Der Club der schlauen Köpfe bietet nicht nur preiswerten Spielspaß im Medienverbund, sondern trainiert – ganz im Stil von Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging – die geistige Fitness in verschiedenen Disziplinen. Gefragt sind logisches Denken, Reaktionsvermögen, Kurzzeitgedächtnis, Sprachverständnis und Mathematik. Jede Spielaufgabe kennt drei Schwierigkeitsstufen und bringt das Huhn auf der Spielübersicht mit jedem erreichten Level der Ziellinie ein Stück näher. Über einen Menüpunkt kann sogar der „Trainingsfortschritt“ in Form einer Verlaufsgrafik angezeigt werden. Passend zum Thema gibt es ein Bild-Sudoku mit Kleidungsstücken aus Melanies Garderobe oder eine Tetris-Variante mit bunten Perlen aus ihrem Schmuckkästchen. Codeknacker versuchen Sprotte und Freds geheime Liebesbotschaften zu entschlüsseln oder machen sich am ausgeklügelten Drehmechanismus zu schaffen, der das Baumhaus der Pygmäen vor unliebsamen Eindringlingen schützt. Ein entlaufenes Huhn soll mit geschickter Mausführung zurück in Oma Slättbergs Hof bugsiert, ein anderes durch strategische Spielzüge mit möglichst vielen Körnern aufgefüttert werden. Auch Zahlenjongleure kommen auf ihre Rechnung, beispielsweise wenn es darum geht, bei einem Kauf auf dem Flohmarkt möglichst rasch das korrekte Wechselgeld zu bestimmen oder in einer Rechenaufgabe fehlende Ziffern und Operationszeichen zu ergänzen. Im Gegensatz zur CD-ROM Gestohlene Geheimnisse (vgl. merz 5/2005) oder dem NintendoDS-Spiel Die Wilden Hühner und die Jagd nach dem Rubinherz (vgl. merz 4/2008) sind die einzelnen Spielaufgaben hier nicht durch eine spannende Rahmenhandlung zu einem Abenteuer verknüpft, sondern stehen im virtuellen Spielmagazin von Anfang an zur Verfügung. Einzig das vierte Spiel jeder Kategorie wird erst freigeschaltet, wenn die ersten drei Aufgaben wenigstens angespielt wurden. Im Club der schlauen Köpfe gibt es zwar keinen Multiplayer-Modus, in dem Spielerinnen und Spieler direkt gegeneinander antreten können, aber es besteht doch die Möglichkeit, seinen persönlichen Punktestand laufend zu verbessern und sich dank individueller Logins mit anderen zu messen. Auf jeden Fall brauchen Spielerinnen und Spieler ab zehn Jahren viel Geschick, Konzentration und Ausdauer, wenn sie alle Einzelspiele über drei Level meistern wollen. Anders als bei der ersten Wilde Hühner-CD-ROM, wo als Belohnung eine Urkunde und ein Zugangscode für eine geheime Website winkte, muss man sich diesmal am Schluss jedoch mit einem einfachen Glückwunsch zufrieden geben.
Die Zeitdetektive – Montezuma und der Zorn der Götter. Folge 12, Hörbuch; Gesamtspielzeit: 01:14:27; JUMBO-Verlag, 10,95 €
Die Zeitdetektive, das sind der kluge Julian, der sportliche Leon und die schlagfertige Kim, stets begleitet von der rätselhaften, ägyptischen Katze Kija. Die vier Freunde haben ein Geheimnis: Sie besitzen den Schlüssel zu der alten Bibliothek im Benediktinerkloster St. Bartholomäus, wo der unheimliche Zeit-Raum „Tempus“ verborgen liegt. Von hier aus reisen Julian, Kim, Leon und Kija auf den Spuren von Verbrechern durch die Zeit. „Tempus“ pulsiert im Rhythmus der Zeit und hat tausende von Türen, hinter denen sich jeweils ein Jahr der Weltgeschichte verbirgt. Und auch wenn ihre Zeitreisen mehrere Tage dauern, ist in der Gegenwart keine Sekunde vergangen. Also bleiben die geheimnisvollen Reisen der vier Freunde stets unentdeckt. Julian, Kim und Leon interessieren sich sehr für die Geschichte und lösen bei ihren Reisen in die Vergangenheit so manchen mysteriösen Kriminalfall. Die Zeitdetektive ist eine Buchreihe des deutschen Schriftstellers Fabian Lenk. Die Bücher, die für Leserinnen und Leser ab neun Jahren empfohlen sind, begeistern auch als Hörbücher jung und alt. So auch die 12. Folge der drei Jungdetektive Montezuma und der Zorn der Götter. Mit geheimnisvoller Stimme zieht Stephan Schad die Hörerinnen und Hörer in den Bann der Krimigeschichte aus dem Reich der Azteken. Gekonnt verleiht er den einzelnen Akteuren mittels verschiedener Stimmvariationen Ausdruck und schafft so einen Wiedererkennungswert der Charaktere für die Zuhörenden. Die einfache und verständliche Sprache erleichtert das Zuhören auch bei dieser Folge: Nach einer Faschingsfeier, auf der Julian als Aztekenherrscher Montezuma II. erschienen war, wollen die Zeitdetektive das Geheimnis um dessen Herrschaftssymbole lüften. Wie bedeutend waren die Kopilli Quetzalli, die heilige Federkrone des Montezuma und das goldene Herz als Symbol seiner Macht tatsächlich? Gewappnet mit einigen Informationen zu den Azteken aus Büchern der Bibliothek beschließen die Freunde der Sache vor Ort auf den Grund zu gehen. Also reisen Julian, Kim, Leon und die Katze Kija wieder mit Hilfe des Zeit-Raum „Tempus“ – diesmal in die Hauptstadt der Azteken, nach Tenochtitlán. Doch die Zeitreisen der vier Freunde sind alles andere als ungefährlich. Auch im Tenochtitlán des Jahres 1510 nach Christus herrschen raue Sitten und die Zeitdetektive entgehen nur knapp einem schlimmen Schicksal. Aber sie finden auch schnell neue Freunde, was den Abschied umso schwieriger macht. Bei den Hochzeitsfeierlichkeiten des Aztekenherrschers Montezuma II. geschieht eine Katastrophe. Durch das Verschwinden des goldenen Herzens, dem Machtsymbol des Herrschers, droht die gute Stimmung im Volk zu kippen. Ohne das goldene Herz kann Montezuma II. seine Herrschaft über das Volk der Azteken verlieren. Sind die Götter ihm nicht mehr gnädig? Aber die Spürnasen der Zeitdetektive haben schnell einen Verdacht und helfen am Schluss das Rätsel zu lösen. Im Rahmen der beeindruckenden Indiziensuche der Superkombinierer Julian, Kim, Leon und der Katze Kija finden sich zügig Hinweise, Tatmotive und sogar ein Zeuge. Fast schon beiläufig und inmitten der Rätselsuche werden zahlreiche historische Informationen interessant dargestellt, so dass das Geschichtswissen überhaupt nicht schwer im Magen liegt. Aber aufgepasst – genaues Zuhören ist trotz allem erforderlich. Einerseits um des Rätsels Lösung vielleicht sogar schneller als die Zeitdetektive zu finden und andererseits um die historischen Zungenbrecher-Begriffe verstehen zu können. Neben den ausführlichen Erklärungen innerhalb der Erzählung, die eine gute Verständlichkeit fördern, finden die Hörerinnen und Hörer noch mal alle historische Randinformationen und ein Zungenbrecher-Glossar zum Nachlesen im Booklet. Die Zeitdetektive – Montezuma und der Zorn der Götter ist ein spannendes Hörerlebnis, das sich wie die gleichnamigen im Ravensburger Verlag erschienenen Bücher auch für junge Leserinnen und Leser ab neun Jahren eignet. Aber auch für erwachsene Hörbuchliebhaber ist es ein prickelnder Ohrgenuss gespickt mit Geschichtsnachhilfestunden.
publikationen
Schäfer, Horst (2008). Kinder, Krieg und Kino. Filme über Kinder und Jugendliche in Kriegssituationen und Krisengebieten. UVK Verlag, Konstanz. 254 Seiten, 29 €
Mitten in Los Angeles gibt es eine Filiale des Pentagons: weil die amerikanische Regierung schon lange weiß, welche Vorteile die enge Zusammenarbeit mit Hollywood hat. Bislang hat das Verteidigungsministerium nur in ideologischer Hinsicht von der Kooperation mit Hollywood profitiert: In Kriegszeiten konnte stets gewährleistet werden, dass die Filmindustrie für den nötigen patriotischen Rückhalt sorgte. Das Institut für Kreative Technologie aber hat andere Aufgaben: Gewissermaßen als Abfallprodukt der Video- und Computerspiele-Industrie werden neue virtuelle Ausbildungstechniken für Soldaten kreiert. Mit Paul Virilios Klassiker „Krieg und Kino“ gibt es natürlich schon ein Standardwerk zu dieser Thematik. Horst Schäfers Ausführungen stellen jedoch eine höchst sinnvolle Weiterführung dar. Zwar führt auch er ausführlich (und keineswegs bloß ergänzend) in die Materie ein, indem er die vielfältigen Verknüpfungen von Krieg und Kino referiert, doch die Erweiterung von Virilios Titel durch den Begriff „Kind“ gibt dem Buch eine völlig andere Ausrichtung. Schäfer schildert allerdings nicht, was Kriegsfilme mit Kindern machen, welche möglichen Wirkungen sie also haben können. Sein Augenmerk gilt Filmen, in denen Kinder und Jugendliche mitwirken, sei es in Dokumentationen, die es auch schon zum Ersten Weltkrieg gab, oder in Spielfilmen späterer Jahrzehnte. Dabei pickt er sich beispielhafte Werke heraus, um sie eingehend zu betrachten und zu analysieren. Das Spektrum umfasst das gesamte vergangene Jahrhundert. Der Zweite Weltkrieg nimmt naturgemäß einen besonderen Stellenwert ein, doch auch die Kriege der jüngeren Zeit haben ja ihre Reflektion im Film gefunden. Die Arbeit, kann man sich lebhaft ausmalen, wird kein Zuckerschlecken gewesen sein, und auch die Lektüre ist nicht gerade das reine Vergnügen; erst recht nicht, wenn die Fantasie prompt die entsprechenden Bilder produziert. Die am Krieg Beteiligten, schreibt Schäfer im Resümee, werden immer jünger, die Einschläge immer kürzer und dichter; eines der letzten Kapitel zuvor galt den Kindersoldaten. Bewusst persönlich und plakativ schlägt der Filmjournalist und Medienpädagoge die Brücke vom Zweiten Weltkrieg in die Gegenwart: Je mehr Filme man zu diesem Thema sehe, desto größer werde „der Hass auf diese grau-braune Soße“, die als Neonazi-Propaganda in Form von CDs mit rechtsradikaler Musik oder von der NPD finanzierten kostenlosen Schülerzeitungen erneut kursiere. Von enormem Wert gerade für die Jugendarbeit ist der knapp neunzig Seiten lange Anhang, in dem Schäfer eine Vielzahl von Filmen, thematisch sortiert, einzeln bespricht und bewertet. „Liebe macht blind“, schreibt er abschließend, aber die Liebe zum Kino öffne die Augen.
Hallermayer, Evi (2008). Filme analysieren – Kulturen verstehen. Über Akira Kurosawas „Yojimbo“ und seine beiden Remakes „ Per un pugno di dollari“ und „Last man standing“. UVK Verlagsgesellschaft: Konstanz 2008, 548 Seiten, 49€
Angesichts der Aktionen der Vision Kino bundesweit die Filmerziehung an den Schulen zu verankern, erlebt die Filmanalyse zur Zeit gerade ein kleines Comeback. Im Mittelpunkt der im Rahmen der Filmerziehung durchgeführten Filmanalysen stehen dabei aber in erster Linie Literaturverfilmungen, die im Rahmen des Deutschunterrichts besprochen und für unterrichtliche Zwecke verwertet werden. Schade eigentlich, da Filmanalyse mehr sein könnte als nur Literaturanalyse im neuen Gewand. Welche Möglichkeiten in der Filmanalyse stecken, zeigt ein Buch von Evi Hallermayer auf, die an Hand von drei Filmklassikern des populären Kinos sehr anschaulich verdeutlicht, wie dieselbe Geschichte in den Kulturen Japans, Italiens und der USA völlig unterschiedlich aufbereitet werden kann. Analysiert werden dabei die Filme Yojimbo von Akira Kurosawa, ein Klassiker des japanischen Films und dessen berühmte Remakes Per un pugno di dollari (Für eine Hand voll Dollar) von Sergio Leone und Last man standing von Walter Hill. Während Yojimbo die Geschichte auf der Grundlage der japanischen Kultur erzählt, erfährt der Stoff in der italienischen und amerikanischen Verfilmung jeweils neue Dimensionen in Bezug auf die Darstellung von Helden und von Frauen, auf das Verständnis von Gewalt sowie auf den zugrunde gelegten Moralbegriff. Vor allem der japanische Film wird dabei von europäischen Rezipienten häufig nicht verstanden. So zeigt Evi Hallermayer auf, dass japanische Filme nach westlichem Ermessen ausgesprochen brutal anmuten, da detaillierte Szenen physischer Gewalt ungekürzt angeboten werden. Dies ist nur dann zu verstehen, wenn man weiß, dass in einer hoch regulierten Gesellschaft wie der japanischen, solche Szenen als gesellschaftlich anerkanntes Ventil funktionieren, um aus dem repressiven System kurzzeitig auszubrechen. Auch muten japanische Filme westlichen Rezipientinnen und Rezipienten sehr grausam an, da sie menschliche Härte sehr drastisch thematisieren. Im japanischen Kontext ist dies jedoch anders zu interpretieren, da Individuen erst im Leiden ihre wahre innere Größe demonstrieren können. Ganz anders der Italowestern, der sich in den 60er Jahren im Rahmen der Anti-Vietnam-Proteste und des gesellschaftlichen Umfelds der Studentenbewegung als gewalttätiger und nihilistischer Filmstil entwickelt hat. Anders als in Amerika, dem Land in dem beharrlich der Optimismus propagiert wird, ist der Pessimismus das vorherrschende Prinzip der italienischen Western. Amerikanische Werte, Träume und Mythen werden somit auch folgerichtig mit Füßen getreten und parodiert. Der pessimistischen und lebensfeindlichen Umwelt entsprechend, bevölkern auch groteske, zynische und amoralische Figuren das Setting dieser Filme. In dieser brutalisierten Welt spielen Frauen kaum eine Rolle. Sie sind lediglich Opfer des brutalen Umfelds. Im amerikanischen Actionfilm des Hollywood-Block-Buster-Kinos schließlich steht vor allem der menschliche Körper im Vordergrund. Die Schauspieler sind deshalb auch häufig Bodybuilder oder Körperdarsteller, weshalb diese Filme auch ‚Body-Pictures’ oder ‚Body-Pics’ genannt werden. Die Protagonisten kokettieren mit ihrer körperlichen Kraft und vermitteln auf diesem Weg das Bild des vermeintlich ‚harten Mannes’. Politische Themen werden in diesen Werken nur an der Oberfläche thematisiert. Während in Yojimbo der Held ein japanischer Samuraikämpfer ist, der mit dem Schwert kämpft und trotz westlich beeinflusster Charakterzüge typisch japanische Züge trägt, verkörpert in Per un pugno di dollari der Protagonist die Figur eines Antihelden, der als Zyniker und Nihilist das Gegenteil des strahlenden amerikanischen Westernhelden darstellt. Als typisch amerikanischer Kleinganove während der Prohibitionszeit ist der Held von Last man standing auszumachen. Aufgrund der herrschenden maroden Umstände weiß er, dass er nicht besser sein kann als der Rest dieser von Gangstern bevölkerten Welt. Dennoch wird er nicht zum Nihilisten, wie die Helden im japanischen und italienischen Film, sondern verkörpert den Mythos des harten Mannes, in dessen Innerstem die Werte der amerikanischen Gesellschaft verankert sind. Diese Erkenntnisse, die Evi Hallermayer im Rahmen einer Dissertation erworben hat, sind sehr aufschlussreich und werden von der Autorin im Rahmen einer umfassenden Analyse des japanischen, italienischen und amerikanischen Films erarbeitet. So setzt sie sich zu Beginn des Buches sowohl mit der Geschichte des japanischen Films, des Italo-Westerns und des amerikanischen Actionfilms auseinander, als auch mit den Regisseuren Akiro Kurosawa, Sergio Leone und Walter Hill. In ihren praktischen Ausführungen gelingt es ihr, die Unterschiedlichkeiten der drei Filme differenziert herauszuarbeiten und dadurch dem Leser einen Einblick in die Kulturen Japans, Italiens und der USA zu geben. Filme zu analysieren kann somit hervorragend dazu beitragen, unterschiedliche Kulturen zu verstehen. Für den Umgang mit Film im Rahmen des Schulunterrichts wäre das doch mal eine echte Herausforderung, weshalb ich Lehrerinnen und Lehrern aber auch allen Medienpädagoginnen und -pädagogen dieses Buch wärmsten empfehle.
Brehm, Anton (2006). Elternabend. Modelle für die Praxis. Freiburg: Lambertus-Verlag, 173 S., 22 €
Wie gestalte ich einen Elternabend zum Thema Fernsehen, Werbung, Internet oder Handy? Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher oder anderweitig pädagogisch Engagierte, die vor einer dieser Fragen stehen, können sich von Elternabend inspirieren lassen. Anton Brehm stellt darin in der Praxis erprobte Elternabendmodelle sowohl mit medienpädagogischen als auch mit pädagogisch-psychologischen und religionspädagogischen Inhalten vor.Die unterschiedlichen Themen, wie: „Macht Fernsehen dick, dumm und gewalttätig?“ rollt der Autor je wie folgt auf: Zuerst gibt Brehm einige Tipps zur Vorbereitung des anstehenden Elternabends. Im Anschluss daran macht er konkrete Vorschläge zur Durchführung. Dabeiverweist er auch auf zum Thema passende Materialien und zusätzlich hilfreiche Literatur. Brehms Grundanliegen ist dabei immer der Erfahrungsaustausch der Eltern untereinander.
Aus diesem Grund möchte er stets alle Besucherinnen und Besucher eines Elternabends aktiv in die Bearbeitung der jeweiligen Thematik einbinden, dementsprechend praxisbetont fallen seine Veranstaltungsentwürfe aus. Da die Beispielelternabende teilweise aber doch recht komplexe Themengebiete der Pädagogik und Psychologie berühren, wird es für die Referentin oder den Referenten nicht leicht sein, den potenziellen Fragen der Eltern nur mit Hilfe der von Brehm angebotenen inhaltlichen Vorschläge gerecht zu werden. Deswegen wird man bei der Vorbereitung eines Elterngesprächs mit entsprechender Thematik nicht umhin kommen, Informationen über den Elternabend hinaus einzuholen. Trotz alledem kann Elternabend aber eine gute Orientierungshilfe zum Einstieg in die jeweilige Materie sein.
von Gottberg, Joachim/Prommer, Elizabeth (Hrsg.) (2008). Verlorene Werte? Medien und die Entwicklung von Ethik und Moral. UVK Konstanz 2008. 262 Seiten, 24 €
Privatsender leben unter anderem davon, Aufmerksam zu erregen. Ohne Aufmerksamkeit keine Zuschauerinnen und Zuschauer, ohne Publikum keine Werbeeinnahmen. Damit hängt es zusammen, dass sie gern zu drastischen Mitteln greifen und Menschen über Monate hinweg in einen Container sperren: der systematische Tabubruch als Garant für Schlagzeilen und hohe Marktanteile. Tatsächlich aber profitiert auch die Gesellschaft; dies ist zumindest die Quintessenz der Aufsatzsammlung „Verlorene Werte?“, die sich mit dem Einfluss der Medien auf die Entwicklung von Ethik und Moral befasst. Mit Hilfe von Tabuverstößen und Grenzverletzungen würden tradierte Werte in Frage gestellt. Erkenne die Gesellschaft, dass die Norm durchaus ihre Berechtigung habe, gehe sie sogar noch gestärkt aus diesem Prozess hervor; andernfalls bleibe sie auf der Strecke. Verfassungsrechtlich geschützte Grundwerte wie die Menschenwürde, das Recht auf körperliche Unversehrtheit oder auf freie Entfaltung würden ohnehin nicht berührt. Innerhalb dieses Verhältnissen von Freiheit und Grenzen aber, schreiben die Herausgeber, seien die Regeln einem dynamischen Wandel unterworfen. Dieser Prozess wiederum werde von den Medien begleitet. Die Beiträge des Buches befassen sich grundsätzlich mit der Entstehung von Werten (auch unter Berücksichtigung neuester Erkenntnisse der Hirnforschung) und untersuchen sowohl abstrakt wie auch konkret die Rolle der Medien. tpg
Streich, Sabine (2008). Videojournalismus. Ein Trainingshandbuch. Konstanz: UVK, 276 S., 50 Abbildungen, 24,90 €
Sabine Streich gilt als eine der Pionierinnen des Videojournalismus in Deutschland. Im Gefolge des US-Inspirators dieser Bewegung im audiovisuellen Journalismus, Michael Rosenblum, engagiert sich die Filmemacherin seit etwa zehn Jahren für die Verbreitung des Videojournalismus auch hierzulande. Verständlich, dass sie daher vor allem die Chancen jenes ‚Journalismus aus einer Hand’ in den Mittelpunkt ihres ausführlichen Trainingshandbuches stellt. Ihre Schrift geht im Hauptteil zwölf Niveaustufen (Levels) durch, die weitgehend aufeinander aufbauen. Das entspricht auch der didaktischen Absicht von Sabine Streich, ihre Leserschaft als künftige Videojournalisten (VJs) systematisch fortzubilden. Nach der Einführung von Rosenblums vielzitierter „5-Shot-Technik“ (derzufolge die VJs alle Sequenzen drehen sollten in jenen fünf Einstellungen des „Was“ (Großaufnahme der Tätigkeit), des „Wer“ (Nahaufnahme der Hauptperson), des „Wo“ (Orientierung durch totalere Horizontbildung), einer Verbindung von „Was“ und „Wer“ (zumeist als Perspektivwechsel über die Schulter) und schließlich einer individuell-besonderen Einstellung in Richtung des „Warum“ der Sequenz (auch Wow- oder Beauty-Shot genannt)) geht Streich in enger Verzahnung von Inhalt und Gestaltung viele wichtige Bereiche eines Weges zum VJ sehr handlungsorientiert durch, durchaus sinnvolle Teil-Wiederholungen eingeschlossen.
Dabei steht eine starke Orientierung am Story-Telling im Mittelpunkt, also am Erzählen einer möglichst emotionalen Geschichte darüber, wie eine nah dargestellte Person ein konkretes, sichtbares Problem löst. Da der Videojournalismus hier sicherlich eine seiner Stärken hat, ist diese Konzentration kaum zu beanstanden – leider fehlt daneben aber eine angemessene Reflexion über etwaige Grenzen narrativen Vermittelns. Gelegentlich klingt immerhin anekdotisch an, dass der VJ seinem Protagonisten nicht zu nahe kommen sollte.
Das Buch ist eines zum Lesen (und nicht zum Hören oder Bilder-Anschauen) und deshalb ist es sehr ärgerlich, in welch schlechter Rechtschreibung, Grammatik und zum Teil auch Ausdruck das Werk erschien. Zumal laut Einband ein Lektorat stattgefunden haben soll. Unglaublich vor allem Kommasetzung sowie Groß- und Kleinschreibung – aber auch Wiederholungen oder Verdrehungen nicht nur von Wörtern, sondern ganzen Satzteilen fallen ins Auge. Es wirkt teilweise, als habe die Autorin den Text auf Band gesprochen, und ein Nicht-Muttersprachler habe ihn dann in groben Zügen transkribiert: „… da wir langweilen und als Zuschauer schnell“ (S. 166). Das ‚versendet’ sich leider nicht. Inflationäre und sinnlose Anglizismen wie ‚Look’ oder ‚Sinn machen’ fallen dann kaum noch negativ ins Gewicht. Auch inhaltlich zeugen Sätze wie „Filmstudenten interessieren sich immer gerne für Obdachlosenstorys“ (S. 162) von Oberflächlichkeit.Strukturell noch schwerwiegender aber bleiben zwei Kritikpunkte: Sabine Streich erwähnt nur einmal im Vorübergehen „das Problem der Kosten“ (S. 130) und erweckt sonst den Eindruck, der Videojournalismus sei vor allem von technischen Innovationen sowie von der Kreativität der Journalistinnen und Journalisten ausgelöst und angetrieben.
Sie lässt erst ganz am Ende ihres Bandes (S. 260 f.) einen flämischen Journalisten kurz zu Wort kommen, der im vollständigen Umschalten eines Regionalsenders auf den Videojournalismus vor allem eine „Sparmaßnahme“ sieht. Dieser Problemkreis hätte – bei aller oder gerade wegen der Parteilichkeit der Autorin – eine breitere und tiefere Diskussion verdient. Dann hätten sich auch Übergänge zum zweiten nachhaltigen Kritikpunkt ergeben: Nicht nur studierte Kamerafrauen oder ausgebildete Cutter monieren den im Videojournalismus oft fehlenden (selbst-)kritischen ‚zweiten’ oder ‚dritten’ Blick auf den entstehenden Beitrag. Das wiederum mag Sabine Streich gar nicht anfechten, denn ihr Motto ist erklärtermaßen (S. 202): „VJ ist, was Sie als VJ daraus machen“. Wenn es doch so einfach wäre.
Hartung, Anja (2008). Humor im Hörfunk und seine Aneignung durch Kinder und Jugendliche. München: kopaed, 314 S., 19,80 €
Wer Kinder und Jugendliche als Rezipientinnen und Rezipienten gewinnen möchte, der tut gut daran, ihnen lustige Unterhaltung zu präsentieren. Das zeigen zahlreiche Studien zum Medienverhalten von Heranwachsenden. Auch im Radio haben komische Figuren, Comedy, satirische Beiträge … ihren Platz und auch die Moderation sollte möglichst witzig sein. Die Autorin hat sich in ihrer Dissertation mit der Frage beschäftigt, wie komische Inhalte im Hörfunk von Kindern und Jugendlichen im Alter von acht bis Jahren wahrgenommen und bewertet werden.
Besonderes Augenmerk schenkt sie dabei dem Aspekt, was (noch) als lustig betrachtet wird und was die Mädchen und Jungen als geschmacklos, beleidigend … ansehen, also wo für sie die Grenze zwischen Humor und Gewalt liegt. Dafür setzt sie sich zunächst mit dem Humor-Begriff und seiner Bedeutungsveränderung im Laufe der Zeit auseinander. Im empirischen Teil arbeitet sie anhand einer Programmanalyse und einer Kommunikatorbefragung die Inszenierungsstrategien des Hörfunks sowie die (subjektiven) Humortheorien von Radiomoderatorinnen und -moderatoren heraus um sich anschließend mit der Perspektive der Heranwachsenden auf das komische Angebot im Radio zu beschäftigen.
Es zeigt sich, dass jüngere Kinder Komik im Hörfunk am ehesten mit ‚Comedy’ verbinden, für ältere Jugendliche ist diese stärker mit den Moderatorinnen und Moderatoren verknüpft, in deren Sprüchen, Gags und Scherzen sie nach Anregungen für ihre eigene Alltagskommunikation suchen. Die Heranwachsenden finden aber nicht alles lustig. Wenn beispielsweise von ihnen geschätzte Persönlichkeiten zur Zielscheibe von Späßen werden, wird dies von ihnen auch als Beleidigung und damit als psychische Gewalt wahrgenommen. Alles in allem ist die Studie ein wichtiger Beitrag zum Verständnis der Medienaneignung von Heranwachsenden.
Pisarczyk, Siegmund (2007). Fundraising. Eine freizeitpädagogische Chance für Jugendtreffs. Hamburg: Eigenverlag, 220 S., 40 €
Diese Studie befasst sich mit Fundraising in freizeitpädagogischen Jugendtreffs. Sie richtet sich an die kommunalen Träger dieser Einrichtungen und Vereine. Für Nonprofit-Organisationen zum Beispiel Kulturhäuser e. V. ist Fundraising eine Chance und Herausforderung zugleich. Fundraising als neue soziale Bewegung bedeutet für die sozial Engagierten in den Nonprofit – Organisationen Wertschaffung. Die Realisierung dieser Wertschaffung kann durch Stiften, Spenden und Sponsern stattfinden. Fundraising kann in den freizeitpädagogischen Jugendtreffs mehrfache Funktionen übernehmen, zum Beispiel die Dialog-Funktion eines Jugendzentrums mit der freien Wirtschaft aber auch als Integrations-Motor in einem Stadtteil. Migrantinnen und Migranten (mit ausreichendem Sprachvermögen) können sich in einem Jugendzentrum oder Kulturhaus sozial engagieren, besonders in den Stadtteilen mit hoher Ausländer-Quote (zum Beispiel als Dolmetscher aber auch im Konfliktmanagement). Freizeitaktivitäten können von Einheimischen und Migranten gemeinsam in einem Jugendtreff durchgeführt werden, ebenfalls von Ehrenamtlichen betreut. Fundraising bedeutet eine Kunst des Gebens und des Nehmens. Medien können in diesem Dialog eine wichtige Aufgabe übernehmen, zum Beispiel über die Relevanz des bürgerschaftlichen Engagements im Stadtteil systematisch mit Plakaten zu informieren. Das Statement des Buches lautet: Alle Fundraising-Beteiligten handeln in einem freizeitpädagogischen Jugendtreff im Sinne eines demokratischen Dialogs und gelebter Solidarität. Der Förderkreis mit „Zeit-Spendern“ ist in diesem Buch lediglich ein Beispiel der Freiwilligkeit (auch als ökonomische Option). „Bürgerschaftliches Engagement zu fördern ist eine lohnende Investition – in Menschlichkeit, in Stabilität und Zukunftsfähigkeit unseres Gemeinwesens“, so Ursula von der Leyen, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2007. Von der Leyens Worte können als Motto des Buches dienen.
Winter, Carsten/Hepp, Andreas/Krotz, Friedrich (Hrsg.) (2008). Theorien der Kommunikations- und Medienwissenschaft. Grundlegende Diskussionen, Forschungsfelder und Theorieentwicklungen. Wiesbaden: VS-Verlag, 464 S., 34,90 €
Welche Funktionen haben Medien im sozialen Leben? Wie erklärt sich medialer und kommunikativer Wandel? Die Autoren des Bandes beschäftigen sich mit der Bedeutung der Medien samt ihrer sich weiter wandelnden Voraussetzungen für die Herstellung von Öffentlichkeit. Hintergrund des Buches ist, dass sich in den letzten Jahren die Auseinandersetzung mit theoretischen Ansätzen innerhalb der Kommunikations- und Medienwissenschaft erheblich intensiviert hat. Die Herausgeber verfolgen dabei eine doppelte Zielsetzung: Der erste Teil widmet sich der Frage nach grundlegenden theoretischen Ansätzen.
Ausgehend von dem Verständnis von einer Querschnittswissenschaft diskutiert der zweite Teil originäre Theorieentwicklungen der Kommunikationswissenschaft in deren unterschiedlichen Forschungsfeldern. Der Großteil der Aufsätze setzt auf einer gesellschaftszentrierten Ebene an, behandelt also den Einfluss sozialer Faktoren auf die Medienproduktion und umgekehrt die Funktion von Medien im sozialen Leben. So schreibt Stephan Alexander Weichert in seinem Beitrag „Krisen als Medienereignisse: Zur Ritualisierung mediatisierter Kommunikation im Fernsehen“ Medien eine tragende Rolle in der Verarbeitung von Krisen, Konflikten und Katastrophen zu. Er erklärt Gesellschaften zu Fernsehgesellschaften, welche in Krisenzeiten mit Hilfe der ritualisierten Fernsehberichterstattung in den normalen Alltag zurückfinden.
Der rund 450 Seiten dicke Band zielt darauf, einen Überblick über aktuelle Theoriediskussionen zu geben sowie zukünftige Perspektiven aufzuzeigen und ist sowohl für Studierende als auch Lehrende der Kommunikationswissenschaft und verwandter Disziplinen lesenswert.
Wijnen, Christine W. (2008). Medien und Pädagogik international. Positionen, Ansätze und Zukunftsperspektiven in Europa und den USA. München: kopaed, 268 S., 18,80 €
Christine Wijnen verfolgt in ihrer Dissertationsschrift das Ziel, Medienpädagogik im internationalen Vergleich zu betrachten. Dabei beschränkt sie sich nicht darauf, einen kurzen Blick über den Tellerrand – über die Grenzen – zu werfen. Vielmehr versucht sie eine Betrachtung der Medienpädagogik aus verschiedenen Perspektiven und eine damit verbundenen Auseinandersetzung mit unterschiedlichen kulturellen, historischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten einzelner Länder. Dabei geht sie insbesondere auf die Medienpädagogik und ihre spezifische Entwicklung in Italien, Ungarn, Schweden, Großbritannien sowie in den USA ein. Nicht zu vermeiden ist demzufolge – wie der Untertitel dann auch andeutet –, dass sich unter dem Titel „Medienpädagogik international“ ausschließlich europäische und US-amerikanische Modelle verbergen. Diese Einschränkung ist aus forschungspragmatischen Gründen sicherlich verständlich. Allerdings bleibt der Wunsch vieler Leserinnen und Leser mit Interesse an einem weltweiten Einblick in die medienpädagogische Szene damit zunächst unerfüllt. Diese Enttäuschung vermag die Autorin jedoch schnell auszugleichenen. Und zwar durch eine differenzierte Reflexion des Medienpädagogik-Begriffs im Rahmen ihrer internationalen Untersuchung. Denn in den Darstellungen der verschiedenen Schwerpunktthemen nationaler Medienpädagogiken werden gleichsam Leitlinien von einer medienpädagogischen Forschung und Praxis im historischen Überblick deutlich. Darüber hinaus leistet die Autorin eine sinnvolle und nachvollziehbare Zusammenschau einschlägiger theoretischer Begrifflichkeiten, die deren diskursiven Entstehungshintergrund mit einschließt. So werden neben der im deutschsprachigen Raum gängigen ‚Medienkompetenz’ zum Beispiel auch ‚Media Educology’, ‚Media Literacy’, ‚Media Pedagogy’ oder die ‚Media Studies’ allgemein begrifflich eingegrenzt. Eine Lektüre, sinnvoll als Impulsgeber und Übersichtswerk für alle medienpädagogisch Interessierten – vor allem für diejenigen empfehlenswert, die sich umfassend mit den theoretischen Grundlagen von Medienpädagogik befassen wollen.
kolumne
Kai Hanke: Lost in Communities
Wie sich die Zeiten ändern! Gestern haben 68er und Spontis mit ihren Kinder geübt, sich auszuziehen und – spielerisch, ganz Nackedei – ihre Scham vor der Welt und sich selbst abzulegen. Heute sieht das schon anders aus. Ausziehen gehört im konkreten wie übertragenen Sinne zum Standardprogramm der durchschnittlichen Po-Mo-Jugend. Bestes Beispiel für die Mitteilungsfreude heutiger junger und sich jung fühlender Menschen: Die verwirrende Vielfalt und begeisterte Nutzung sozialer, internetbasierter Communitys. Ein unüberschaubares Geflecht von Social Communitys bietet uns die Möglichkeit, (endlich?) allen zu zeigen, wie wir wirklich sind. Wenn wir dabei nicht durch’s Coolness-Raster rauschen, haben wir sogar gute Chancen, uns die Hauptfunktion der sozialen Online-Netzwerke zunutze zu machen: In Kontakt bleiben, Netzwerke bilden. Das ist schön, denn nun können uns alle Bekannten – seit langem in mühseliger Arbeit mehr oder weniger sensibel losgeworden – endlich wieder als Freunde „adden“. Wenn wir Glück haben, begnügen sie sich damit. Und wenn wir so richtig Glück haben, melden sich darüber hinaus auch neue, interessante Menschen bei uns, mit denen der Kontakt sich dann sogar lohnt. Doch auch so wird es kompliziert. Denn sind die kommunikationsstarken, patchwork-identitären (oder doch eher -identitischen?) Community-Junkies von heute erstmal in Netzwerken aktiv, beginnt der permanente, freiheitlich-lästige Prozess der Selbstreflexion (Wer bin ich und: wer will ich sein?). Ein bisschen über sich selbst nachzudenken hat zwar noch niemandem geschadet. Aber immer dieser Identitätszwang! Bin ich überhaupt oft genug an der Uni, um bei meiner Community richtig am Platz zu sein (hallo, studiVZ!)? Ab wann bin ich zu alt für meine Community (hallöchen, schülerVZ!)? Ist mein Leben schon zu überregional für meine Community (servus, Lokalisten!)? Fühle ich mich eher als akademische Upper-Class-Mietze (hello, facebook!) oder als proletarische Plattformerin (whazzup, MySpace!)? Und wie schick muss mein Foto sein, um doch noch einen sinnlosen Job mit unverständlichem Tätigkeitsprofil zu finden, (guten Tag, XING!)? All diese Fragen müssen geklärt sein, will man sich kompetent in Netzwerken bewegen. Freilich kann man sich auch wie die Mehrheit für die nicht-kompetente Nutzungsvariante entscheiden. In diesem Fall bleibt immerhin die Ausrede Patchwork-identität: „Ach du, weißte, ich bin so der Typ Mensch so ... ich fühle mich so facettenreich, da muss ich einfach in mehreren Netzwerken sein, so ...“ Außerdem erleben durch Social Communitys sogenannte Fake-Identitäten sogar in Zeiten der Krise eine echte Hausse. Insofern darf ja ohnehin alles nicht mehr so ernst genommen werden. Ob internationalistischer Netz-Nazi oder Konsum-Antikapitalist – Sich-ernst-nehmen war gestern. Aufpassen ist trotzdem angebracht. Wahret den Überblick! Ein Jobgesuch mit dem Nickname Bienchen223 oder der Visage von Brad Pitt macht sich ebenso unvorteilhaft wie zahllose Sondereinträge im Handy-Adressbuch zur Ultrageheimverwahrung entsprechender Community-Passwörter. Im Kopf behält sich diese Unzahl ja kaum noch jemand. So oder so – verlieren wir uns doch einfach alle in der Vielseitigkeit. Sozusagen in guten wie in schlechten Seiten. Dann stört es auch niemanden, dass nicht nur Amnesie-Betroffene vergangener Abendveranstaltungen sich vergewissern können, wirklich auf derselben Party wie man selbst beim peinlich Sein fotografiert worden zu sein. Auch zukünftige Chefinnen – ach, oder überhaupt der Rest der Community-Welt – darf ruhig einen Blick riskieren. Hereinspaziert, das bin ich beim Ausziehen. Die Offenheit frisst ihre Kinder. Wie sich doch die Zeiten ändern ...
Beitrag aus Heft »2009/01: Medienpädagogik in Ganztagsschulen«
Autor: Kai Hanke
Beitrag als PDFEinzelansicht
Ansprechperson
Kati StruckmeyerVerantwortliche Redakteurin
kati.struckmeyer@jff.de
+49 89 68 989 120
Ausgabe bei kopaed bestellen
Zurück