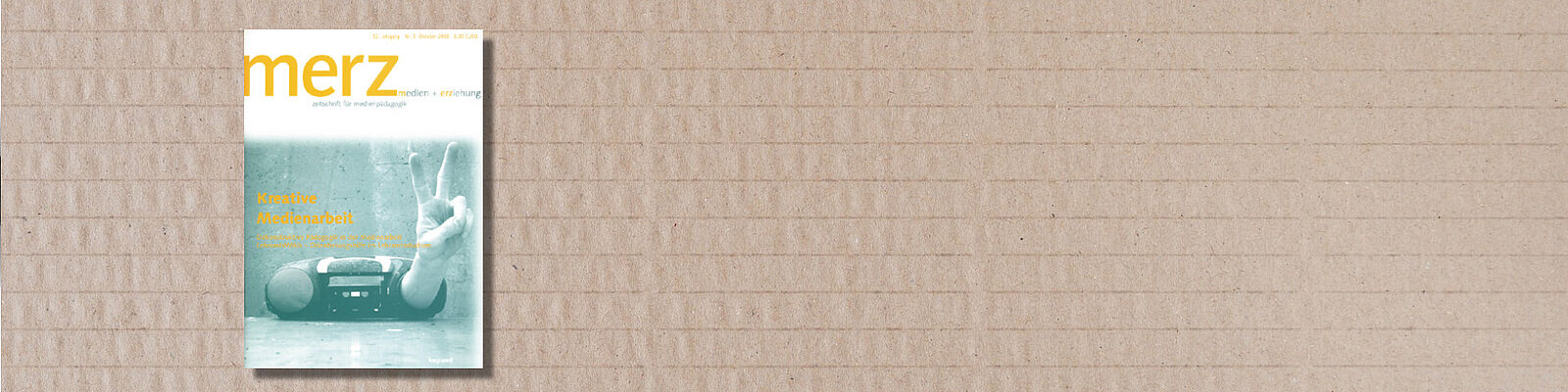2008/05: Kreative Medienarbeit
Die aktive Medienarbeit konzentrierte sich in ihren Anfängen auf die „Herstellung von Gegenöffentlichkeit“ – also darauf, alternativen (vor allem politischen) Meinungen medial Gehör zu verschaffen. Das was ausgedrückt wurde, war wichtiger als das wie. Inzwischen zielen die meisten Projekte aktiver Medienarbeit in erster Linie darauf, Jugendlichen dazu zu verhelfen, den eigenen Identitäten medial Ausdruck zu verleihen und dabei ihren spielerischen, fantasievollen Umgang mit Technologien zu fördern. Die aktive hat sich also zu einer kreativen Medienarbeit weiterentwickelt.Kreative Medienarbeit bildet jedoch keinesfalls eine medienpädagogische Domäne. Auch die künstlerisch-pädagogischen Fachbereiche – und hier in erster Linie die bildnerische Kunstpädagogik – setzen zunehmend auf die Erstellung von Medienproduktionen zur Realisierung ihrer Zielsetzungen. Daraus resultiert, dass die praktische medienpädagogische und die künstlerisch-pädagogische Arbeit immer mehr Ähnlichkeiten aufweisen. Was bedeutet das für die Weiterentwicklung dieser Disziplinen? Mit je drei Beiträgen aus der Medienpädagogik und der Kunstpädagogik und einem anschließenden Fazit soll dieser Frage in der aktuellen merz nachgegangen werden.
aktuell
nachgefragt: Michael Siebel (MdL), medienpolitischer Sprecher SPD Hessen
Die SPD in Hessen steht kurz davor, die Regierungsämter zu übernehmen. Ein Grund mehr, sich mit ihren Plänen für weitreichende Änderungen im Bildungsbereich zu befassen. Die breite Einführung von Ganztagsschulen, ein integriertes Schulsystem, mehr Gestaltungsfreiheit und Verantwortung für die Schulen, eine Plattform für Medienkompetenz und der pädagogische Ausbau offener Kanäle und Lokalradios – dies sind Aspekte, zu denen sich Michael Siebel (MdL), medienpolitischer Sprecher der SPD Hessen und Sprecher für Wissenschaft, Kunst und Medien im Landtag, äußert. Welche Veränderungen ergeben sich dadurch für die Medienpädagogik und: Sind möglicherweise neue Impulse für die schulische und außerschulische medienpädagogische Arbeit zu erwarten? merz hat nachgefragt ...
merz: Herr Siebel, die hessische SPD bringt in ihrem Regierungsprogramm 2008 ehrgeizige Ziele im Bereich der Bildungspolitik zum Ausdruck. Welchen Stellenwert hat in diesem Rahmen die Förderung von Medienkompetenz und auf welche Zielgruppen beziehen Sie sich dabei?
Siebel: Wir wollen sowohl in den Schulen als auch in der außerschulischen Bildungsarbeit verstärkt Maßnahmen der Medienkompetenz erweitern. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund notwendig, dass gerade für junge Menschen die neuen Medien in deren Kommunikation wichtig sind. Junge Menschen sehen heute nicht mehr so Fernsehen wie wir früher, sie hören nicht mehr so Radio, wie dies unsere Generation getan hat. Neben Maßnahmen der Medienkompetenz gehört zu dem Thema deshalb auch, dass die Online-Angebote in den Rundfunkanstalten genutzt werden können. Dies gilt natürlich insbesondere für den öffentlich rechtlichen Rundfunk, der im Rahmen seines Rundfunkauftrags für Information, Bildung und Kultur zuständig ist.
merz: Sie planen die Einführung eines sogenannten Forums „Medienkompetenz“. Was genau dürfen wir uns darunter vorstellen?
Siebel: Wir müssen in Zukunft die medienpädagogischen Maßnahmen bündeln und koordinieren. Die Landesanstalt für privaten Rundfunk, die Bildstellen, das Institut für Kommunikation und Medienpädagogik und die aktiven Lehrstühle an den Hochschulen, die offenen Kanäle und die nicht-kommerziellen Rundfunkanbieter – und natürlich machen nicht zuletzt unsere Schulen Angebote. Aus Medienkompetenz wird aber erst ein Schuh, wenn diese Aktivitäten auf einer Plattform gemeinsam angeboten werden und miteinander abgestimmt werden.merz Die Förderung von Ganztagsschulen, in denen auch „neue Bildungskonzepte“ zur Anwendung kommen sollen, ist ein Prestigeprojekt der SPD. Welche Perspektiven sehen Sie dabei insbesondere für medienpädagogische Arbeit in der Schule?Siebel Ganztagsschulen sind kein Prestigeobjekt der SPD, sondern sie sind mittlerweile von allen politischen Strömungen eine anerkannte Notwendigkeit. Wenn wir aus PISA lernen wollen, müssen wir Ganztagsschulen fördern und somit längeres gemeinsames Lernen ermöglichen. Wenn in der Ganztagsschule die Prinzipien exemplarischen und epochalen Lernens Wirklichkeit werden, wird in einer Schule, in der Lernen als Prozess begriffen wird, auch die medienpädagogische Arbeit ihren Raum erhalten.
merz: Bildung und Erziehung spielen sich nicht nur innerhalb der Schule ab. Welche Vorstellungen verfolgt die hessische SPD bezüglich außerschulischer Pädagogik? Wie können davon medienpädagogische Projekte profitieren?
Siebel: Gerade in der außerschulischen Jugendarbeit spielen schon jetzt medienpädagogische Ansätze eine wichtige Rolle. Dies gilt für die Arbeit in Jugendzentren ebenso wie für die Arbeit in medienpädagogischen Projekten. Die SPD zählt die Arbeit der offenen Kanäle in Hessen ebenso zu dieser außerschulischen, medienpädagogischen Arbeit wie die Angebote der nichtkommerziellen Lokalradios. Dort wird nicht nur Bürgerrundfunk gemacht, sondern auch Menschen vermittelt, wie Medien funktionieren, wie sie wirken und beeinflussen können.
merz: Ein weiterer Vorschlag ist der Ausbau offener Kanäle und nicht-kommerzieller Lokalradios zu Einrichtungen mit medienpädagogischen Angeboten. Klingt erst mal gut, ist allerdings eine Frage von Finanzierung und Personal. Wie sollen diese Grundlagen gesichert werden, und gibt es darüber hinaus auch Pläne für strukturelle Änderungen im Bereich der Medienkompetenzförderung?
Siebel: Ich möchte darauf hinweisen, dass vor wenigen Wochen ein gemeinsamer Gesetzentwurf von SPD und Bündnis 90/Die Grünen im hessischen Landtag verabschiedet wurde, in dem die finanzielle Absicherung der offenen Kanäle und der nicht-kommerziellen Lokalradios wiederhergestellt wurde. Dies war ein wichtiger Schritt, um diesen Bürgermedien die finanzielle Sicherheit wiederzugeben. Auf dieser Grundlage werden wir jetzt die weitere Entwicklung zu beobachten haben. Sollte es weitere Anträge für die Einrichtung von neuen Bürgerradios geben, wird die Landesanstalt für privaten Rundfunk zu beurteilen haben, ob dafür auch die notwendigen finanziellen Ressourcen bereitgestellt werden können.
merz: Qualitätssicherung wird derzeit überall groß geschrieben. Wie genau und durch wen wollen Sie Qualität in der Medienerziehung und -bildung sicherstellen?
Siebel: Die Qualitätssicherung muss durch einen permanenten Evaluationsprozess sichergestellt werden. Insbesondere dort, wo öffentliche Mitteln verwendet werden, ist die Qualitätssicherung wichtig und notwendig. In diesem Zusammenhang sollte auch im Bereich der Lehrerausbildung ein neuer Akzent auf die Medienerziehung gelegt werden. Es schadet sicherlich keinem Lehrer, wenn er in seiner Ausbildung mit einem Modul Medienerziehung konfrontiert ist.
Stichwort Cybermobbing
Mobbing bedeutet, jemanden über einen längeren Zeitraum hinweg zu schikanieren, zu quälen oder zu verletzen. Von Cybermobbing – gleichbedeutend wird auch der Begriff des Cyberbullying verwendet – spricht man, wenn digitale Medien dazu eingesetzt werden, jemanden längerfristig psychisch oder physisch zu belästigen. Möglichkeiten für solche Attacken bieten sich vielfältige, gerade in social communitys kann Anonymität dazu anregen, die kommunikativen Netzwerkstrukturen zu missbrauchen. Jugendliche sind fasziniert von den multimedialen Möglichkeiten und das Spiel mit Identitäten kann leicht in der Bloßstellung anderer münden. Vielfältige solcher Fälle sind aus den Medien bekannt:
Da werden Profile anderer geknackt und verändert, neue Identitäten geschaffen, um Sehnsüchte von Mitschülerinnen und Mitschülern auszunutzen, und Lehrkräfte diffamiert. Mobbing an sich ist in jedem einzelnen Fall tragisch und hochproblematisch, Cybermobbing birgt noch zusätzliche Gefahren. So muss das Mobbingopfer einerseits in Kenntnis von den Attacken geraten und falsche Einträge auf Plattformen finden oder erfundene Identitäten entschlüsseln, andererseits ist es schwierig, einmal in Umlauf gebrachte Daten wieder aus dem Verkehr zu ziehen. Datenspeicherung im Internet birgt für Mobbingopfer somit ganz spezielle Problembereiche. Pädagogische Aufgabe ist es also, Mobbing im Allgemeinen und das Verhalten im Netz im Speziellen zu thematisieren.
thema
Anja Hartung und Niels Brüggen: Experimentierräume in der kreativen Medienarbeit
Der Selbstausdruck mit Medien ist heute eine selbstverständliche Praxis jugendlichen Medienhandelns. Mit der Entwicklung der digitalen Medien verbunden ist die Entstehung vielfältiger Gestaltungsmöglichkeiten, die neue Formen des Selbstausdrucks ermöglichen und zugleich das Experimentieren provozieren. Wie Experimentierräume pädagogisch ausgestaltet werden können, um ästhetische Bildungsprozesse anzuregen, wird im Folgenden anhand der Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojekts MIXTOUR – Das Medienmobil nachgezeichnet.
Literatur
Baacke, Dieter (1997). Medienpädagogik. Tübingen: Niemeyer
Friedrich, Helmut F./Mandl, Heinz (1997). Analyse und Förderung selbstgesteuerten Lernens. In: Weinert, Franz E./Mandl, Heinz (Hg.), Psychologie der Erwachsenenbildung. Enzyklopädie der Psychologie. Göttingen: Hogrefe. S. 237-293
Peez, Georg. (2002). Praxisforschung in der Kunstpädagogik. www.georgpeez.de/texte/praxisfor.htm, [Zugriff: 07.01.2005]
Niesyto, Horst (2000). Medienpädagogik und soziokulturelle Unterschiede. Eine Studie zur Förderung der aktiven Medienarbeit mit Kindern und Jugendlichen aus bildungsmäßig und sozial benachteiligten Verhältnissen. Medienpädagogischer Forschungsverbund.
Schorb, Bernd (1995). Medienalltag und Handeln. Medienpädagogik im Spiegel von Geschichte, Forschung und Praxis. Opladen: Leske und Budrich
(merz 2008-05, S. 19-26)
Beitrag aus Heft »2008/05: Kreative Medienarbeit«
Autor: Niels Brüggen, Anja Hartung-Griemberg
Beitrag als PDFEinzelansichtBjörn Maurer und Horst Niesyto: Jugendkulturelle Symbolproduktion in Videofilmen
Die Abteilung Medienpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg führt kontinuierlich Studien zur medienpädagogischen Praxisforschung durch, die unter unterschiedlichen Frageperspektiven die Eigenproduktionen Jugendlicher und den Prozess ihres Erstellens zum Forschungsgegenstand haben (Überblick: Niesyto 2006). Einen wichtigen Stellenwert hat dabei der Aspekt der präsentativen Symbolik für jugendkulturelle Symbolproduktion.
Literatur
Cassirer, Ernst (1931). Philosophie der symbolischen Formen. Berlin: Verlag
Holzwarth, Peter (2001). Möglichkeiten und Grenzen interkultureller Kommunikation mit Video. Diplomarbeit Erziehungswissenschaft Universität Tübingen/Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
Holzwarth, Peter/Maurer, Björn (2003). Kreative Bedeutungskonstruktion im Spannungsfeld von Symbolproduktion und Symbolverstehen. In: Niesyto, Horst (2003), S. 139-168
Langer, Susanne (1987/1942). Philosophie auf neuem Wege. Frankfurt/Main: Fischer
Maurer, Björn (2004). Medienarbeit mit Kindern aus Migrationskontexten. München: kopaed
Münch, Thomas/Bommersheim, Ute (2003). Jugendliche Produktionen aus musikkultureller Perspektive. In. Niesyto, Horst (2003), S. 317-343
Niesyto, Horst (2006). Medienpädagogische Forschung auf der Grundlage handlungsorientierter Medienarbeit. In: merz, 50, Nr. 5, S. 29-37
Niesyto, Horst (Hg.) (2003). VideoCulture – Video und interkulturelle Kommunikation. Grundlagen, Methoden und Ergebnisse eines internationalen Forschungsprojekts. München: kopaed
Röll, Franz Josef (1998). Mythen und Symbole in populären Medien. Der wahrnehmungsorientierte Ansatz in der Medienpädagogik. Frankfurt/Main: Evang. Gemeinschaftswerk für Publizistik
Witzke, Margrit (2004). Identität, Selbstausdruck und Jugendkultur. Eigenproduzierte Videos Jugendlicher im Vergleich mit ihren Selbstaussagen. Ein Beitrag zur Jugend(kultur)forschung. München: kopaed
(merz 2008-05, S. 10-18)
Beitrag aus Heft »2008/05: Kreative Medienarbeit«
Autor: Björn Maurer, Horst Niesyto
Beitrag als PDFEinzelansichtCarl-Peter Buschkühle: Forschung im künstlerischen Projekt Kitsch
Künstlerische Bildung realisiert sich in künstlerischen Projekten. Deren Ziel ist es, künstlerisches Denken als achtsame Wahrnehmung, kritische Reflexion und eigenständige Imagination zu fördern. Am Beispiel von Aspekten des Projekts Kitsch als Kunst soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern in themenorientierten Auseinandersetzungen unter dem Einsatz elektronischer Medien eine Verbindung von Wissen und Gestalten hergestellt werden kann, die das künstlerische Denken befördert.
Literatur:
Carl-Peter Buschkühle (2007). Die Welt als Spiel. In: Digitale Spiele und künstlerische Existenz. Theorie und Praxis künstlerischer Bildungtheorie, 2 (Kunstpädagogik). Oberhausen: Athena-Verlag
(merz 2008-05, S. 35-43)
Beitrag aus Heft »2008/05: Kreative Medienarbeit«
Autor: Carl-Peter Buschkühle
Beitrag als PDFEinzelansichtDaniela Reimann: Interaktive Bühne und szenisches Spiel mit digitalen Medien
Die Schülerinnen und Schüler einer sechsten Hauptschulklasse haben eine interaktive Umgebung für ein szenisches Spiel sowie eine zugrundeliegende Geschichte konzipiert, entwickelt, programmiert und szenisch umgesetzt. Dabei wurden dem Ansatz von Mixed Reality-Lernräumen folgend (vgl. Reimann 2006) die Fächer Kunst, Darstellendes Spiel und Informatik im Rahmen eines multimedialen Storytelling-Szenarios integriert, das im Feld robotischer Systeme und interaktiver Ausführungen angesiedelt ist.
Literatur
Reimann, Daniela (2006). Ästhetisch-informatische Medienbildung mit Kindern und Jugendlichen in Mixed Reality-Lernräumen. Oberhausen: Athena
Turkle, Sherry (1984). Die Wunschmaschine. Vom Entstehen der Computerkultur. Reinbek: Rowohlt.
(merz 2008-05, S. 53-59)
Beitrag aus Heft »2008/05: Kreative Medienarbeit«
Autor: Daniela Reimann
Beitrag als PDFEinzelansichtGeorg Peez: „Wie wir aussehen, wenn wir nicht so aussehen, wie wir jetzt aussehen.“
In dieser Fallstudie wird das Gestalten zweier Mädchen mit einem Bildbearbeitungsprogramm im Kunstunterricht untersucht. Die qualitativ-empirische Analyse beruht auf einem Interview unter Zuhilfenahme von bildnerischen Unterrichtsergebnissen. Auf die Forschungsfrage nach Lernerfahrungen und ästhetischen Erfahrungen ergeben sich kunstdidaktische Erkenntnisse vor allem in Bezug auf die spezifische Nutzung digitaler Medien. Experimentelle Bild-Veränderungen werden gefördert. Probehandeln führt zu Flexibilisierungen im Gestaltungsprozess und erhöht die Motivation.
Literatur
Brüggen, Niels/Hartung, Anja (2007). ‚Kontextuelles Verstehen der Medienaneignung’ als Methodenansatz. In: Georg Peez (Hg.). Handbuch Fallforschung in der Ästhetischen Bildung/Kunstpädagogik. Baltmannsweiler: Schneider Verlag. S. 79-89
Marotzki, Winfried/Niesyto, Horst (Hg.) (2006). Bildinterpretation und Bildverstehen. Methodische Ansätze aus sozialwissenschaftlicher, kunst- und medienpädagogischer Perspektive. Wiesbaden: VS-Verlag für Sozialwissenschaften
Peez, Georg (2005). Evaluation ästhetischer Erfahrungs- und Bildungsprozesse. München: kopaed Peez, Georg (2008). „Weil vorher hat man das nie so gesehen.“ Janine, 6. Klasse. Empirische Unterrichtsforschung und Rekonstruktion ästhetischer Erfahrungsprozesse. In: Klaus-Peter Busse (Hg.). (Un)Vorhersehbares lernen: Kunst – Kultur – Bild. Dortmund: Dortmunder Schriften zur Kunst
Seel, Martin (2007). Die Macht des Erscheinens. Frankfurt/Main: Suhrkamp Werner, Judith (2004). „Wer bin ich?“ – Selbstporträt und Porträtdarstellung in einer integrativen 6. Klasse. In: Johannes Kirschenmann/Georg Peez (Hg.). Computer im Kunstunterricht. Donauwörth: Auer. S. 45-49
(merz 2008-05, S. 44-52)
Iwan Pasuchin und Christine W. Wijnen: WeTube. Denen zeigen wir's!
Aktuelle Anwendungen der ‚social software’ bieten zahlreiche Potenziale zur Weiterentwicklung von Ansätzen der aktiven Medienarbeit in Richtung eines Konzepts kreativer Web 2.0-Arbeit – vor allem in Bezug auf die Förderung sozial- und bildungsbenachteiligter Jugendlicher. Derzeit erfolgt an einer Hauptschule in der Stadt Salzburg im Rahmen des regulären Unterrichts die Durchführung eines wissenschaftlich begleiteten Projekts1, in dem entsprechende Modelle ausgearbeitet und in der Praxis erprobt werden.
Literatur
Borda, Orlando Fals (2002). Participatory (Action) Research in Social Theory: Origins and Challenges. In: Reason, Peter/Bradbury, Hilary (Hg.), Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice. London u.a.: SAGE
Fisch, Martin/Gscheidle, Christoph (2008). Mitmachnetz Web 2.0. Rege Beteiligung nur in Communitys. In: Media Perspektiven 7/2008. Verfügbar über: www.media- perspektiven.de/uploads/tx_mppublications/Fisch_II.pdf [zUGRIFF. 16.09.2008]
Kießling, Matthias (2008). Jugend 2.0? Der Einfluss der Bildung auf die Nutzung des Internets. In: merz | medien und erziehung. 52/2, S. 21-22
Maurer, Björn (2006). Subjektorientierte Filmbildung an Hauptschulen. In: Niesyto, Horst (Hg.): Film kreativ. Aktuelle Beiträge zur Filmbildung. München: kopaed, S. 21-44
mpfs/Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (2007). JIM-Studie 2007 – Jugend, Information, (Multi-) Media. Stuttgart: Landesanstalt für Kommunikation
Pasuchin, Iwan (2009). Web 2.0 als Brückenschlag zwischen der Pädagogik der Medien und der Künste in der Praxis kreativer Medienarbeit mit bildungsbenachteiligten Jugendlichen. In: Buschkühle, Carl-Peter/Kettel, Joachim/Urlaß, Mario (Hg.), Horizonte. Internationale Kunstpädagogik. Oberhausen: Athena-Verlag (in Druck)
Niesyto, Horst (2003). VideoCulture. Projektentwicklung und Projektergebnisse. In: Niesyto, Horst (Hg.), VideoCulture. Video und interkulturelle Kommunikation. Grundlagen, Methoden und Ergebnisse eines internationalen Forschungsprojekts. München: kopaed, S. 15-110
Niesyto, Horst (2004). Medienbildung mit Jugendlichen in Hauptschulmilieus. In: Otto, Hans-Uwe; Kutscher, Nadia (Hg.), Informelle Bildung Online. Perspektiven für Bildung, Jugendarbeit und Medienpädagogik. Weinheim; München: Juventa, S. 122-136
Schell, Fred (2003). Aktive Medienarbeit mit Jugendlichen. Theorie und Praxis. München: kopeadSchell, Fred (2008). Aktive Medienarbeit im Zeitalter des partizipativen Netzes (Interview). In: merz, 52, 2, S. 9-12
(merz 2008-05, S. 27-34)
Beitrag aus Heft »2008/05: Kreative Medienarbeit«
Autor: Iwan Pasuchin, Christine W. Wijnen
Beitrag als PDFEinzelansichtIwan Pasuchin: Fazit
Zum Abschluss des Thementeils dieses Heftes wird versucht, ausgehend von einer vergleichenden Zusammenfassung der zentralen Ansätze kreativer Medienarbeit, die in den hier publizierten Beiträgen aus den Perspektiven der Medien- und der Kunstpädagogik dargestellt wurden, einige Antworten auf die im Editorial erhobenen Fragen abzuleiten. Dieses Unterfangen ist insofern schwierig, als die Beiträge höchst unterschiedliche Ansätze innerhalb der beiden behandelten Fachbereiche beleuchten und sich da-mit bereits ‚innerdisziplinär’ einer Verallgemeinerung entziehen. Ausgehend von den präsentierten Projekten lassen sich also lediglich einige Grundtendenzen ableiten, die einander gegenübergestellt werden können.
(merz 2008-05, S. 60-64)
spektrum
Dekonstruktive Pädagogik in der sozialpädagogischen (Medien-)Arbeit
Auch wenn das Theoriegerüst des Poststrukturalismus schon seit geraumer Zeit eine wichtige Rolle in den Sozialwissenschaften spielt – Pädagoginnen und Pädagogen tun sich oftmals noch schwer, daraus Konsequenzen für die praktische Arbeit abzuleiten. Ansätze dekonstruktiver Pädagogik liefern hier eine Entwicklungsperspektive. Vor dem exemplarischen Hintergrund des Diskurses über ‚Geschlecht’ werden theoretische Annahmen dekonstruktiver Pädagogik sowie ihre Potenziale für die pädagogische Praxis insbesondere der geschlechtersensiblen Jugend(medien)arbeit dargestellt.
Weiterführende Literatur
Fritzsche, Bettina/Hartmann, Jutta/Schmidt, Andrea (Hg.) (2001). Dekonstruktive Pädagogik. Erziehungswissenschaftliche Debatten unter poststrukturalistischen Perspektiven. Opladen: Leske+Budrich
Glaser, Edith/Klika, Dorle/Prengel, Annedore (Hg.) (2004). Handbuch Gender und Erziehungswissenschaft. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt
Krabel, Jens/Schädler, Sebastian (2001). Dekonstruktivistische Theorie und ihre Folgerungen für die Jungenarbeit. In: Heinrich Böll Stiftung (Hg.), Dokumentation der Fachtagung Alles gender? oder was? – Theoretische Ansätze zur Konstruktion von Geschlecht(ern) und ihre Relevanz für die Praxis in Bildung, Beratung und Politik, Berlin, S. 35-43 (www.boell.de/alt/downloads/gd/ReiheGD-1Gender_1.pdf [Zugriff: 29.09.2008])
Pat-Ex Autorenkollektiv (2004). Die Ressource der männlichen Identität – identitätskritische Perspektiven in Gender Trainings. In: Netzwerk Gender Training (Hg), Geschlechterverhältnisse bewegen – Erfahrungen mit Gender Training. Königstein: Ulrike Helmer Verlag, S.71-88
(merz 2008-05, S. 71-78)
Sandra Boltz und Andrea Geisler: Das LehramtsWiki an der Universität Duisburg-Essen
Um den Lehramtsstudierenden der Universität Duisburg-Essen (UDE) die Orientierung an der Universität und das Studium zu erleichtern, entstand die Idee zur Schaffung eines zentralen Online-Serviceportals mit gebündelten Informationen rund um das Lehramtstudium. Das Portal wurde als ‚social software’ in Form eines Wikis kreiert. Es wird skizziert, wie sich der Prozess von der Bedarfsanalyse bis zum Start des LehramtsWikis gestaltete.
Literatur:
Danowski, Patrick/Jansson, Kurt/Voß, Jakob (2007). Wikipedia als offenes Wissenssystem. In: Dittler, Ulrich/Kindt, Michael/Schwarz, Christine (Hg.), Online-Communities als soziale Systeme. Münster 2007, S. 17-26
Güntheroth, Horst/Schönert, Ulf (2007). Wie gut ist Wikipedia? Der Stern testet das größte Internet-Lexikon der Welt. Stern, 50, S. 30-44
Kerres, Michael/Nattland, Axel (2007). Implikationen von Web 2.0 für das E-Learning. In: Gehrke, Gernot (Hg.), Web 2.0 – Schlagwort oder Megatrend? Düsseldorf 2007, S. 37-53
O’Reilly, Tim (2005). What is Web 2.0? Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. Übersetzt von Patrick Holz online unter: www.distin-guish.de/?page_id=36 [Zugriff: 13.05.08].
Richter, Alexander/Koch, Michael (2007). Social Software – Status quo und Zukunft. Technischer Bericht Nr. 2007-01. www.unibw.de/wow5_3/forschung/social_ software/ [Zugriff: 19.05.2008].
(merz 2008-05, S. 65-70)
Beitrag aus Heft »2008/05: Kreative Medienarbeit«
Autor: Sandra Boltz, Andrea Geisler
Beitrag als PDFEinzelansicht
medienreport
Michael Bloech: Virtuelle Helden im Film - Boxer 3D
Ob Shrek oder Captain Buzz Lightyear aus dem Film Toy Story, computeranimierte Filmhelden sind aus der heutigen Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken. Und wer wollte nicht schon einmal wissen, wie so ein Filmheld im Computer entsteht? In der 40-minütigen, technisch anspruchsvoll gestalteten Computeranimation Boxer 3D von Pierre Lachapelle versuchen die hypergestylte, schlangenhaft synthetische Moderatorin Maria und der korpulente, glatzköpfige Phil dieses komplexe Thema auf verständliche Weise den Zuschauerinnen und Zuschauern zu vermitteln. Ganz nach dem Motto „die Schöne und das Biest“ werden die beiden Moderations-Kunstfiguren präsentiert. Das Setting einer klassischen Fernsehshow wird zwar ironisch gebrochen, aber dennoch bleibt das Duo zu sehr den bekannten Medien-Vorbildern und entsprechenden Klischees verhaftet. Hier ist ein wenig zu spüren, dass sich Boxer 3D, wie viele actiongeladene, computergenerierte Animationsfilme, an ein vornehmlich männliches, technikbegeistertes Publikum wenden möchte. Ausgangspunkt der Erklärungen des virtuellen Moderationsduos bilden mit dem Computer gezeichnete Polygone, also Vielecke, die zusammen als Gitternetz über einen virtuellen Körper gelegt werden. Im nächsten Schritt wird das Gitterbild der Polygone geglättet, mit Farben und Strukturen überzogen, Bewegungen von realen Schauspielern über Messpunkte kopiert, auf die Polygonstruktur übertragen und schon ist eine Computer-Figur, ein kleiner junger Boxer, scheinbar zum Leben erweckt. All dies wird beeindruckend locker und unterhaltend für ältere Kinder bzw. Jugendliche erläutert.
Auf technischen Firlefanz wird dabei bewusst verzichtet, um vor allem das Prinzip der Computeranimation eines Darstellers und die Schritte von der Planung bis zur fertigen Animation durchschaubar zu machen. Im zweiten Teil von Boxer 3D wird dann ein amüsanter Kurzspielfilm präsentiert, der die zuvor konstruierte Person des Boxers in Aktion zeigt. Konkret wird eine Geschichte nach dem ‚David gegen Goliath’-Muster geboten, angesiedelt in einer Boxarena der 30er Jahre. Der vorlaute und schmächtige Slim muss beweisen, dass er gegen den bulligen und brutalen Boxer Killer im Ring bestehen kann. Klar ist natürlich, wer letztlich als Sieger aus dem Boxring steigt …Schließlich schlägt im dritten Teil der Produktion Boxer 3D wieder das Cyber-Moderationsduo zu und wirft launig die Frage auf, ob zukünftig Schauspielerinnen und Schauspieler überflüssig werden. Schon jetzt werden beispielsweise Stunts zunehmend von virtuellen Kolleginnen bzw. Kollegen erledigt, was das Verletzungsrisiko und natürlich auch Kosten erheblich mindert. Insgesamt bewegt sich Boxer 3D dennoch letztlich in einem eher medienkritisch oberflächlichen Rahmen. Was aber bleibt, ist ein ästhetisch überwältigender Eindruck der aktuellen Möglichkeiten professioneller dreidimensionaler Computeranimation. Das technisch anspruchsvolle Verfahren zur Präsentation, welches bei Boxer 3D – und ähnlich produzierten dreidimensionalen Filmen – Verwendung findet, erfordert eine gebogene, silbern bedampfte Leinwand, spezielle Brillen mit zwei unterschiedlich polarisierenden Gläsern und zwei parallel arbeitende Videoprojektoren, die von einem Computer bespielt werden. Entsprechend projizieren die Beamer jeweils ein Bild für das linke und das rechte Auge auf die Leinwand. Im Gehirn der Zuschauerinnen und Zuschauer werden dann diese zwei unterschiedlichen Bilder wieder zu einem dreidimensionalen Bildeindruck eines einzigen Bildes zusammengefügt. Anders als bei anderen, klassischen Verfahren ist der Farb-, Schärfe- und Tiefeneindruck natürlich auch durch die extrem dreidimensional im Computer entwickelten Räume ziemlich atemberaubend, allerdings darf der Kopf beim Betrachten des Leinwandbildes nicht bewegt werden, was nach längerer Zeit doch leicht ermüdend wird. In verschiedenen Sequenzen scheint Slim tatsächlich zum Greifen nahe, quasi schwebend vor der Leinwand über den anderen Zuschauenden. Da aber bundesweit nur wenige Kinos mit einer derartigen komplizierten Vorführtechnik aufwarten können, wird dieser, zwar nicht medienpädagogisch, aber zumindest ‚medien-kundlich’ interessante Film wahrscheinlich zusätzlich in einer herkömmlichen, klassischen 35mm Version zu sehen sein.
Boxer 3D
Kanada 2008, 40 min
Regie: Steven Bramson
Darsteller: Ronald Houle, Benoît Brière, Danniel Danniel
Verleih: Fantasia film
Beitrag aus Heft »2008/05: Kreative Medienarbeit«
Autor: Michael Bloech
Beitrag als PDFEinzelansichtMichael Grisko: Kluge Filme auf DVD
Die DVD-Box Alexander Kluges sämtliche Kinofilme ist eine körperliche und geistige Herausforderung. Am Ende der 16 Kinofilme aus knapp 20 Jahren, der zahlreichen Kurz- und Kürzestfilme des Film- und Fernsehmachers Alexander Kluge hat man nicht nur eine dokumentarische Zeitreise durch die an Ereignissen nicht gerade arme deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts unternommen, man hat zudem alle durch das Hollywoodmainstreamkino geschulten, wohl besser verkümmerten, Rezeptionsmuster von Medienprodukten abgelegt bzw. rundumerneuert: Psychologie, Realismus, Handlung, Held, Genre, (Melo-)Dramatik, Happy End. Alexander Kluge hat diese cineastischen Parameter im Anschluss an das Oberhausener Manifest von 1963 konsequent neu definiert. Nach seiner Promotion (1956) hatte der 1932 in Halberstadt geborene Filmemacher und Schriftsteller ausgerechnet bei Arthur Brauners CCC ein Volontariat absolviert – einem Garanten für populäres Nachkriegskino. Alexander Kluge emanzipierte sich: Eigene Filmprojekte (Brutalität in Stein, 1960) und die dafür gewonnenen Preise in Oberhausen machten ihn schließlich zu einem der Initiatoren des Oberhausener Manifests.
Edgar Reitz, Peter Schamoni, Hansjürgen Pohland hatten zusammen mit anderen Filmemachern den alten Film, das von der UFA-Ästhetik bestimmte Kino für tot erklärt und programmatisch festgehalten: „Dieser Film braucht neue Freiheiten. Freiheit von den branchenüblichen Konventionen. Freiheit von der Beeinflussung durch kommerzielle Partner von der Bevormundung durch Interessensgruppen.“ Und weiter hieß es dort: „Wir haben von der Produktion des neuen deutschen Films konkrete geistige, formale und wirtschaftliche Vorstellungen. Wir sind gemeinsam bereit, wirtschaftliche Risiken zu tragen.“Alexander Kluge zählt zu den ästhetisch radikalsten Praktikern dieser Programmatik. Dazu gehört auch das dynamische Element in seiner Medienproduktion. Arbeitet er von 1966 bis 1986 mit seiner Produktionsfirma Kairos vor allem für das Kino, hat er sich mit der Etablierung des Dualen Rundfunksystems in Deutschland mit seiner Produktionsfirma dctp zum ständigen Gast im deutschen Privatfernsehen gemacht. – Einige Beispiele dieser Produktionen sind auch in der Box enthalten. Aber auch der Übergang und die Etablierung der Neuen Medien Mitte der 1980er-Jahre selbst und der damit verbundene Untergang des Kinos, war ein Thema seiner Filme.Überhaupt verdeutlichen die Bonusmaterialien der Box die intellektuelle Vielfalt des mittlerweile 74-jährigen Filmemachers. Neben den Filmpraktiker tritt hier auch der Gesellschaftstheoretiker und der Schriftsteller.
Als pdf-Dokumente sind Teile der Filmbücher, Aufsätze von und über Alexander Kluge zu entdecken, die sonst nur schwer in den Bibliotheken zu finden sind und essentieller Bestandteil seiner ästhetischen Arbeit sind. Schon allein die Titel seiner Kino- und Fernsehfilme haben programmatischen Charakter: Abschied von gestern (1965), Gelegenheitsarbeit einer Sklavin (1973), Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos (1968), Die unbezähmbare Leni Peickert (1970), Der große Verhau (1971), Willi Tobler und der Untergang der 6. Flotte (1969-71), In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod (1974), Der starke Ferdinand (1976), Deutschland im Herbst (1978), Die Patriotin (1979), Krieg und Frieden (1982), Der Kandidat (1980), Die Macht der Gefühle (1984), Serpentine Gallery Programm (1995-2005), Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit (1985), Vermischte Nachrichten (1985-86).
Alexander Kluges Filme wandeln sich vom Spielfilm zum Essay und balancieren auf einer unsichtbaren und sich ständig verschiebenden Linie zwischen Dokumentar- und Spielfilm und negieren sämtliche gängigen Filmkonventionen. So werden die Filme Der große Verhau und Willi Tobler und der Untergang der 6. Flotte zu einer Neubestimmung des Genres Science-Fiction-Film. In diesen Filmen wird auch Alexander Kluges assoziative, zeit- und formensprengende Arbeitsweise deutlich. Er verwendet alle stilistischen Mittel des Films: Inserts, Blenden, schwarz-weiß-Strecken; er arbeitet gegen die standardisierte Ästhetik von Film und Fernsehen, indem er zum Beispiel schreibmaschinengetippte Inserts verwendet. Seine Schnitte und Sprünge sind assoziativ und werden in späterer Zeit zunehmend freier, seine Ästhetik baut auf einen aufmerksamen und geschichtlich vorgebildeten Zuschauer. Er will Zusammenhänge nahelegen ohne sie zu behaupten – und dies sowohl in der deutschen als auch in der internationalen Geschichte. Es geht ihm um Zusammenhänge von Gesellschaft, Geschichte und Ökonomie und das fernab einer auf psychologischen Handlungsmotivationen basierenden Filmästhetik. Mit den 16 DVDs ist nun ein zentrales Stück deutscher Film- und Gesellschaftsgeschichte verfügbar, das eindrucksvoll lehrt, die eigenen Sehgewohnheiten in Frage zu stellen und neu zu erlernen. Das ist eine lohnende Erfahrung (oder Wiederbegegnung)!
Beitrag aus Heft »2008/05: Kreative Medienarbeit«
Autor: Michael Grisko
Beitrag als PDFEinzelansichtPeter Gerlicher: Schnittplatz Handy?
Wer kann sich heute noch an die Zeiten erinnern, in denen Mobiltelefone tatsächlich nur zum Telefonieren zu gebrauchen waren? Zumindest, wenn man sich in der Öffentlichkeit umschaut, scheinen diese Tage schon recht lange zurück zu liegen. Egal ob auf der Straße, in der U-Bahn oder bei Konzerten, überall werden Handys in die Höhe gereckt, um Schnappschüsse oder Videoclips aufzunehmen. Durch die Kamerafunktion hat sich das Mobiltelefon in den letzten Jahren zu einem allseits verfügbaren Fotoapparat und zur kleinen Videokamera für unterwegs entwickelt. Und auch die Medienpädagogik hat früh die Potenziale erkannt und genutzt, die in der Multifunktionalität der Mobiltelefone liegen. Inzwischen sind seit dem ersten Kamerahandy wieder mehrere Jahre vergangen. Der interne Speicherplatz, der in den Geräten zur Verfügung steht, hat sich rasant vergrößert und die Betriebssysteme der kleinen Telefone können inzwischen auch mit anspruchsvoller Bearbeitungssoftware umgehen. Grund genug, um einen Blick auf die medienproduktiven Möglichkeiten zu werfen, die aktuelle Handy-Modelle heute bieten.Als exemplarischer Ausschnitt soll hier ein Überblick zu den Funktionen eines Handy-Modells aus der Walkman-Reihe des Herstellers Sony Ericsson dienen (in diesem Fall das Modell w890i). Diese Geräte bieten umfangreiche mp3-Player-Funktionen und sind wohl gerade deshalb auch bei Jugendlichen beliebt. Davon abgesehen sind auf diesen Handys aber auch eine ganze Reihe von Anwendungen vorinstalliert, die den Nutzerinnen und Nutzern ohne Umwege über teure Downloads oder Software-Upgrades die Möglichkeit bieten, produktiv tätig zu werden.
Audio/Musik
Etwas begrenzt muten zunächst noch die Möglichkeiten im Bereich Audio und Musik an. Eine Funktion zum Aufnehmen von Audioclips steht bei den Sony Ericsson Handys zwar zur Verfügung. Allerdings werden die Dateien im relativ umständlichen AMR-Format abgespeichert. Ursprünglich war dies wohl vor allem für Sprachaufnahmen gedacht, etwa für Gesprächsnotizen oder Mitschnitte von Telefonaten. Natürlich lässt sich die Funktion aber auch dafür verwenden, originelle Klingel- oder Alarmtöne selbst aufzunehmen und sei es zum Beispiel nur das Bellen oder Miauen der eigenen Haustiere. Zum Herstellen eigener Musikclips hat Sony Ericsson auf seinen Geräten die Software MusicDJ vorinstalliert – einen simplen, vierspurigen MIDI-Sequenzer. Damit funktioniert das Komponieren von Musik ganz unkompliziert nach dem Baukasten-Prinzip. In den Kategorien Schlagzeug, Bass, Akkorde und Töne stehen jeweils mehr als zwei Dutzend kleine Musik- und Rhythmus-Elemente zur Auswahl, die beliebig miteinander kombiniert werden können. Die Resultate dieser stark vorstrukturierten Komponier-Versuche mit dem Handy bleiben zwar eher simpel und erinnern an die Dudel-Musik im Hintergrund der frühen Gameboy-Spiele. Dennoch hat man so die Möglichkeit, kleine individuelle Musikstücke direkt am Handy zu gestalten und sie an Freundinnen und Freunde weiterzuverschicken.
Foto/Video
Die Fotos, die man mit den aktuellen Handy-Modellen schießen kann, stehen in ihrer Qualität Aufnahmen mit einfachen Digitalkameras in nichts mehr nach. Zwei bis drei Megapixel Auflösung sind bei den meisten Kamerahandys heute Standard, einzelne Geräte bieten schon bis zu acht Megapixel. Spannend wird es aber vor allem nach dem Betätigen des Auslösers. Denn während es bei Audioaufnahmen mit Funktionen zum Nachbearbeiten und Weiterverwenden eher dürftig aussieht, bietet das Walkman-Handy für Fotos und Videos gleich mehrere Bearbeitungsmöglichkeiten. Mit der Anwendung PhotoDJ lassen sich die aufgenommenen Bilder sofort nach der Aufnahme verändern und nach individuellen Wünschen ‚aufhübschen’. Wie von einer Foto-Bearbeitungssoftware am PC gewohnt, können Handy-Fotografinnen und -Fotografen damit beispielsweise Lichtverhältnisse, Kontrast und Farben ihrer Bilder direkt am Handy anpassen und damit noch etwas mehr aus spontanen Schnappschüssen herausholen. Zusätzlich lassen sich auf diese Weise aber auch noch Bildeffekte, Texte oder poppige Rahmen und Cliparts hinzufügen.Die ebenfalls auf dem Handy vorinstallierte Software VideoDJ vereint in ihren Möglichkeiten schließlich sowohl Audio-, Foto- als auch Videomedien. Mit dieser Anwendung können am Handy aufgenommene Videoclips relativ simpel gekürzt, geteilt oder hintereinander geschnitten werden. Das Prinzip dabei ähnelt einfachen Video-Anwendungen am PC, wie etwa dem Windows Movie Maker. Aus allen Medien, die auf dem Handy gespeichert sind, lassen sich Bilder und Videoclips in beliebiger Reihenfolge auf eine Zeitleiste am unteren Bildschirmrand einfügen. Dadurch kann man sowohl auf vorinstallierte Cliparts und Videosequenzen zurückgreifen, man kann aber auch selbstaufgenommene Fotos und Videos oder per Bluetooth empfangene Dateien verwenden. Die einzelnen Sequenzen können dabei in der Länge verändert werden und auch für Titel, Abspann und die Übergänge zwischen den Clips stehen mehrere Effekte zur Auswahl. In die Audiospur lassen sich schließlich noch selbst aufgenommene Sound-Dateien, zum Beispiel Audiokommentare, oder mit dem MusicDJ erstellte Musikclips einfügen – lediglich mit mp3-Titeln funktioniert dies nicht. Dennoch bieten sich unzählige Möglichkeiten, wie mit dem VideoDJ Handy-Clips gestaltet werden können – sei es in Form einer simplen Diashow oder einer aufwändigeren Videocollage.Bleibt zuletzt die Frage, welche Konsequenzen die medienpädagogische Praxis aus den neuen Produktionsmöglichkeiten am Handy möglicherweise ziehen kann. Es ist festzustellen, dass das Mobiltelefon zunehmend nicht mehr nur als Aufnahmegerät dient, zum Beispiel als Foto- oder Videokamera. Immer mehr verlagern sich auch die nachfolgenden Produktions- und Bearbeitungsschritte vom PC-Bildschirm hin aufs kleine Handy-Display. Zwar sind viele der hier vorgestellten produktiven Funktionen stark vorstrukturiert und gerade im Audio-Bereich vom Umfang her sehr begrenzt. Andererseits ist das Handling der Handy-Softwares auffallend simpel und intuitiv, die Ästhetik der Foto- und Videoeffekte spricht Jugendliche an und die Anwendungen bieten einen niedrigschwelligen Zugang zum Ausprobieren von medienproduktiven Möglichkeiten.
Beitrag aus Heft »2008/05: Kreative Medienarbeit«
Autor: Peter Gerlicher
Beitrag als PDFEinzelansichtTilmann P. Gangloff: Charme und Chance
Mit bemerkenswerter Verbissenheit ringen verschiedene Interessenverbände und Gremien seit Monaten um die Art und Weise, wie sich ARD und ZDF im Internet präsentieren dürfen. Wortwahl und Engagement legen nahe: Hier wird nicht um einen singulären Sieg gefochten, hier werden Weichen gestellt. Es geht um die Zukunft, und die heißt nicht Fernsehen, sondern Internet; wer das nicht wahrhaben will, muss mit einem bösen Erwachen rechen. Jahrzehnte lang galt die Maxime, etablierte Medien würden durch neue nicht verdrängt. Tatsächlich haben Radio, Kino und Fernsehen nach einer gewissen Übergangsphase zu einem harmonischen Neben- oder sogar Miteinander gefunden. Aber das Internet ist kein neues Medium; es ist Radio, Fernsehen, Kino, ja sogar Zeitung, Illustrierte und Schallplatte oder CD in einem. Das nachgeborene Internet ist paradoxerweise die Mutter aller Medien. Kein Wunder, dass die Wortmeldungen im Streit um die öffentlich-rechtliche Internetpräsenz mitunter klingen, als ginge es um die Existenz: Es geht um die Existenz. ARD und ZDF dürfen in dieser Diskussion schon allein deshalb nicht klein beigeben, weil sie den Kampf um die Aufmerksamkeit im klassischen Fernsehen weitgehend verloren haben. Die beiden Systeme erreichen mit ihren diversen Beibooten zwar rund 40 Prozent der regelmäßigen TV-Zuschauer, doch das Publikum gerade der Vollprogramme ist im Schnitt um die sechzig.
Bei Jüngeren hat das Fernsehen seine dominante Rolle ohnehin längst eingebüßt. Wer unter dreißig ist, verbringt einen immer größeren Teil seiner Medienzeit am Computer. Auch aus diesem Grund bemühen sich ARD und ZDF so hartnäckig und mit großem finanziellem Aufwand um Sportrechte: Die Übertragungen von großen Fußballturnieren sind die pure Existenzberechtigung. Dabei sind die Sender bloß Dienstleister. Der Übertragungsweg könnte auch ganz anders aussehen, und genau das ist der springende Punkt: Wenn vom Bedeutungsverlust des Mediums Fernsehen die Rede ist, denkt man unwillkürlich zuerst an Sender und dann an Inhalte, doch das ist ein Denkfehler. Das Ende der Schallplatte war keineswegs gleichbedeutend mit dem Ende der Musik; die Musik hat nur das Medium gewechselt. Fernsehen, erklärt der Marburger Medienwissenschaftler Gerd Hallenberger, „ist bloß ein kulturell gelernter Begriff, unter dem sich in fünfzig Jahren nur noch Ältere etwas vorstellen können“. Schon das Wort „Fernsehen“ steht für ganz unterschiedliche Bedeutungen: Es bezeichnet die gesamte Organisationsform, die einzelnen Sender, das Programm, die Übertragungstechnik und auch das Gerät selbst. Es geht also um Form und Inhalt. Die Form wird sich wandeln oder ganz verschwinden, doch der Inhalt wird bleiben; aber er wird mit dem, was wir heute unter Fernsehen verstehen, nicht mehr viel gemeinsam haben.
In Zukunft wird sich das Fernsehen vom Wohnzimmermedium zum Abrufdienst auf mobilen Endgeräten entwickeln. In einigen Jahren wird es vielleicht noch frei empfangbare Fenster für eine gewisse Grundversorgung geben, doch der Rest ist Pay TV; audiovisuelle Nutzung wird im Wesentlichen auf Abruf funktionieren. Schon heute leben junge Nutzerinnen und Nutzer längst ein Medienverhalten, das die Fernsehlandschaft stärker beeinflusst als die Einführung der Fernbedienung: weil sie sich dem Diktat des vorgegebenen Programmablaufs widersetzen. Diese Haltung war Voraussetzung für den enormen Erfolg von YouTube, wo Nutzerinnen und Nutzer durch die Eingabe bestimmter Suchbegriffe ihre eigene Programmdirektion übernehmen.Inhaltlich kann das Fernsehen seine Existenz also nur sichern, wenn es originäre Seh-Erlebnisse schafft, und damit ist nicht die Übertragung externer Ereignisse gemeint. Was immer man zum Beispiel von den diversen Ausschlachtungen der Marke Raab halten mag: Mit seinen ausufernden Darbietungen (Schlag den Raab, Wok-WM) ist es Stefan Raab gelungen, Live-Erlebnisse zu kreieren, die seine Zielgruppe gesehen haben muss. Auf der anderen Seite ist es fatal, wenn öffentlich-rechtliche Angebote kurzlebigen Trends hinterher hecheln: Weil niemand Lust hat, für einfallslose Kopien kommerzieller Erfolgssendungen, die ihrerseits bloß Adaptionen ausländischer Formate sind, auch noch Geld zu bezahlen. Gerade die ARD definiert Qualität in der Regel über den Marktanteil. Sendungen mit Erkenntnisgewinn gibt’s zumeist erst nach den Tagesthemen. Sortiert man den Fernsehkuchen übrigens nicht nach Sendern, sondern nach Senderfamilien, stehen ARD, ZDF und ihre Ableger plötzlich sogar recht gut da: Bei Zuschauerinnen und Zuschauern unter fünfzig belegte man im ersten Halbjahr 2008 hinter der RTL-Gruppe (32,7 Prozent) und der ProSiebenSat.1-Familie (28,9 Prozent) mit 25,4 Prozent (erstes Halbjahr 2008) einen guten dritten Platz.
Beitrag aus Heft »2008/05: Kreative Medienarbeit«
Autor: Tilmann P. Gangloff
Beitrag als PDFEinzelansicht
publikationen
Fromme, Johannes/Sesink, Werner (Hg.): Pädagogische Medientheorie
Im Spannungsfeld zwischen Bildungs- und Medientheorie
Kultur ist nicht denkbar ohne Medien. Aus diesem Grund widmete sich die recht junge Fachdisziplin der Medienwissenschaft bereits früh dem Komplex der Kultur. Und die ältere Fachdisziplin der Kulturwissenschaft schenkte dem Komplex der Medien ebenfalls wachsende Aufmerksamkeit. Eine ähnliche befruchtende Synergie wünschte man sich zwischen der Erziehungs- und Medienwissenschaft. Ansätze hierfür gab es in den 80er-Jahren in den nordamerikanischen Staaten.
Im deutschsprachigen Bereich etablierte sich zur gleichen Zeit eine Medienpädagogik, die, folgt man dem Erziehungswissenschaftler Dieter Lenzen, noch Mitte der 90er Jahre zu den Fachrichtungen zu zählen war, die auf dem Weg von einem Praxisfeld zu einer eigenständigen pädagogischen Subdisziplin seien. Was der Medienpädagogik bis dahin fehlte, war eine spezifische Theoriebildung. Anläufe hierzu gab es: 1995 initiierte der Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik an der Universität Heidelberg ein dreisemestriges Seminarprojekt, das Bildungstheorie als historische Medientheorie begreifen wollte. Eine umfassende Publikation zum Thema folgte leider nicht. Johannes Fromme und Werner Sesink nahmen sich aktuell dieser Thematik an und publizierten als Herausgeber das Buch Pädagogische Medientheorie.
Hintergrund dieser Publikation ist die Gründung einer Theorie-Arbeitsgemeinschaft in der Kommission Medienpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Diese hat ein Theorie-Forum ins Leben gerufen, welches Raum für grundsätzliche Theoriediskurse bietet. In den Jahren 2006 und 2007 fanden die ersten Tagungen an den Forschungs- und Lehrorten der beiden Herausgeber statt: in Magdeburg und Darmstadt. Während man sich in der ersten Tagung an benachbarte Diskurse wandte, wurde auf der zweiten die Frage gestellt, was ein pädagogisches Medium sei. Die überarbeiteten Tagungsbeiträge liegen nun in Buchform vor. Gleich zu Anfang konstatieren die beiden Herausgeber, dass die Medienpädagogik bisher überwiegend als ein spezifisches Anwendungsfeld allgemeiner erziehungswissenschaftlicher Theorien verstanden wurde. Mit dem Vordringen der Neuen Medien werde allerdings deutlich, dass „das Mediale eine fundamentale Dimension humaner Lebensbewältigung und -gestaltung darstellt, dessen Reflexion die theoretischen Grundlagen der Disziplin angeht.“ Eine grundsätzliche Debatte um eine „Pädagogische Medientheorie“ scheint inzwischen unabdingbar.In seinem Beitrag bringt Werner Sesink die Ausgangssituation nochmals auf den Punkt: Während Medien für Bildungstheoretiker lange ein Randthema gewesen sind, wird die Bildungstheorie in der Medienpädagogik bestenfalls als Hintergrund in Anspruch genommen.
Die medienpädagogische Forschung wird in aller Regel nicht selbst als Beitrag zur Entwicklung von Bildungstheorie verstanden. Sesinks Anliegen ist ein Brückenschlag: Bildung ist nicht nur betroffen von medientechnologischen Entwicklungen, sondern fundamental an deren Entwicklung beteiligt. Das Neue Medium (im Singular) bietet einen Raum an, in dem das Subjekt neue Ein-bildungen (In-formatio) konstruieren kann. Während Sesink auf Hegel und Kant Rückbezug nimmt, interpretiert der Bildungsphilosoph Norbert Meder den Luhmann’schen Medienbegriff, um ihn im bildungstheoretischen Kontext zu diskutieren. Winfried Marotzki, der für seine qualitative Bildungsforschung bekannt ist, stellt mit seinem Mitarbeiter Benjamin Jörissen das Konzept einer strukturalen Medienbildung vor, mit dem der Medialität ein systematischer Wert in der Bildungstheorie zugewiesen werden soll. Den Versuch, Paradigmen einer pädagogischen Medientheorie zu umreißen, unternahm der Kunstpädagoge und Medientheoretiker Torsten Meyer bereits in seiner sechs Jahre zurückliegenden Dissertation.
In seinem Beitrag geht er neue Wege und greift auf die französische Mediologie nach Régis Debray zurück, um ein angemessenes Verständnis darüber zu entwickeln, was ein pädagogisches Medium sei. Heidi Schelhowe, aus der Informatik kommend und auf Bildungsanwendungen zielend, argumentiert dafür, das digitale Medium Computer als Gegenstand von Bildung zu betrachten, und nicht als Mittler oder Verhinderer. Der Medien- und Kulturtheoretiker Rainer Winter rezipiert die US-amerikanische, kritisch orientierte Medienpädagogik, um das Ideal einer demokratischen und freien Gesellschaft zu verteidigen. Birgit Althans und Nino Ferrin aus dem Forschungsbereich „Kulturen des Performativen“ der FU Berlin untersuchen die grundlegenden Veränderungen der Identitätsbildung durch die neuen medialen Erfahrungsräume. Und der Philosoph und Bildwissenschaftler Klaus Sachs-Hombach unterzieht dem Klassiker der Medientheorie, Marshall McLuhan, eine Revision, um ein alternatives Theoriemodell zur Beschreibung und Beurteilung von Bildmedien zu erarbeiten.Die Publikation Pädagogische Medientheorie zeigt deutlich, wie mit einem erweiterten Medienbegriff, der oft zu einem singaluren Mediumsbegriff wird, neue Akzente in der Medienpädagogik gesetzt werden können. Auf der anderen Seite wird verständlich, warum die Bildungstheorie, ähnlich der Kulturwissenschaft, dem Komplex Medien wachsende Aufmerksamkeit zu ihrer eigenen Weiterentwicklung schenken sollte. Da sich das Theorie-Forum der Kommission Medienpädagogik als offenes Projekt versteht, lässt sich die nächste Publikation erhoffen.
Krettenauer, Thomas/Ahlers, Michael (Hg.): Pop Insights. Bestandsaufnahmen aktueller Pop- und Medienkultur
Die Aufsatzsammlung der beiden Musikwissenschaftler Thomas Krettenauer und Michael Ahlers führt unter kulturwissenschaftlicher Perspektive Beiträge von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ebenso wie von Expertinnen und Experten sowie Kreativkräften aus der (Pop-)Musik- und Medienbranche zusammen. Der Band versucht damit eine Auseinandersetzung mit „Gegenwartsfragen zur aktuellen Medien- und Popkultur“. Dabei gehen musikwissenschaftliche, musikethnologische und kulturtheoretische Aufsätze beispielsweise auf den Begriff der Gegenwart aus theologischer und sprachwissenschaftlicher Sicht ein. Insgesamt wollen die Herausgeber dazu beitragen, einen facettenreichen und interdisziplinären Austausch zum Thema zu initiieren.
Auf heimatbezogene, lokale Popmusik wird daher ebenso eingegangen wie zum Beispiel auf empirisch-sozialpsychologische Befunde zu Persönlichkeit und Verhalten der Fans von Hard Rock, Punk und Gangsta Rap; thematisiert wird daneben unter anderem die Rolle von Musik in den Medien oder auch das Verhältnis von Popmusik und Mobile Entertainment. Insgesamt entsteht so eine zwar sehr ausschnitthafte, dennoch aber Interesse weckende Zusammenschau aktueller Entwicklungen der Popmusik und ihrer wissenschaftlichen und künstlerischen Interpretation.
Mayrberger, Kerstin: Verändertes Lernen mit neuen Medien?
Das „neue Lernen mit neuen Medien“ an Grundschulen ist auch heute noch immer, sowohl aus (medien-)pädagogischer als auch aus bildungspolitischer Sicht ein viel diskutiertes Thema. Diese Arbeit liefert einen Beitrag zur Diskussion über verändertes Lehren und Lernen mit neuen Medien sowie der Integration der neuen Medien in den Grundschulunterricht. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Frage, inwieweit neue Medien ein verändertes Lernen unterstützen können.
Die empirische Untersuchung basiert auf videogestützten Beobachtungen von Schülerinnen und Schülern während ihrer gemeinschaftlichen Arbeit in sogenannten Medienecken im alltäglichen Grundschulunterricht. Konkreter Beobachtungsgegenstand waren dabei die Interaktionen der Schülerinnen und Schüler im Umgang mit Computer und Internet. Es werden sowohl Rückschlüsse auf die Rolle der neuen Medien im Grundschulunterricht als auch auf deren Bedeutung für allgemeine grundschulpädagogische Überlegungen gezogen. Die Dissertationsarbeit unterstützt eine Integration der neuen Medien in den Unterricht, auch in der Grundschule. Ein weiterer wissenschaftlicher Beleg also dafür, dass dieser Prozess auch mit veränderten Lehr- und Lernformen einher gehen muss.
Beitrag aus Heft »2008/05: Kreative Medienarbeit«
Autor: Kerstin Mayrberger
Beitrag als PDFEinzelansichtMedienkompass 1 + 2
Medienkompass: Orientierungshilfe in einer konvergenten Medienwelt
Die rasante Entwicklung des Computers seit Mitte des letzten Jahrhunderts hat wahrscheinlich ebenso tiefgreifende Veränderungen bewirkt wie seinerzeit die Erfindung der Schrift oder des Buchdrucks. Im Zuge der digitalen Revolution verschmelzen bislang getrennte Bereiche wie Telekommunikation und Unterhaltungselektronik, Massenmedien und Computer zusehends und lassen neue Handlungs- und Erfahrungswelten entstehen. Für die Schule ergibt sich damit die Aufgabe, Kinder und Jugendliche bei der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen, Urteilsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Medien und Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) zu unterstützen. Das neue Schweizer Lehrmittel Medienkompass bietet hierzu eine praktische Orientierungshilfe.
Aufwachsen im Medienzeitalter
Kinder und Jugendliche gehen meist ohne Berührungsängste mit Medien und neuen Technologien um und nutzen die vielfältigen Angebote ganz selbstverständlich für ihre Bedürfnisse. Handy, Chat, Podcast und YouTube sind für sie keine Fremdworte. Ein reichhaltiges Medienensemble und teils beeindruckende Anwenderkenntnisse dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es an solidem Hintergrundwissen und fundierter Medienkompetenz oft noch fehlt. Auch in den Schulen bedeutet die Verfügbarkeit von Geräten oder ein Internetzugang im Klassenzimmer nicht zwangsläufig, dass Medien sinnvoll genutzt, Angebote besser verstanden oder kritisch hinterfragt werden. Um die gesellschaftliche Bedeutung der Informations- und Kommunikationstechnologien in Ansätzen zu verstehen, den eigenen Mediengebrauch zu reflektieren und über Einsatzmöglichkeiten und Inhalte medialer Angebote sprechen zu können, benötigen Schülerinnen und Schüler grundlegende Kenntnisse. Neben praktischen Fertigkeiten und technischen Kompetenzen im Umgang mit Massen- und Computermedien, Softwareprogrammen oder interaktiven Spiel- und Lernwelten soll die Schule wichtige Impulse zur bewussten Mediennutzung vermitteln und ebenso für soziale oder ethische Aspekte sensibilisieren. Der Medienkompass setzt hier neue Akzente und verbindet zentrale Anliegen der Medienpädagogik und der informatischen Grundbildung.
Lehrmittel für die integrative Medienbildung
Lange Zeit waren Medien im Unterricht vorwiegend Hilfsmittel. Sie dienten und dienen weiterhin als Transportgefäße und Informationsträger von Inhalten oder sollen in Form technischer Unterstützung zur Verbesserung von Lehr- und Lernprozessen beitragen. Mit der wachsenden Bedeutung und Integration von Medien im Alltag müssen diese aber zunehmend selbst zum Unterrichtsgegenstand werden. Zahlreiche Lehrmittel oder Unterrichtshilfen zur aktiven Medienarbeit stellen entweder konkrete Projekte vor, konzentrieren sich auf medienkundliche Aspekte und technische Anwenderkenntnisse oder beschränken sich vornehmlich auf Bereiche der informatischen Grundbildung. Im Unterschied zu Informatiklehrmitteln und Ideensammlungen zur Computerintegration setzt der Medienkompass auf eine umfassende Förderung von Medienkompetenz. Wissen, Handeln und Reflektieren sind miteinander verzahnt. Betont wird das Grundsätzliche und das Gemeinsame verschiedener Medien, Computerplattformen und Anwendungen. Mit je einem Band für die 4. bis 6. Klasse (Medienkompass 1) und die 7. bis 9. Klasse (Medienkompass 2) richtet sich das Lehrmittel direkt an die Schülerinnen und Schüler und knüpft an deren außerschulische Medienerlebnisse an. Den unterschiedlichen Kenntnissen wird dabei ebenso Rechnung getragen wie der gleichwertigen Förderung von Mädchen und Jungen. In 18 Themenfeldern wird ein Kernprogramm von Konzepten, Methoden und Verhaltensweisen für die Nutzung von Medien und Informations- und Kommunikationstechnologien vermittelt. Die in sich abgeschlossenen Einheiten ermöglichen sowohl einen lehrerzentrierten Klassenunterricht als auch individualisierende Formen bis hin zum Selbststudium. Die beiden aufeinander abgestimmten Bände gewährleisten zudem die Kontinuität und Progression über mehrere Jahrgangsstufen. Zu jedem Band ist ein ausführlicher Kommentar für Lehrpersonen erschienen. Weitere Informationen, Links, Leseproben und Materialien in Form von Dokumenten und Arbeitsvorlagen werden auf der Website www.medienkompass.ch angeboten.
Themen für den Unterricht
Da für die schulische Medienbildung in der Regel kaum ein eigenes Fach zur Verfügung steht, sollen die Themen und Ziele fächerübergreifend in den Unterricht integriert werden. So werden im Medienkompass verschiedene Dimensionen von Medienkompetenz gleichermaßen berücksichtigt und exemplarisch thematisiert. Digitale Bilder, grafische Benutzeroberflächen, Dateiformate, Suchmaschinen oder die Gestaltung von Bild- und Textdokumenten können bereits ab der Grundschule thematisiert werden und bilden einen Teil des medienkundlichen Orientierungswissens. Darüber hinaus beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit der Bedeutung und Verwendung unterschiedlicher Medien, erhalten Einblick in die Funktionsweise des Webs oder setzen sich mit realen und künstlichen Wirklichkeiten auseinander. Für die Kommunikation im Internet sind ein sicherer Umgang mit Passwörtern und persönlichen Daten ebenso wichtig wie Verhaltensregeln im Chat oder die Grundlagen des Urheberrechts. Für die oberen Schulstufen stehen dann Einsatzbereiche und Wirkungen verschiedener Medien, die Faszination von Computerspielen und virtuellen Umgebungen oder die persönliche Handynutzung im Mittelpunkt. Schülerinnen und Schüler lernen verschiedene Funktionen von Bildern kennen und können dieses Wissen in der aktiven Medienarbeit anwenden. Sie erfahren, worauf es bei der Gestaltung einer Multimedia-Präsentation ankommt oder was man beim Publizieren von Inhalten im Internet beachten muss. Sie prüfen Informationen auf deren Glaubwürdigkeit und beschäftigen sich in fächerübergreifenden Projekten mit Blogs und Wikis.
Neider, Andreas (Hg.): Brauchen Jungen eine andere Erziehung als Mädchen?
Die pädagogische Situation konfrontiert Eltern, Erziehende und Lehrkräfte immer wieder mit verhaltensauffälligen Kindern. Die Praxis zeigt, dass solche Probleme verstärkt bei Jungen zu beobachten sind und weniger bei Mädchen. Deshalb ist die Frage nach möglichen Entwicklungsunterschieden und -hemmnissen zwischen den Geschlechtern durchaus diskussionsberechtigt. Dieses Buch fasst die Hauptbeiträge des 2007 stattgefundenen Bildungskongresses „Brauchen Jungen eine andere Erziehung als Mädchen?“ zusammen. Die Beiträge setzen sich aus zwei verschiedenen Darstellungsformen zusammen.
Einerseits mündlich gehaltene Vortragsnachschriften, die mehr auf die Praxis abzielen und andererseits extra für das Buch schriftlich ausgearbeitete Texte, die mehr den theoretischen Hintergrund beleuchten. Dabei vereint das Buch psychologische, pädagogische und soziologische Erkenntnisse über die Erziehungsunterschiede zwischen Jungen und Mädchen. Der Autor will keinen allwissenden Antwortkatalog für alle Erziehungsfragen von Jungen geben, sondern vielmehr neue Impulse für eine gezielte geschlechtsbewusste und -spezifische Bildung durch die Eltern und in der Schule anregen.
Nünning, Ansgar/Nünning, Vera (Hg.): Einführung in die Kulturwissenschaften. Theoretische Grundlagen – Ansätze – Perspektiven
Kulturwissenschaften – Einführung und Gegenstandsbestimmung
Durch die Konjunktur des Titels Kulturwissenschaften, der in den letzten Jahren an jedes Projekt bzw. jeden geisteswissenschaftlichen Studiengang selbst verliehen wurde, ist ein nur noch schwer überschaubares Feld von Ansätzen, Disziplinen und Themen entstanden. Deshalb ist das Erscheinen des vorliegenden Sammelbandes, bei dem es sich um die Neuauflage des 2003 unter dem Titel „Konzepte der Kulturwissenschaften“ veröffentlichten Bandes handelt, zu begrüßen. Allerdings geht die im Vorwort angekündigte Aktualisierung (S. XI) nicht über die Nennung einiger weniger neuer Literatur hinaus. Ziel des Handbuches ist es, einen Einblick in wichtige Forschungsansätze zu geben, um Studierenden und auch Lehrenden kulturwissenschaftlicher und anderer sozial- und geisteswissenschaftlicher Studiengänge anhand von Informationen „über die wichtigsten Ansätze, deren theoretische Grundlagen und Schlüsselbegriffe sowie über die jeweils eröffneten neuen Forschungsperspektiven“ (S. XII) eine Orientierung zu bieten. Um die Perspektivenvielfalt aufzuzeigen, werden neben einleitenden Ausführungen zu Kulturbegriffen und -theorien (C.-M. Ort) verschiedene Ansätze von Kultursemiotik (R. Posner), Kulturanthropologie (Bachmann-Medick), -soziologie (R. Winter) und -geschichte (U. Daniel) hin zu New Historicism (M. Baßler), Xenologie (A. Wierlacher/C. Albrecht), Kulturökologie (P. Finke), Kulturraumstudien (H.-J. Lüsebrink) und Medienkulturwissenschaft (S. J. Schmidt) in Einzelbeiträgen präsentiert. Sie besitzen zumeist Überblickscharakter und stellen empfehlenswerte Einführungen dar.
Damit geht es in diesem Band nicht mehr um das ehrgeizige Projekt, eine neue Disziplin Kulturwissenschaft zu etablieren, sondern Kulturwissenschaften werden als Möglichkeit inter- und transdisziplinärer Zusammenarbeit, der Überschreitung von Grenzen, der Einführung neuer Methoden und Blickwinkel gesehen. Trotz dieser Breite muss die Dominanz literaturwissenschaftlicher Ansätze gerade in den einleitenden Beiträgen doch als problematisch angesehen werden. Eine Erneuerung der gesamten Geistes- und Sozialwissenschaften unter dem Label Kulturwissenschaften wird zwar gefordert, um dann doch immer wieder zu den Literaturwissenschaften und Philologien zurückzukehren. Außer Acht gelassen wird eine kulturwissenschaftliche Tradition, die in Deutschland kulturphilosophisch von Lazarus, Simmel und Cassirer und anderen, kulturhistorisch von Karl Lamprecht repräsentiert wird. Außerdem werden Versuche, Kulturwissenschaften als eigenständige Disziplin, wie es sie etwa in Leipzig und Berlin bereits seit den 70er Jahren gibt und die nach einer grundlegenden Erneuerung in den 90ern eigenständige Wege beschritten und wie sie sich seit den 80ern auch an verschiedenen westdeutschen Universitäten wie Bremen, Hildesheim, Lüneburg (bereits in den 70ern) und anderen entwickelten, im ganzen Band nicht berücksichtigt. Die „Schwierigkeit, das Profil der gegenwärtigen Kulturwissenschaften zu bestimmen“ (S. 9), wird dadurch nicht kleiner.Für die Medienforschung ist insbesondere der Beitrag zur Medienkulturwissenschaft interessant. Schmidt plädiert für die Ausbildung einer eigenen entsprechenden Forschungsrichtung in immer wieder unterschiedlichen disziplinären Zusammenhängen, ohne eine eigene Disziplin zu entwickeln, um so Forschungsflexibilität bewahren zu können. Damit grenzt sich Schmidt von einer einfachen Erweiterung der Literaturwissenschaft durch Medienthemen ab (vgl. Voßkamp „Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft“). Dazu bedarf es aber einer theoretischen Grundlegung, wie er sie hier versucht. Schmidt entwickelt seinen Ansatz, wie nicht anders zu erwarten, auf der Grundlage eines systemtheoretischen Ansatzes. Wirklichkeit, Kultur und Wissenschaft werden alle als Modi gesellschaftlicher Problemlösungen beschrieben (S. 365), woraus sich die Untersuchung von Problemen aus deren Zusammenwirken unter besonderer Berücksichtigung der Mediensysteme einer Kultur als Aufgabe für eine Medienkulturwissenschaft ableitet. So interessant Schmidts sehr theoretischer Zugang für manchen sein mag, so fehlt doch der für ein Handbuch wünschenswerte Überblick über den aktuellen Forschungsstand unter Einbezug auch anderer Ansätze.Insgesamt reiht sich der Band mit den meist sehr soliden, zum Teil sehr guten Beiträgen (zum Beispiel B. Bachmann-Medick „Kulturanthropologie“, Hof „Kulturwissenschaften und Geschlechterforschung“) von einschlägigen Autoren in eine immer länger werdende Liste kulturwissenschaftlicher Einführungen ein. Dafür ist er sicher, trotz einiger blinder Flecken, gut brauchbar, und wird seinem Anspruch, „einen bewusst multiperspektivischen einführenden und systematischen Überblick über die breite Palette der verschiedenen Richtungen und Konzepte in den Kulturwissenschaften zu geben“ (S. XII), durchaus gerecht. Gewinnen könnte das Vorhaben, ein Handbuch zu erstellen, wenn die Beiträge zu den verschiedenen Themenbereichen in eine einheitlichere Form gebracht würden. Damit würden Querverbindungen sichtbar und Redundanzen vermeidbar.
Schulen ans Netz e. V. (Hg.): lehrer-online
Digitale Medien werden heute wie selbstverständlich in die Unterrichtsgestaltung einbezogen. Lernen ist zu einem multimedialen Prozess geworden. Schulen ans Netz e. V. schuf 1998 im Auftrag des Bundesministerium für Bildung und Forschung die Plattform Lehrer-Online. Das umfangreiche Online-Portal bietet Unterrichtseinheiten und Fachartikel, die Lehrenden die Vorbereitung auf den Unterricht erleichtern sollen. Das gleichnamige Buch gibt einen Überblick über den schnellen und effektiven Umgang mit der Website Lehrer-Online. Es bietet Tipps, wie Lehrer und Lehrerinnen mithilfe der Website den eigenen Unterricht leichter vorbereiten, Material finden und anpassen können. Neben der Vorstellung von Lehrer-Online liefert das Buch auch einen technisch-funktionalen Wegweiser für die Nutzung des Portals. Der praxisbezogene Schwerpunkt des Buches beschäftigt sich mit Unterrichtseinheiten für alle Fächer und Jahrgangsstufen und bietet Anregungen zum Einsatz neuer Techniken im Umgang mit digitalen Inhalten im Unterricht. Sowohl die Aspekte von pädagogisch verantwortlichen Arbeiten mit dem Internet als auch Chancen und Risiken des webbasierten Unterrichts werden thematisiert. Ein umfangreiches Handbuch also für Lehrer und Lehrerinnen, die mithilfe von Lehrer-Online die Unterrichtsgestaltung planen.
kolumne
Bernd Schorb: Ich habe kein Handy
„Könnten Sie mir bitte Ihre Handynummer geben, damit ich Sie erreichen kann?“ „Ich ruf’ dich dann auf dem Handy an!“ „Tragen Sie hier die Nummer Ihres Mobiltelefons ein.“ Alle diese Aufforderungen, die mir täglich begegnen, beantworte ich mit „Nein“ oder gar nicht. Ich habe kein Handy. Handelt es sich bei dem Auffordernden um ein Formular, ist die Sache in Ordnung. Handelt es sich um einen Partner aus dem Bereich des Dienstlichen, erfolgt oft erst die Wiederholung der Frage und dann das Stirnrunzeln mit der unausgesprochenen Feststellung: Ein seltsamer (manche denken auch noch: alter) Kauz. Freunde und gute Bekannte fragen: „Wie?“ oder „Warum?“ Dann muss ich erklären.Anfangs war mir das Mobiltelefon noch zu teuer. Außerdem regten mich die Angeber auf, die immer dann, wenn eine ausreichend große Menschenmenge um sie herumstand, ihr damals noch dickleibiges Mobiltelefon herauszogen und mit wichtiger Miene höchst Wichtiges verkündeten: „Mutti, ich steig jetzt gleich in den Flieger ein.“ Später dann, als jeder, der so bedeutend war, dass er dienstlich auch unterwegs erreichbar sein musste, ein Handy hatte, wurde der Druck größer. „Wenn du nicht erreichbar sein willst, dann kannst du das Handy ja abstellen. Aber wenn mal was Wichtiges ist!“ Schön wär’s! Mein Problem ist, ich kann das Handy nicht abstellen.Zuhause hatten wir ein paar Jahre lang das einzige Telefon in der Siedlung. Das schwarze Gerät stand im Hausflur direkt unter dem Spiegel gegenüber der Eingangstür.
Wer zu uns kam, sah zuerst das Telefon. Wenn es läutete, konnte eine Oma gestorben oder ein Kind geboren sein, eine Fuhre Kohle geliefert werden oder mein Vater verkündete seine verspätete Ankunft zum Essen. Ausschalten konnte man da nichts. Das Kabel wuchs aus der Wand, es war ein Teil des Hauses. Das Klingeln dieses Telefons war bedeutungsvoll, viele Jahre lang. Heute, wo die Handy-Versorgungsrate in Deutschland 107,3 Prozent beträgt, weil außer ein paar Alten jeder ein Handy hat und viele sogar zwei, gelte ich als verschroben. Da habe ich aber nichts dagegen. Ich möchte weiterhin nicht erreichbar sein dürfen und auch nicht jederzeit telefonieren können müssen. Wenn der Zug wieder mal Verspätung hat, ist meist ein Schaffner so nett und leiht mir sein Diensthandy. Natürlich beeindrucken mich die Zeitungsmeldungen von dem einsamen Wanderer, der in den Alpen vom Weg abgekommen ist und dank der Möglichkeit, sein Handy zu orten, gerettet werden konnte. Aber ich frage mich auch, ob ich überall und jederzeit und überhaupt von unserem Innenminister geortet werden will. Tief beeindruckt war ich auch, als ich letztes Jahr im Himalaya mit einigen anderen Wanderern auf 4.000 Meter Höhe eingeschneit war und eine Schweizerin über ihr Handy per Satellit ihren Mann in Wägis anrief und der in Echtzeit im Netz die Wetterentwicklung am Anapurna prüfte und die Auskunft gab, dass es weiter schneien wird.
Wie lange ich das Privileg, autonom zu entscheiden, wann ich erreichbar bin und wann nicht, noch halten kann, weiß ich nicht. Es trifft mich der Vorwurf des Snobismus: „Das muss man sich erst mal leisten können.“ Es ist eigentlich auch ganz bequem, immer und überall Kontakt mit anderen aufnehmen zu können. Zuletzt habe ich geschwankt, als ich eines der Gesamtpakete von 1+1 angeboten bekam. Ich bin darauf eingegangen, allerdings ohne Handy. Das war richtig, denn der Kundendienst fürs Internet ist so miserabel, dass ich froh bin, mich nicht auch noch mit einem selten funktionierenden und falsch abgerechneten Handy herumschlagen zu müssen.
Ansprechperson
Kati StruckmeyerVerantwortliche Redakteurin
kati.struckmeyer@jff.de
+49 89 68 989 120
Ausgabe bei kopaed bestellen
Zurück