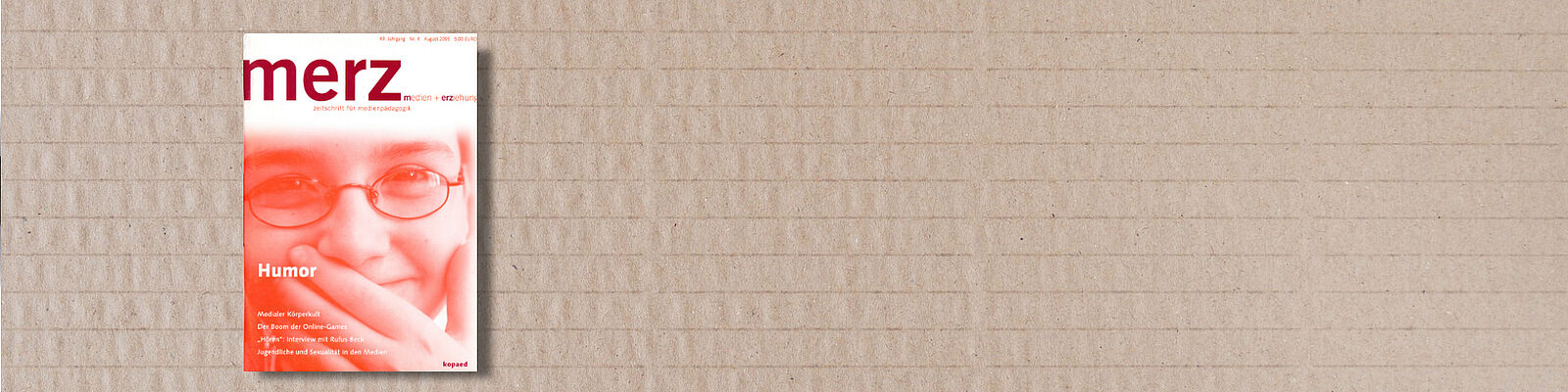2005/04: Humor
Humor und Spaß sind in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil in den Medien geworden und nehmen in unserer Gesellschaft einen bedeutenden Stellenwert ein. Besonders im Radio und im Fernsehen entstehen ständig neue Formate, die von den Heranwachsenden geschätzt werden und mit denen sie sich intensiv beschäftigen.merz berichtet über den aktuellen Stand der Forschung, über theoretische und praktische Erkenntnisse zum Humor, und schildert die positiven und negativen Erfahrungen von Jugendlichen im Umgang mit dem alltäglichen Phänomen.
thema
Anja Hartung: Was ist Humor?
Ausgehend von einer etymologischen und kulturhistorischen Betrachtung bietet der vorliegende Beitrag eine kursorische Skizze über wichtige Ansätze, Theorien und empirische Untersuchungen und fasst dabei wichtige Erkenntnisse zu Humorverständnis und -entwicklung von Kindern und Jugendlichen zusammen.
(merz 2005-04, S. 9-15)
Marion Bönsch-Kauke: „Ohne Spaß macht´s keinen Spaß!“
Humor-Verstehen als Erfassen und Senden von spaßigen Botschaften wird als lebenslanger Sozialisationsprozess skizziert. Fünf Knoten der Entwicklung - vom zaghaften Herantasten bis zum umfassenden Vergnügen für Sinne und Verstand -zeichnen sich ab.
Dazu werden die Chancen und Risiken des Umgangs mit humorträchtigen Situationen im Alltag der Erziehung vorgestellt.
(merz 2005-04, S.16-20)
Bernd Schorb: Spaß und Betroffenheit
„Spaß“ und „Gute Laune“ beherrschen neben Musik das Radioprogramm. Heranwachsende eignen sich die Inhalte an und gehen mit ihnen um, ihrem jeweiligen Alter entsprechend.
Besonders die Älteren sehen, dass Radiospaß nicht immer nur unterhaltsam ist, sondern auch verletzend und gewalttätig sein kann.
(merz 2005-04, S.21-28)
Hans-Dieter Kübler: Was ist denn da (so) lustig...?
Das Forschungsfeld Medienkomik und Rezipientenhumor ist so komplex, dass es von einer Wissenschaftsdisziplin allein gar nicht erfasst werden kann.
Alle einschlägigen Forschungsarbeiten beklagen bis heute, dass dieses Feld weitgehend unerforscht ist, so dass sich noch kaum überzeugende theoretische Erklärungen finden lassen und erst recht wenig empirische Befunde vorliegen.
(merz 2005-04, S.29-34)
Ein Miesepeter in der Spaßgesellschaft: "Bernd das Brot"
Uneingeschränkter Star der KI.KA-Show „Chili TV“ ist das dauer-depressive, ewig nörgelnde Kastenbrot Bernd.
Seine misanthropische Verweigerungshaltung und sein schwarzer Humor bringen Kinder und Erwachsene zum Lachen.
Schöpfer des Miesepeters ist die „bummfilm“ in München. Nadine Kloos sprach mit Erik Haffner - Miterfinder, Regisseur und Autor bei „bummfilm“ – über diese Arbeit.
(merz 2005-04, S.35-37)
Gunnar Poschmann: „Lustig sein ist harte Arbeit“
Das Wartburg-Radio in Eisenach ist ein vereinsgetragener offener Hörfunk-Kanal, Menschen zwischen 9 und 81 Jahren machen ehrenamtlich Radio, üben sich im kritischen Umgang mit Medien und ergänzen mit ihren Sendungen die Medienlandschaft der Thüringer Stadt. Spaß ist das Motiv, das alle Mitwirkende eint und gleichzeitig der Lohn für die unbezahlte Tätigkeit als Redakteur und Moderator beim Lokalsender.
Doch ist Spaß für einen 15-jährigen Schüler das Gleiche wie für eine 65 Jahre alte Rentnerin? Was ist Spaß und wie lässt sich Spaß im Radio umsetzen?
(merz 2005-04, S.38-42)
spektrum
Petra Milhoffer: Medien als Aufklärungsquelle
Welche Einstellungen haben Mädchen und Jungen zum Thema Sexualität, welche Informationsquellen nutzen sie für ihre Aufklärung und was halten sie vom Thema Sex in den Medien? Wie bestimmt die kulturelle Herkunft ihre Haltung dazu?
Auf der Grundlage einer empirischen Studie an der Universität Bremen unter rund 500 Kindern und aktuellen Befragungen zeigt sich: Schon jüngere Kinder besitzen ein hohes Maß an „sexueller Kompetenz“, dennoch bleiben viele Unsicherheiten, die sie mit Erfahrungen aus den Medien auszugleichen versuchen.
(merz 2005-04, S. 43-48)
Jin-Suk Kang: Förderung von Medienkompetenz
Mit der wachsenden Bedeutung der "neuen Medien" entwickelt sich auch die gesellschaftliche Diskussion über die "digitale Spaltung".
In diesem Beitrag wird zunächst der theoretisch-fachliche Diskurs über den Begriff der Medienkompetenz erörtert. Im Anschluss werden Initiativen und Projekte des Bundes zur Förderung der Medienkompetenz als Beispiel aus der Praxis vorgestellt.
(merz 2005-04, S. 49-54)
Melanie Knijff: Medialer Körperkult
Der Einfluss der Medien auf das eigene Körperbild und die Gestaltung des Körpers ist deutlich, denn sie tragen weltweit zur Verbreitung von Schönheitsidealen bei.
Durch Medienbotschaften wird die Aufforderung, sich permanent mit dem eigenen Körper auseinander zu setzen, in die Identitätsbildung einbezogen und kann so zu einem dauerhaften Problem werden.
(merz 2005-04, S.55-60)
Ulrike Wagner: Der multi-mediale Blick
Am JFF - Institut für Medienpädagogik und Praxis wird aktuell der qualitative Teil der Studien zum "Umgang Heranwachsender mit Konvergenz im Medienensemble" durchgeführt. Die Studien befassen sich mit Entwicklungen auf dem Medienmarkt, die unter dem Begriff Medienkonvergenz zusammengefasst werden. Die Untersuchung stellt die Perspektive der Heranwachsenden in den Mittelpunkt.
(merz 2005-04, S.61-62)
Rufus Beck: „In Verbindung mit uns selbst“
Im hart umkämpften Medienmarkt gibt es nicht mehr viele Segmente, die pro Jahr zweistellige Zuwachsraten verzeichnen. Der Markt der Hörmedien gehört dazu.
Um zu verstehen, was der Grund für den Boom in einer bisher eher verschlafenen Branche ist, interviewte merz den unbestrittenen Star der Szene: Rufus Beck, vor allem durch "Harry-Potter-"Lesungen" oder besser die -"Darstellungen" bekannt.
(merz 2005-04, S.63-65)
Susanne Friedemann: Infos zu Hörmedien
Das Angebot zum Thema "Hören" allgemein und zu Hörmedien im besonderen wächst inzwischen beinahe täglich.
Um die konkrete medienpädagogische Arbeit zu unterstützen, sind hier nützliche informationsquellen im Internet zusammengestellt.
(merz 2005-04, S.66-67)
Elke Dillmann, Elke Stolzenburg: Jugendradiofestival „HörMal“
Am 9. und 10. Juli fand zum ersten Mal das bayerische Jugendradiofestival in Nürnberg auf dem Gelände des BR-Studios Franken statt.
(merz 2005-04, S.68)
Beitrag aus Heft »2005/04: Humor«
Autor: Elke Dillmann, Elke Stolzenburg
Beitrag als PDFEinzelansicht
medienreport
Michael Grisko: Fernsehmuseum Berlin
Mit einer Ausstellung zu Fernsehen und Fußball soll das Fernsehmuseum Berlin im Frühjahr / Som-mer 2006 eröffnet werden. Realisiert wird das Fernsehmuseum von der Stiftung Deutsche Kinemathek, unterstützt vom Senat für Kultur und Wissenschaft des Landes Berlin, gefördert von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin und der Europäische Fond für Regionale Entwicklung (EFRE) stellen knapp vier Millionen Euro für den Aufbau des bundesweit einmaligen Museums zur Verfügung. Auf einer Fläche von insgesamt 1.200 Quadratmetern ist im Filmhaus am Potsdamer Platz eine Dauerausstellung zur deutschen Fernsehgeschichte, eine Programmgalerie, in der Sendungen aus 50 Jahren Fernsehen wiederentdeckt werden können, ein Medien- und Technologielabor sowie Sonderausstellungen und Veranstaltungen zum Medium Fernsehen geplant.
merz: Warum ausgerechnet ein Fernsehmuseum? Kann man Fernsehen überhaupt musealisieren?
Kubitz: Nach einem halben Jahrhundert ist das Fernsehen reif fürs Museum.Es hat seine ganz eigene Geschichte ausgeprägt, seine eigenen Formen des Erzählens, die ganz anders funktionieren als die des Kinos. Fernsehen findet praktisch in jeder Wohnung statt. Die Bilder, die es dem Zuschauer täglich entgegenbringt, sind höchst unterschiedlich: Solche von hohem künstlerischen Niveau stehen neben platter Alltagsware, die für den schnellen Konsum produziert wird. Die Werbung neben den Nachrichten. Der Krimi neben dem Kleinen Fernsehspiel. Der Sport neben dem Wahlspot. Die Volksmusik neben dem Video-Clip und dem großen politischen Life-Ereignis, das Menschen - wie beim Fall der Mauer, am 11. September 2001 oder bei der Beerdigung des Papstes - über alle nationalen und kulturellen Grenzen hinweg vor dem Bildschirm „vereint“. Diese Vielfalt im Besonderen und im Alltäglichen ist Gegenstand unseres Fernsehmuseums, des ersten seiner Art in Deutschland. Und das nicht zuletzt deshalb, weil sich viele diese Bilder im individuellen und kollektiven Gedächtnis festgesetzt haben. Sie sind Teil unserer Biografien geworden und gleichzeitig berichten sie in einem breiten Spektrum von den ökonomischen, den geistigen und den politischen und sozialen Veränderungen und Konstanten in unserer Gesellschaft.
merz: Was ist die besondere Herausforderung? Und wie dynamisch muss ein solches Museum angesichts der immer kurzfristigeren Programmtrends sein?
Kubitz: Wir sind vier Kuratoren, die sich durch die Bilderwelt der Fernsehgeschichte, nicht nur aber vor allem der nationalen, der aus Ost- wie aus Westdeutschland, arbeiten, immer auf der Suche nach dem besonderen Stück, das nicht vergessen werden darf, weil in ihm mehr angelegt ist als ein modischer Aspekt, mehr als der Zeitgeist sozusagen. Auf der Suche nach jenem Stück, das in der Programmgalerie unseres Museums seinen besonderen Platz erhält und dort von den Besuchern in ganzer Länge und kommentiert mit Materialien aus unserer Datenbank (Produktionsangaben, Kritiken, Interviews mit den Beteiligten zum Beispiel) wiedergesehen, neu gesehen und bedacht werden kann. Unabhängig davon, ob und wann unsere Partner, die Sender (privat-kommerzielle wie öffentlich-rechtliche), es noch einmal zeigen werden. Die Sendung, der Beitrag, die Show, der Film, die es bei uns geschafft haben, in die Programmgalerie aufgenommen zu werden, gehören damit gewissermaßen zum Fernseh-Olymp. Das gilt nicht nur für einzelne Produktionen, das gilt natürlich auch für Personen, für die Stars, die für ein ambitioniertes, couragiertes, ungewöhnliches Programm stehen. Das Genre spielt dabei keine Rolle, es kommt auf die Qualität an. Es geht da bei uns ein bisschen so zu wie beim Grimme-Preis, beim Deutschen oder beim Bayerischen Fernsehpreis.Anderseits wenden wir uns nicht in einer elitären Geste von dem seriellen Tagesprogramm ab, nach dem Motto „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern“. Denn dieses Programm ist ja signifikant für das Medium. Deshalb und weil sich das Fernsehen auf diesem Sektor täglich selbst auffrisst, zerstört und ständig neu erfindet, gehört als zweites Bein, als Spielbein zum Museum der Bereich der Sonderausstellungen, der Konferenzen und der Diskussionsforen. Dort widmen wir uns auch dem schnellen Geschäft, der Bildertrommel. Aber immer auch im Zugriff, mit Blick auf die so schnell aus dem Auge verlorene Vergangenheit. Die erste Sonderausstellung wird sich zur Eröffnung im kommenden Frühjahr mit der Sparte Sport, genauer mit der Geschichte des Fußballs im Fernsehen befassen - naheliegend anlässlich der WM 2006 in Deutschland. Unser Partner hier wird neben anderen die DFB-Kulturstiftung sein, die diese Ausstellung in ihr Hauptstadtkulturprogramm aufgenommen hat und sehr großzügig finanziell fördert.
merz: Wie sieht ein imaginierter Besuch im Fernsehmuseum aus?
Kubitz: Das Schöne ist ja: Jeder unserer Besucher ist, vom Kind bis zum alten Menschen, in gewisser Weise mit einer sehr eigenen Fernsehkompetenz ausgestattet. Deshalb kann sich jeder auch mit hoffentlich großem Gewinn im Museum aufhalten, wie und solange er will und dort verweilen, wo ihn unser Angebot besonders reizt oder anspricht. So gibt es zum Beispiel einen durchweg ver-spiegelten Raum, entworfen wie das ganze Museum von dem renommierten Architekten Hans-Dieter Schaal. In diesem Spiegelsaal wird die serielle Bilderwelt und Bildergeschichte des Fernsehprogramms noch einmal ins Unendliche fortgesetzt, eine spektakuläre Raumskulptur, in der sich, chronologisch geordnet, die Bilder des Programms auf so sonst nie zu sehende Weise noch einmal vor einem auftun, aufblättern. Diese Revue, diese Show wird 10 bis 15 Minuten dauern. So animiert kann der Besucher in einem zweiten Raum mehr informativ an die Sache herangehen und sich in einem Zeit-Tunnel die Geschichte des Mediums hinter den Programmbildern erzählen lassen. Nicht nur die Technikgeschichte, sondern auch die aufregenden politischen Zusammenhänge, in denen das Fernsehen von Anbeginn eine Rolle spielte. Von den ersten Testbildern Ende der Zwanziger Jahre, den Fernsehversuchen auch in anderen Ländern, über die Nazizeit (in der allerdings das Radio als das große Propaganda-Instrument die wesentlich bedeutendere Rolle spielte), über den Aufbau des Fernsehens in den alliierten Sektoren ab 1945 bis hin zu den unterschiedlichen Entwicklungen in den beiden deutschen Staaten, die sich, parallel zum Ende des Kalten Krieges, erst 1989/90 miteinander verbanden.Über die Programmgalerie und den Bereich der Sonderausstellungen haben wir ja bereits gesprochen
merz: Wie sehen und nutzen Sie die Verbindung zum Filmmuseum im eigenen Hause? Müsste man angesichts der derzeitigen Entwicklungen nicht eher ein „Museum des Bildes“ eröffnen?
Kubitz: Ein „Museum des bewegten Bildes“ meinen Sie. Genauso ist es, genauso wird es sein. Wir verstehen das Filmhaus am Potsdamer Platz als einen Ort, an dem alle, die dort arbeiten, sich mit Leidenschaft der gleichen Sache, der Geschichte des bewegten Bildes, verschrieben haben und diese der Öffentlichkeit zur Unterhaltung und zu geistvoller Auseinandersetzung präsentieren wollen. Das gilt für die Freunde der Deutschen Kinemathek, mit den beiden Programmkinos Arsenal 1 und 2, ebenso wie für die Lehrer und Studenten der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, deren Arbeiten hoffentlich eines Tages auch einmal zum festen Programm unseres Museums, unserer Museen gehören werden. Und selbstverständlich gilt das auch für unsere ausgezeichneten Beziehungen zu dem großen Filmhaus-Nachbarn am Potsdamer Platz, der Berlinale.Es gibt - nimmt man noch die ganzen Kino- und Museums-Komplexe und die Philharmonie am Kulturforum hinzu - mithin keinen besseren Standort für das Film- und das Fernsehmuseum in dieser Republik als den Potsdamer Platz als Teil der neuen Mitte in der Hauptstadt.merz Was kann der geplante medienpädagogische Teil der Ausstellung leisten? Wie sieht er konkret aus?Kubitz Kurz und klar: Es fehlt - für das Kino wie für das Fernsehen - an unseren Schulen noch immer eine sinnvolle, systematische Einführung in die Regeln und Gesetze der Sprache des bewegten Bildes. Da sind wir in Deutschland, verglichen mit anderen europäischen Nachbarn, Frankreich zum Beispiel, wahre Analphabeten.
Unterstützt von den Landesmedienanstalten, unterstützt zudem von unserem Großsponsor „Veolia“, arbeiten wir im Fernsehmuseum auch an einem Medienlabor, in dem wir, in Kooperation mit drei ganz unterschiedlichen Schulen in Berlin, ausprobieren werden, was auf diesem Gebiet möglich ist.Vorschau unter www.filmmuseum-berlin.de
Tilmann P. Gangloff: Fernsehen macht dick?
Eigentlich ist Abnehmen ja ganz einfach. Nicht weniger essen, sondern das Richtige, und dazu mehr Bewegung: schon purzeln die Pfunde. Trotzdem werden viele Kinder immer dicker. Schuld daran, sagen Erziehungswissenschaftler und Medienpädagogen wie etwa Stefan Aufenanger von der Uni Mainz, sei nicht zuletzt das Fernsehen: „Kinder werden durch den Bewegungsmangel dick, und die Werbung für Süßigkeiten und andere zuckerhaltige Produkte sowie für Fastfood führt zu Übergewicht.“Es gibt Indizien, die diese Behauptung belegen: In der Datenbank des Internationalen Zentral-instituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI, München) finden sich 50 Studien zu dem Thema. Laut IZI-Leiterin Maya Götz zählt Süßigkeiten- und Cerealienwerbung wie zum Beispiel Cornflakes zur häufigsten Reklame im kinderrelevanten Fernsehumfeld. Die Wirkung dieser Werbe-Spots, so Götz, sei nachgewiesen. Interessanterweise funktioniere die Nahrungswerbung aber nur für zuckerhaltige Produkte „richtig gut“.
Je öfter Kinder die entsprechenden Spots sähen, „desto häufiger bitten sie ihre Eltern, diese Produkte zu kaufen“. Spannend findet Götz dabei: „Während bei allen anderen Produkten wie Kleidung oder Spielsachen diese Art Werbe-Kaufbitten-Effekt stark mit dem Alter der Befragten variiert, bleibt sie bei Süßigkeiten-, Cerealien- und Fastfood-Werbung gleich“. Nicht zuletzt vermutlich aufgrund des Bewegungsmangels haben so genannte Vielseher (vier Stunden Fernsehen und mehr pro Tag) eine auffällig höhere Neigung zu Übergewicht als andere. Götz vermutet, dass diese Kinder zudem aber auch mehr essen. Laut einer Langzeitstudie steigt der „Body Mass Index“, die internationale Gewichtswährung, mit jeder Stunde, die Menschen pro Tag bewegungslos und untätig vor Bildschirmen verharren, um vier Prozent. Die IZI-Leiterin räumt jedoch ein, dass „ein zwingender Zusammenhang von Stunden des Fern-sehkonsums und Fettleibigkeit“ bislang nicht nachgewiesen sei. Wie immer in der Wirkungsforschung gibt es also auch in dieser Frage zu vie-le unberechen-bare Größen. Eine wichtige Rolle spielt beispiels-weise die Haltung der Eltern zur Ernährung der Kinder. Prompt wehrt sich der Medien-pädagoge Norbert Neuß (Uni Hamburg) gegen die eilige Schuldzuweisung: Schließ-lich seien die Kinder eben „auch das Resultat mangelnder Grenzen in einer von Über-fluss geprägten Konsumgesellschaft“.
Die Idee des Wachstums, die die Wirtschaft beherrsche, werde hier versinnbildlicht, denn natürlich betreffe gerade das Problem des Übergewichts die gesamte Bevölkerung. Laut Maya Götz zeigen die Ergebnisse der Wirkungsforschung, dass eine positive Änderung des Verhaltens deutlich schwerer sei, als bestimmte Produktnamen oder Images zu vermitteln: „Leckeres lernt sich einfach leichter“. Nun aber ist einer angetreten, der beweisen will, dass das Gegenteil möglich ist. Er heißt Magnús Scheving, kommt aus Island und ist dort ein Superstar; es kennt ihn buchstäblich jedes Kind. Oder richtiger gesagt: Jedes Kind kennt Sportacus. So heißt die Hauptfigur einer 35-teiligen Serie, die in Deutschland Kindersender Super RTL seit dem 8. August täglich um 17.00 Uhr zeigt. Sportacus ist ein Superheld ohne Superkräfte; seine beeindruckende Fitness hat er in erster Linie dem Obst zu verdanken. Er lebt in LazyTown, einem Ort, in dem die Menschen grundsätzlich zu Bequemlichkeit neigen. Schuld daran ist vor allem ein Fiesling namens Robbie Rotten, der zwar alle Aktivität sabotiert, von Sportacus aber immer wieder übertölpelt wird. Zehn Jahre lang hat Scheving das Konzept in Island getestet, bevor er damit in Serie ging. Zunächst war es bloß ein Kinderbuch, dann ein Musical, das monatelang vor ausverkauftem Haus aufgeführt wurde.
Endgültig bestärkt wurde Scheving durch eine Kampagne, die er gemeinsam mit den Behörden durchführte: Alle isländischen Familien bekamen ein Kochbuch geschenkt; mit Hilfe von Aufklebern und Tabellen konnten die Kinder miteinander wetteifern, wie gesund sie sich ernähren. Die Folge: In der Zielgruppe stieg der Verzehr von Obst um knapp 15 Prozent, Limonaden hingegen verloren in etwa gleicher Größenordnung. Dafür wurde Scheving mit dem Skandinavischen Gesundheitspreis ausgezeichnet. „LazyTown“ wurde nach der Premiere beim amerikanischen Nickelodeon-Ableger für Vorschulkinder, Nick Jr., prompt zum Knüller. Kein Wunder, denn Magnús Scheving trifft einen Nerv: Für diese Zielgruppe gibt’s sonst bloß rührselige Geschichten, die stets ohne Bösewicht auskommen müssen. „LazyTown“ aber hat einen echten Schurken und einen vortrefflichen Helden zu bieten. Der wiederum beeindruckt weniger durch begnadetes Schauspiel, sondern vor allem durch atemberaubende Beweglichkeit. Scheving liegt das im Blut: Vor zehn Jahren war er zwei Mal Europameister in Aerobic und um ein Haar auch Weltmeister. In seinem 5.000 Quadratmeter großen Studio verschmelzen hochmoderne Rechner Sportacus’ Waghalsigkeiten noch während des Drehs mit HDTV-Bildern aus dem Computer. Das hat seinen Preis: Die Kosten bewegen sich pro Episode bei 700.000 Dollar; das ist etwa das Doppelte des üblichen Budgets.
Die 1995 gegründete Firma LazyTown Entertainment ist mitt-lerweile 100 Millionen Dollar wert. Wenn produziert wird, arbeiten hier 130 Menschen; die Serie ist bereits in 78 Länder verkauft. In Island wurde Scheving unlängst zum Unternehmer des Jahres gekürt. Trotzdem lässt er es sich nach dem Gespräch nicht nehmen, eigenhändig den Tisch abzuräumen. Der Mann ist einfach ein Phänomen.
Michael Grisko: Weder Populärkunst noch Akademikerkanon: DVD-Reihe der SZ
Erfolgreichster Vorreiter der multimedialen „Tschi-boisierung“ des Zeitungsmarktes war und ist die Süddeutsche Zeitung. Nach einer Reihe mit günstigen Romanen und CDs im Bereich klassischer Musik, erscheint nun jede Woche – auflagenstark und prominent im eigenen Feuilleton beworben – eine DVD der „SZ-Cinemathek“ im Buchhandel. Sebastian Berger, Pressesprecher der SZ, sieht diese Aktion „als logische Fortsetzung der bisherigen Projekte“, denen weitere (geplant ist eine Pop-Musik-Edition als CD- und Buch-Package) folgen werden. Während die im letzten Jahr verkaufte DVD-Edition des „Stern“ kaum zur Kenntnis genommen wurde – und das trotz oskarprämierter Highlights – liegen die Verkäufe, nach Angaben des Verlags, „innerhalb der Erwartungen“. Profitiert wird dabei von einem insgesamt boomenden DVD-Geschäft.Dabei erhebt die Auswahl der 50 Silberlinge nicht den Anspruch eines – wie auch immer definierten – filmgeschichtlichen Kanons oder beschränkt sich auf deutschsprachige Filme. Das ist strategisch sehr klug. Denn gerade an diesem seit seiner Erfindung stark internationalisierten Medium Film müsste eine Kanonkonzentration auf 50 Beispiele zwangsläufig scheitern.So erfolgte die Auswahl der Regisseure nach „subjektiven Kriterien der Feuilletonredaktion“ und ist somit weder ein Kanon nach „Geschmackskriterien noch nach Popularität“ – verzichtet wurde jedoch auf Stummfilme, so dass etwa ein Film Sergej Eisensteins, Fritz Langs oder David W. Griffith fehlt.
Dafür sind aber Billy Wilder („Küss’ mich Dummkopf“) und Ernst Lubitsch („Ninotschka“) mit Ihren frühen Tonfilmen vertreten. Auffälligerweise fehlen ebenfalls Werke von Fassbinder, der sicherlich in eine Reihe mit Alfred Hitchcock („Der unsichtbare Drit-te“), und Orson Welles („Im Zeichen des Bösen“) gehört. Allein angesichts dieser beiden Leerstellen könnte die Reihe nicht mehr den Anspruch eines filmgeschichtlichen Überblicks beanspruchen. Stummfilmklassiker fielen sicher den pessimistischen Umsatzerwartungen zum Opfer, was auch die Absenz eines DEFA-Films, etwa von Wolfgang Staudte oder Frank Beyer erklären könnte. Bei den Fassbinder-Filmen lassen sich eher Lizenzprobleme vermuten. Auch wenn von Seiten des Verlages betont wird, man habe nahezu alle gewünschten Lizenzen bekommen. Innerhalb dieses Rahmens, der neben dem Redaktionsgeschmack indirekt auch die Vorlieben der Leserschaft und des darüber hinaus erwarteten Publikums bedient, ist die Auswahl überraschend - und das in jeder Hinsicht. Sowohl im Bereich der Genres als auch im Bereich der ästhetischen Stilbildung sind zahlreiche Klassiker und Wiederentdeckungen berücksichtigt.
So finden sich Beispiele des Italienischen Neorealismus, der Nouvelle Vague („Fahrenheit 451“, „Die Verachtung“), des Film Noir ebenso wie Vertreter der dänischen Dogma-Filmbewegung („Das Fest“) und des Hollywood-Mainstreamkinos („Terminator 2“, „Out of Sight“, „Magnolia“). Hinzu kommen Publikumslieblinge (wie „Harold and Maude“) und Klassiker („Uhrwerk Orange“, „Die Katze auf dem heißen Blechdach“, „Haie der Großstadt“), aber auch richtige Raritäten (et-wa Josef von Sternbergs „Marokko“). Festzuhalten gilt: Es ist zunächst eine Auswahl für Cineasten. Gleichwohl bieten einzelne Filme der Reihe mit der entsprechenden kino- und stilgeschichtlichen Kontextualisierung auch die Möglichkeit, internationale Filmgeschichte zu schreiben. Die Zusatzfeatures sind knapp gehalten: Neben der Mög-lichkeit, zwischen Original- und Synchronfassung (gelegentlich auch Untertitel) zu wäh-len, verzichten die Herausgeber – sicherlich auch aus Kostengründen – auf weitere Bonusmaterialien, ledig-lich im Booklet findet man einige Hinweise zum Making-of und zur Biografie des Regisseurs.
Susanne Friedemann: Fußball erklärt die Welt
Fußball ist die Sportart, die alle Welt verbindet – denn überall haben Menschen Freude am Spiel, überall gelten die gleichen Regeln. Fußball ist Sport. Fußball ist Leidenschaft. Fußball ist Leben. Doch dass das nicht allerorts so aussieht wie in Deutschland, zeigen eindrucksvoll die Beiträge der Lehr-DVD „Die Welt ist rund. Fußballträume – Fußballrealitäten“. Besonders vor dem Hintergrund der anstehenden WM 2006 „im eigenen Land“ bieten die fünf Kurzfilme und Dokumentationen einen Ansatz, sich mit weltpolitischen Problemen zu beschäftigen. Sie machen begreiflich, dass Fußball längst nicht nur begehrenswerter Profi- oder begeisternder Freizeitsport ist, sondern beispielweise auch wichtige und zugleich gehasste „Nahrungsquelle“.
Die Themen der Beiträge sind vielfältig: Sie zeigen Fußballspiel und Erfindergeist, Verschuldung und Kinderarbeit, religiöse Restriktionen und Fußballträume, Spielgemeinschaften und Klassenunterschiede, verheißungsvollen Spielertransfer und enttäuschende illegale Machenschaften. Verschiedenste Schicksale junger Menschen aus aller Welt, deren Leben durch Fußball geprägt sind, geben Anstoß, Euphorie zu hinterfragen und soziale Hintergründe in eigene Überlegungen aufzunehmen. Doch es werden keineswegs nur schwermütige Gesichter gezeigt – richtige Lausbuben und -mädchen sind es mitunter, die ihre Lebenswelt vorstellen und für reichlich Identifikationspotential sorgen. Lustige Nebeneffekte erzielen zum Beispiel wohlbekannte Moralpredigten Erwachsener gegenüber den fußballverrückten Kindern, die all ihre Kreativität nutzen, um gemeinsam möglichst viel Spaß zu haben.
Wenn dann die Fußbälle noch aus mit Stoff und Faden umwickelten Kondomen (!) be-stehen, die eigentlich der AIDS-Verhütung in Ent-wicklungsländern dienen sollen, ist eine Brücke zur globalen Betrachtungsweise geschlagen, die als Diskussionsgrundlage taugt und auch ordentlich im Gedächtnis haften bleibt.Die neben den Filmen auf der DVD enthaltenen Begleitmaterialien (im PDF-Format) fordern eine gezielte Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Entwicklungen und weltweiten wirtschaftlichen Verflechtungen. Geboten werden Unterrichtsvorschläge, Arbeitsblätter und Fotomaterial für den Unterricht der Klassen 4 bis 12.
Thomas Jacob: GTA San Andreas
San Andreas ist der neueste Teil der GTA-Reihe, eine Serie von Computerspielen, die Maßstäbe setzt in Detailreichtum und Spielwitz – aber auch in der Gewaltdarstellung.Schauplatz des Spiels ist der fiktive US-Staat San Andreas in den frühen neunziger Jahren. Der Spieler übernimmt die Rolle von Carl, der in seine Heimatstadt zurückkehrt. Dort schickt er sich an, zum Anführer der mächtigsten Gang in San Andreas zu werden.Wie alle GTA-Spiele ist auch San Andreas eine Mischung aus Autorennen und Actionspiel.
Der Spieler kann sich in der riesigen Stadt völlig frei bewegen – entweder zu Fuß oder im Auto. Auf den Straßen herrscht ständig dichter Verkehr, und CJ kann jedes Auto anhalten, den Fahrer gewaltsam aus dem Wagen zerren und davonfahren. Wie man an diesem Fakt schon merkt, geht es in San Andreas nicht zimperlich zu. Derzeit ist San Andreas in den USA erneut ins Kreuzfeuer geraten. Grund ist aber nicht etwa die dargestellte Gewalt, sondern eine kleine, von Fans programmierte Modifikation. Damit können einige verborgene Sexszenen im Spiel freigeschaltet werden. Was hierzulande eher für Belustigung sorgt, ist in den USA ein Skandal.
Wahrscheinlich müssen die Entwickler nun zum ersten Mal ein Spiel der GTA-Reihe vom Markt nehmen - für eine sexfreie Version.
Daniel Ammann: Hotzenplotz!
Der Räuber Hotzenplotz. CD-ROM, Win 98 / ME / 2000 / XP, Mac ab 8.1 / OS X. Nach Motiven des Buches von Otfried Preussler. Mit Illustrationen von F. J. Tripp. Berlin: Cornelsen 2004, 24,95 n
Zwischen Buchdeckeln, im Hörspiel oder Film (mit Gert Fröbe) treibt der berüchtigte Räuber Hotzenplotz nach wie vor sein Unwesen. Der „Mann mit den sieben Messern“ zählt zu den beliebtesten Unholden der Kinderliteratur und macht neuerdings die Computerbildschirme unsicher. Auf der CD-ROM dürfen Kinder ab etwa sechs Jahren dem mutigen Kasperl und seinem Freund Seppel zur Seite stehen, wenn es gilt, Großmutters melodiöse Kaffeemühle wiederzubeschaffen und den Übeltäter hinter Schloss und Riegel zu bringen. Im Verlaufe dieses abenteuerlichen Unterfangens wird natürlich auch die Fee Amaryllis gerettet und der böse Zauberer Zwackelmann findet sein verdientes Ende.
Die erste multimediale Umsetzung verhilft dem Kinderbuchklassiker von Otfried Preussler aus dem Jahr 1962 zu neuer Frische und präsentiert die turbulente Geschichte als gelungenes Kasperletheater mit originalgetreuen Zeichentrickszenen. Um die Handlung zu raffen, treten immer wieder Figuren als Erzähler vor den Vorhang und leiten zur nächsten Episode über. An insgesamt acht Schauplätzen müssen Klickpunkte gefunden und verschiedene Spielaufgaben in zwei Schwierigkeitsstufen bewältigt werden. Die sieben Denk- und Geschicklichkeitsspiele verlangen genaues Zuhören, Beobachtungsgabe, Sachwissen sowie Geduld und schnelles Reaktionsvermögen. Die musikalische Einbettung der Erzählung sowie professionelle Sprecherstimmen lassen die Spielgeschichte auch zum Hörvergnügen werden. Neues vom Räuber Hotzenplotz für den Computer ist ab September zu erwarten.
Susan Gürber: Safari mit Oscar
Oscar der Ballonfahrer entdeckt Afrika: Die Savanne. CD-ROM, Win 98 / ME / 2000 / XP, Deutsch und Englisch. Berlin: Tivola 2004, 24,95 n
Oscar, der kleine Junge mit grossem Entdeckergeist, hat auf früheren CD-ROMs die Tierwelt der Berge, der Wiese und des Waldes erkundet. Seine jüngste Entdeckungsreise, zu der er Kinder ab vier Jahren einlädt, führt in die Savanne Afrikas.Wir landen dort, die mit detailreichem Screendesign und authentisch anmutenden Tierlauten und Naturgeräuschen überzeugend vorgeführt wird. Nun können wir wählen, welches der sieben Tier-Habitate wir mit Oscar zuerst besuchen. Die Schauplatzabfolge bestimmen wir selber, und dank der auf dem Bildschirm stets verfügbaren Hilfestellung gelingt die Navigation durch die Szenerie problemlos.
Um die Tiere und ihre Lebensweise zu dokumentieren, können wir Oscar mit der stets griffbereiten Kamera Fotos schießen lassen und diese im Reisetagebuch einordnen, kommentieren und ausdrucken. An jedem Schauplatz testen verschiedene Spiele Geschicklichkeit und Merkfähigkeit, und am Schluss gelangt Oscar nur zu seinem Ballon, wenn er mit unserer Hilfe Fragen zur Lebensweise der Tiere richtig beantwortet.Diese interaktive Wissenssafari lässt sich auf Deutsch oder Englisch spielen, wobei sich die beiden Sprachversionen vom sprachlichen Niveau her je an muttersprachliche Kinder richten.
Susanne Friedemann: Neuer Anstrich für Piano
Piano wird rot. Eine Instrumentenfabel von Sven-Michael Bluhm. SMB-Verlag Hamburg 2004, www.smb-verlag.de, 12,50 € (CD) / 8,50 € (MC)
Eine „Instrumentenfabel“, so der Untertitel zum nunmehr vierten Kinder-Hörspiel dieser Reihe von Sven-Michael Bluhm. Nicht Menschen oder Tiere spielen die Heldenrollen. Nein, Instrumente sind es, die heimlich ein eigenes Dasein unter uns führen und ebenfalls mit den Höhen und Tiefen des Lebens zu kämpfen haben.Die Hauptakteure dieser Fabel sind ein liebevoll-brummiges Cello, ein schüchternes Piano, eine aufgeweckte Viola und ein gemütlicher Kontrabass, die miteinander auf dem Dachboden einer alten Schule leben. Große Veränderungen stehen bevor: Piano und Cello sollen restauriert werden! Das sorgt natürlich für einige Aufregung, soll doch Piano rot gestrichen werden. Das macht schon mal so viel Angst, „dass einem die Saiten im Bauch“ weh tun.
Ein Glück nur, es gibt Freunde, denen egal ist, wie man aussieht.In der ruhig und dennoch spannend erzählten Fabel, die an Großvaters Märchenstunden erinnert, geht es um Mut, Neues zu wagen und Freunden beizustehen. Die Sprecher hauchen den Instrumenten liebenswerte Gesten ein; die untermalenden Klangeinlagen vom behäbigen Knorksen bis zum freudigen Klimpern harmonieren perfekt mit den Charakterzügen und Bewegungen der einzelnen Figuren. Geschickt eingebaute wörtliche und musikalische Verweise auf Berühmtheiten wie Prokofjew mit „Peter und der Wolf“, Schumann, Wagner oder auch Shakespeare, lassen kleine und große (Mit-)Hörer die Schönheit klassischer Werke erfahren.
Dass dabei die dichterischen Neu-Schöpfungen des britischen Instrumentenfreunds „Englisch Horn“ nicht zu kurz kommen, die sich durch das ganze Abenteuer ziehen, belebt die Erzählung zusätzlich.Kurzum, eine liebevoll gestaltete Geschichte, die sich der wunderbar originalen Wirkung alt anmutender Musikinstrumente annimmt und diese zum Leben erweckt.
Manuela Grimm: Lieder machen Lust
Detlev Jöckers bunte Liederwelt. Das weiß Professor Superschlau! Menschenkinder Verlag und Vertrieb GmbH, Münster 2005. www.menschenkinder.de, 13,80 nKinder sind von Natur aus neugierig und können den Erwachsenen geradezu Löcher in den Bauch fragen. Detlev Jöcker nutzt die gesunde Neugier und den Spaß, den Kinder an Musik haben. Er gibt ihnen die Möglichkeit, ihren Wissenshorizont mit Liedern spielerisch zu erweitern.Insgesamt enthält die Audio-CD 14 Lieder, die sich jeweils einem bestimmten Thema widmen.
Lied Nummer 14 mit dem Titel „Am Himmel sieht man viele Wolken“, wendet sich bespielsweise der Wetterthematik zu. Im Booklet finden sich neben dem Liedtext unter „Das weiß Professor Superschlau“ dann noch nähere Wissensinfos zu den einzenlnen Liedthemen. In diesem Fall, welche Faktoren am Wetter beteiligt sind und wie Meteorologen versuchen das Wetter vorherzusagen.Eine sinnvolle Ergänzung für kleine und große Wissensdurstige ist das gleichnamige Begleitbuch. Es enthält zu jedem Lied themenbezogene Geschichten und interessante Hintergrundinformationen und Spielanregungen.
Bespielsweise können die Kinder zum Thema Indianer selbst kreativ werden, indem sie ein Tipi basteln oder die Geschichte „Kleine Feder“ durchlesen. Der Tonträger ist für Kinder ab ca. fünf Jahren geeignet.
Zurück