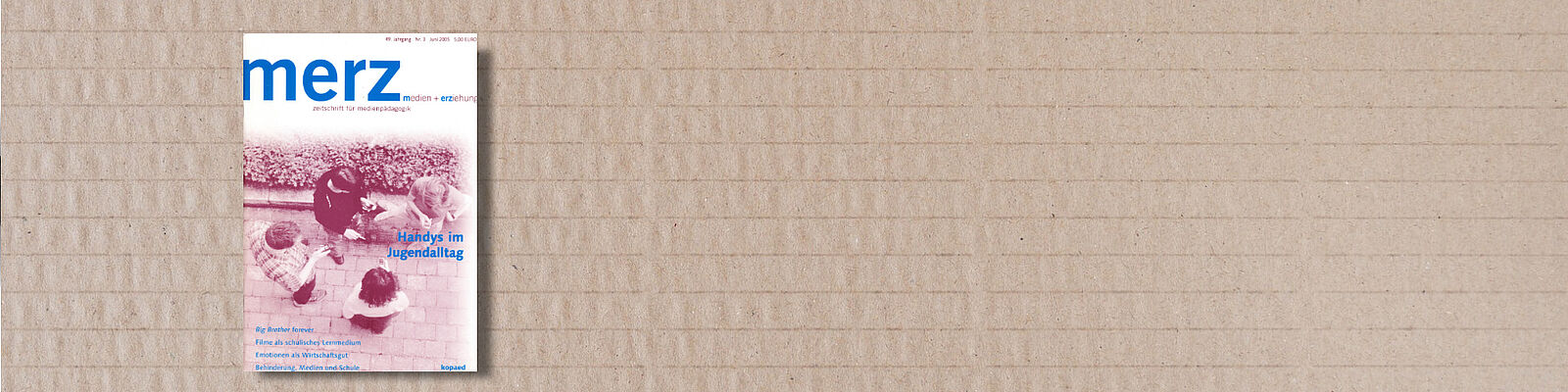2005/03: Handys im Jugendalltag
Das Mobiltelefon ist oft ein unverzichtbarer Teil des Lebens, besonders bei Jugendlichen und vielen Kindern. Ihr Alltag richtet sich nach den Fähigkeiten ihrer Handys: Kommunikation, Information, Entertainment. merz analysiert die jugendliche Handy-Welt, zeigt die positiven und problematischen Seiten eines intensiv genutzten Mediums.
thema
Claus J. Tully / Claudia Zerle: Handys und jugendliche Alltagswelt
Inzwischen verfügen rund 90 Prozent der Jugendlichen über ein Handy. Als Kommunikations- und Medienzentrale strukturiert es den mobilen Alltag und dient als Werkzeug zur Gestaltung und Organisation der Peergroup.
Gleichzeitig trägt es durch individualisierte Nutzung zur Identitätsfindung bei.
(merz 2005-03, S. 11-16)
Beitrag aus Heft »2005/03: Handys im Jugendalltag«
Autor: Claus J. Tully, Claudia Zerle
Beitrag als PDFEinzelansichtIren Schulz: Zwischen Reiz und Risiko
Kein Medium hat so schnell und unmittelbar Eingang in den Alltag von Heranwachsenden gefunden wie das Handy. Es bringt die Freunde näher, es macht flexibel und unabhängig.
Es ist aber auch Prestigeobjekt, Statussymbol und teures Freizeitvergnügen. Während Jugendliche einigen Handyfunktionen und -inhalten große Bedeutung beimessen, stehen sie anderen sehr skeptisch gegenüber oder sind verunsichert.
Hier eröffnen sich neue Arbeitsfelder für die Medienpädagogik.(merz 2005-03, S.17-23)
Lena Selmer: "Nicht nah, aber immer für Dich da!"
Nicht nur unter Jugendlichen, sondern auch in modernen Familien spielt das Handy eine immer größere Rolle.
Es hilft in Zeiten von beruflich und durch Freizeitaktivitäten bedingter Mobilität dazu, dass die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern trotz räumlicher Distanz funktioniert und dass auf Bedürfnisse spontan reagiert werden kann.
(merz 2005-03, S.24-28)
Nicola Döring: Handy und SMS im Alltag
Welche Bedeutung haben das Handy und besonders der SMS-Dienst für Kinder und Jugendliche?
400 Schülerinnen und Schüler wurden zu den wichtigsten Aspekten ihrer Handy- und SMS-Nutzung schriftlich befragt: Nutzungsintensität und Finanzierung, Nutzungsnormen, Kommunikationspartner, SMS-Anlässe und SMS-Sprache.
(merz 2005-03, S.29-34)
Beitrag aus Heft »2005/03: Handys im Jugendalltag«
Autor: Nicola Döring
Beitrag als PDFEinzelansichtKarin Ehler: Mittler zwischen den Generationen?
Die Landesstelle Kinder- und Jugendschutz Sachsen-Anhalt e.V. bietet Beratungen, Informationsveranstaltungen, Fortbildungen und Workshops zu Themen an, die im Zusammenhang mit dem Kinder- und Jugendschutzgesetz (JuSchG) oder dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag (JMStV) relevant sind, etwa im Bereich Computerspiele, Filme, aber eben auch Handy.
Für merz führte Karin Ehler ein Interview mit dem Geschäftsführer der Landesstelle, Arnfried Böker, über die jugendschutzrelevanten Aspekte des Handygebrauchs.
(merz 2005-03, S.35-39)
Infos zum Mobilfunk
Um die medienpädagogische Arbeit zu unterstützen, hat die merz-Redaktion einen Überblick über aktuelle Angebote rund um Handy und Mobilfunk zusammengestellt.
(merz 2005-03, S.42-44)
spektrum
Katrin Schuster: Big Brother forever
Das Format Big Brother ordnet sich ein in die so genannten Doku-Formate, die alle seit längerem einer zunehmenden Fiktionalisierung unterliegen.
Bei Big Brother lässt sich diese Fiktionalisierung als Privatisierung erkennen, die die Teilnehmer weitgehend sexualisiert und zugleich die öffentliche Gesetzgebung unterläuft, da im „Dorf“ ausschließlich willkürliche und teilweise gar nicht erst mitgeteilte Regeln und Vorschriften Geltung beanspruchen.
(merz 2005-03, S. 45-49)
Beitrag aus Heft »2005/03: Handys im Jugendalltag«
Autor: Katrin Schuster
Beitrag als PDFEinzelansichtBernward Hoffmann: "Kino macht Schule"
Seit gut einem Jahr gilt die bildungspolitische Parole „Kino macht Schule“.
Auch wenn der Freizeit- und Kulturort Kino und der Pflicht- und Bildungsort Schule manchmal nicht so recht zusammenpassen wollen, kann der Kinofilm ein hervorragendes Lernmedium für die Schule sein – wenn man es richtig macht.
(merz 2005-03, S.50-55)
Beitrag aus Heft »2005/03: Handys im Jugendalltag«
Autor: Bernward Hoffmann
Beitrag als PDFEinzelansichtAndreas Lange: Emotionen als Wirtschaftsgut
Die allgemeine Aufwertung von Emotionalität in Wirtschaft und Familie, in Corporate Identities, in den Reality-Formaten der TV-Sender, in emotionalisierenden Werbekampagnen hat Folgen: Ein neuer Sozialcharakter wächst heran, das „Kalte Herz“.
Das ist eine Herausforderung für eine reflexive Medienpädagogik – aber auch eine Chance: Auf einen neuen Zugang zur jugendlichen Gefühlskultur.
(merz 2005-03, S.56-59)
Beitrag aus Heft »2005/03: Handys im Jugendalltag«
Autor: Andreas Lange
Beitrag als PDFEinzelansichtGregor Kern: Behinderung, Medien und Schule
„Film plus Gespräch mit Betroffenen“, so lautet das einfache, aber wirkungsvolle Rezept von OBJEKTIV – Behinderung, Medien und Schule. Dieses in Deutschland einmalige Projekt schlägt eine Brücke zwischen Menschen mit Behinderungen und nichtbehinderten SchülerInnen.
Es operiert seit sechs Jahren erfolgreich an bayerischen Schulen und hat allein in den vergangenen beiden Jahren mehr als 11.000 Schüler erreicht.
(merz 2005-03, S.60-65)
medienreport
Tilmann P. Gangloff: Englisch mit Andy, Mathe mit Angela Anaconda
Die Rechnung soll ganz einfach sein. Auf einer CD-ROM mit Lerninhalten sind vier bis acht Spiele; die CD kostet 20, vielleicht sogar 30 M. Wenn es nun aber ein Internet-Angebot ähnlichen Zuschnitts gibt, das mindestens fünfmal so viele Spiele enthält: Würden Eltern dann die Jahresgebühr von 59 bezahlen? Immerhin hätte das spielende Lernen im Netz den Vorteil, dass die CDs weder verschwinden noch verkratzen können. Andererseits ist natürlich nicht nur der Rechner blockiert; wer keinen ISDN-Anschluss besitzt, muss warten, bis die Kinderzeit abgelaufen ist. Trotzdem hielt sich das Risiko für Super RTL in Grenzen, als der Marktführer im deutschen Kinderfernsehen die Grundzüge für den Toggo-CleverClub entwarf; schließlich hat sich beim Vorschulangebot Toggolino Club (www.toggo.de) gezeigt, dass es auf jeden Fall eine Nachfrage gibt. Und weil aus kleinen Kindern irgendwann große werden, war ein entsprechender Service für Grundschulkinder nur eine Frage der Zeit. Seit Ostern können sie sich also im Toggo-CleverClub (www.toggo-cleverclub.de) tummeln und dort mit ihren Lieblingsfiguren aus Super-RTL-Serien wie Typisch Andy oder Angela Anaconda pädagogisch wertvoll die Zeit vertreiben. Eine kurze Stippvisite wird skeptische Eltern überzeugen, dass sie ihren Nachwuchs unbesorgt in diesem Kinderparadies abgeben können: Die Kleinen vertiefen ihre Kenntnisse in Rechnen, Schreiben und Englisch; quasi nebenbei werden auch noch die Fertigkeiten im Umgang mit der Maus geschult. Das Konzept ist simpel und baut darauf, dass Kinder ja gar nichts dagegen haben, dazuzulernen; es darf nur nicht in Arbeit ausarten, sondern soll in erster Linie Spaß machen. Und das tut es, denn in sämtlichen Vergnügungen dominiert das spielerische Element. Man muss zwar hellwach sein und auch mal kopfrechnen, doch jeder Treffer wird belohnt. Natürlich hat man irgendwann alle dreißig Spiele durch, doch die persönliche Hit-Liste ist Ansporn genug, beim nächsten Mal noch schneller zu sein. Und dann gibt’s ja noch die „Highscore“-Übersicht mit den Namen der anderen Teilnehmer, die man vielleicht ebenfalls übertreffen will.Ganz abgesehen von diesem Wettbewerbsfaktor haben Kinder im Grundschulalter ohnehin kein Problem damit, Spiele regelmäßig zu wiederholen; Hauptsache, der Spaßfaktor ist groß genug. Für den sorgt im Toggo-CleverClub nicht zuletzt die Tonspur, die richtige und falsche Entscheidungen prompt lautstark kommentiert.
Spaß plus DidaktikSieben Spielewelten gibt es insgesamt. Die Themen sind ausnahmslos schulrelevant. In der Gebrauchsanweisung für die Eltern werden die Lernziele erklärt. In der Welt des ewig zu Streichen aufgelegten Andy zum Beispiel geht es darum, die Konzentration zu fördern. Die Spiele selbst werden den Eltern allerdings zunächst womöglich suspekt erscheinen, zumal sich der tiefere Sinn und Zweck nicht immer auf Anhieb erschließt. Mitunter hält sich der Effekt tatsächlich im Rahmen. Beim „Wasserbomben-Alarm“ muss man ähnlich wie beim Steckspiel „Mastermind“ durch Tüfteln erraten, welcher von Andys Freunden hinter welcher Klotür sitzt. Hat man das schließlich richtig rausgefunden, platschen ihnen Wasserbomben auf den Kopf. Das „Pudding-Rennen“ erinnert unübersehbar an das fragwürdige Fernsehvergnügen aus der Hugo-Show, bei dem Anrufer ein Fantasie-Vieh per Telefontasten an Hindernissen vorbeisteuern mussten. „Pudding-Rennen“ funktioniert ganz ähnlich: Andy hat zwei Eimer mit Matsch vollgeschaufelt und radelt nun damit nach Hause. Auf dem Weg liegt lauter Müll rum, an dem man ihn mit Hilfe der Cursor-Tasten vorbeidirigieren muss. Holpert das Rad über ein Hindernis, verliert Andy jedes Mal etwas Matsch. Bonus-Punkte gibt es, wenn man zwischendurch Fragen richtig beantwortet; und wenn man die vereinzelt auf dem Weg liegenden Äpfel „aufsammelt“, geht die Fahrt gleich zügiger voran. Doch Andys Welt ist bloß der Einstieg, ganz abgesehen davon, dass gerade kleineren Kindern die Herausforderung ungleich mehr Spaß macht als dem tastaturgeschulten Erwachsenen. Bei „Angela Anaconda“ geht’s schon deutlich didaktischer zu. Hier muss man zum Beispiel in einem Text fehlende Buchstaben ergänzen, was sich für manche Kinder als verflixt schwer entpuppen könnte, denn man muss jeweils zwischen „k“ und „ck“ oder „ss“ und „ß“ entscheiden; ein echter „Hausaufgabenhorror“, wie die Aufgabe daher auch treffend heißt. In einem zweiten Spiel ist Kopfrechnen gefordert: Angela stellt eine Aufgabe, anschließend hasten die Figuren aus der Legetrick-Serie durch den Schulflur.
Auf jeder von ihnen steht ein mögliches Ergebnis, das richtige muss angeklickt werden. Hier werden also gleich zwei Dinge geübt: das Rechnen sowie das Manövrieren mit der Maus. Mit „Sherm!“ schließlich lernen die Kinder englisch. Weil Sherm mal wieder pleite ist, hilft er in einer Burger-Bude aus. Wer ihm beistehen will, muss die Brötchen belegen. Sherm nennt die englischen Bezeichnungen für die Zutaten („Take the onion, take the fish“), die Kinder müssen sie blitzschnell mit der Maus auf die Brötchenhälfte ziehen, die derweil durchs Bild fliegt. Haben sie sich vertan, landet der Hamburger mit lautem Getöse in der Mülltonne; liegen sie richtig, kommt ein großmäuliges Geschöpf und vertilgt das Brötchen mit wonnigem Schmatzen. Wer dreimal falsch belegt, hat verloren. Auch bei „Cool Numbers“ steht die Maus im Mittelpunkt: Die „irren Mikroben“ aus der Serie werfen mit giftigen Kugeln um sich. Doch nicht alle Kugeln, die auf den Spieler zufliegen, sind gefährlich. Sherm sagt die Zahlen auf englisch, der Spieler muss die entsprechenden Geschosse per Mausklick abschießen – ein schlichtes Ballerspiel, in dessen Verlauf einem die englischen Zahlen in Fleisch und Blut übergehen. Ganz schön knifflig wird’s für Grundschüler dann im zweiten Level, wenn die Zahlen zweistellig werden. Viel Physik ist angesagt, wenn die Moderatoren Nina Moghaddam und Marcus Werner durch „WOW – die Entdeckerzone“ führen. Der Versuch im „Spiegelspiel“ ist nur die Einführung: Hier müssen Spiegel so eingestellt werden, dass mit Hilfe des einfallenden Sonnenlichts Maiskörner erhitzt werden können.
Interessanter sind die Optionen: Klickt man auf die Glühbirne, wird der Versuch erklärt („Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel“); klickt man auf den Werkzeugkasten, erscheint eine Bastelanleitung für ein Periskop. Diese Optionen gibt’s bei jedem „WOW“-Spiel. Sehen einige Aufgaben auch eher nach Vorschule aus (sechs Teile zu einem Puzzle zusammenlegen), so haben sie es doch alle in sich. Das Puzzle zum Beispiel ist das Vorspiel für eine Lektion in optischer Täuschung, denn im gleichnamigen Kapitel werden Stereogramme, Kippbilder und andere Spielereien mit Perspektive vorgestellt und erläutert. Chancen am MarktGemessen an dem Spaß, den Kinder mit dem Toggo-CleverClub haben können, erscheint die Jahresgebühr von 59 Euro tatsächlich nicht zu hoch. Bei einer Spieldauer von ein bis zwei Stunden pro Tag braucht man allein mindestens eine Woche, bis man sämtliche Spiele gespielt, Optionen angeklickt und Informationen gelesen hat; und dann geht der Spaß wieder von vorne los. Wer erstmal nur reinschnuppern will: Ein vierwöchiges Test-Abo kostet bloß einen Euro. Die Zuversicht von Matthias Büchs, bei Super RTL „Director Operations“, der CleverClub werde seine Mitglieder schon finden, ist nicht unbegründet. Als der Sender im Herbst 2002 die Tore zum Toggolino-Club öffnete, prognostizierten Experten dem Sender allenfalls einige wenige tausend Abonnenten; mittlerweile sind es 60.000. Mit dem zweiten Club geht Super RTL trotzdem erneut ein Wagnis ein; schließlich ist es durchaus ein Kunststück, Kinder zu freiwilligem Multiplizieren zu bringen.
Gerade darin aber dürfte aus Elternsicht der entscheidende Mehrwert gegenüber „Toggolino“ bestehen, denn dort geht es doch weitgehend um Unterhaltung. Sieht man mal vom didaktischen Anteil ab, überzeugt der CleverClub vor allem durch seine Liebe zum Detail. So sind zum Beispiel die Sprecher der Figuren die selben wie in den Serien. Sämtliche Spiele wurden unter der Beratung von Fachleuten exklusiv für diese Plattform entwickelt. Und das derzeitige Angebot ist ja nur die Ausgangssituation. Der Toggolino Club hat nach Aussage von Büchs bereits „um die hundert Applikationen“; auch beim CleverClub sollen jeden Monat neue Spiele hinzukommen. So werden die Abonnenten zum Beispiel schon bald online Schach spielen können. Für 2006 wird mit „Adventurers“ eine neue Welt eingeführt, in der sich alles um Geschichte dreht. Ein Wermutstropfen bleibt dabei allerdings: Selbst auf einem guten Rechner dauert es mehrere Minuten, bis die Spiele hochgeladen sind.Der Toggolino Club wurde für seine „herausragende didaktische Konzeption und ihre kreative Umsetzung“ im vergangenen Jahr mit dem „edut@ain-award“ ausgezeichnet, einem Preis, der unter der Schirmherrschaft der Bundesbildungsministerin steht. Außerdem wurde er mit dem Gütesiegel „Erfurter Netcode“ versehen; es wird ausschließlich an Internet-Anbieter vergeben, die sich einem hohen Qualitätsstandard verpflichten. Die erste Auszeichnung für den Toggo-CleverClub dürfte nicht lange auf sich warten lassen.
Tilmann P. Gangloff
Beitrag aus Heft »2005/03: Handys im Jugendalltag«
Autor: Tilmann P. Gangloff
Beitrag als PDFEinzelansichtChristina Oberst-Hundt: Alte sind anders
Am Anfang stand, wie bei Veranstaltungen über ‚Ältere Menschen’ heute üblich, die demographische Entwicklung. Prof. Schmid von der Universität Bamberg verzichtete auf die Attitüde des Bedrohlichen, die das Thema in der Regel herauf beschwört, und würdigte ein langes Leben durchaus als soziale Errungenschaft. Innovationen im Gesundheitswesen und gesellschaftliche Entwicklungen, vor allem das Streben der weiblichen Bevölkerung nach gleichberechtigter Teilhabe an Bildung und Erwerbsarbeit, seien wesentliche Ursachen. Mehrheitlich geht es um Frauen, wenn das Thema ‚Alter’ verhandelt wird. Sie haben heute eine Lebenserwartung von 81 Jahren, während das männliche – laut Schmid – „schwächere Geschlecht“ mit 76 Jahren durchschnittlich rechnen kann. „Die vergreiste Republik“ wird laut Süddeutscher Zeitung „2011, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestrand drängen“ konkreter werden und 2040, wenn ein Drittel der Gesellschaft über 60 Jahre alt ist, „vollendet sein“
1.Mediennutzung 50 plus: anders, länger, vielfältig
Medien werden diese Entwicklung berücksichtigen und den unterschiedlichen Bedürfnissen alter Menschen entsprechen müssen. Wie Maria Gerhards von der SWR-Medienforschung betonte, nutzen die älter werdenden Generationen das vorhandene Medienangebot anders als jüngere und auf jeden Fall länger. Allerdings ist ihr Mediennutzungsverhalten keineswegs homogen und verändert sich mit zunehmendem Alter. Viele jüngere Alte zwischen 50 und 59 Jahren haben mehr mit 40-Jährigen als mit den älteren Jahrgängen gemein. Sie wollen vor insbesondere durch das Fernsehen Information, Entspannung, Unterhaltung, Denkanstöße bekommen und mitreden können. Erst in höherem Alter verändert sich der Fernsehkonsum deutlich. Über-70-Jährige sehen täglich im Durchschnitt mehr als viereinhalb Stunden fern, etwa eine Stunde länger als jüngere Alte. Während im vergangenen Jahr die meistgesehene Sendung der Ab-50-Jährigen Wetten, dass… war, favorisierten die Ab-70-Jährigen Mainz bleibt Mainz und den Musikantenstadl. Allerdings modifizieren sich diese Vorlieben deutlich, je höher der Bildungsstand ist. Mit steigendem Alter wächst zudem das Bedürfnis nach mehr Information, während die Fiktion-Angebote immer weniger interessieren.
Im Medienvergleich ist mit zunehmendem Alter die Hörfunknutzung gegenüber dem Fernsehen rückläufig. Aber die Tageszeitung wird täglich etwa eine halbe Stunde gelesen, während in Zeitschriften lediglich zehn Minuten geblättert wird. Das Interesse an Büchern schlägt sich in einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von täglich 70 Minuten nieder und Tonträger sind 36 Minuten eingeschaltet. Das Internet nutzen erst relativ wenige, nämlich unter 20 Prozent der Älteren, aber auch sie akzeptieren es zunehmend als eigenständiges Medium. Vor allem home-banking erfreut sich bei den Ab-50-Jährigen steigender Beliebtheit2. Bei den Fernsehsendern präferieren Ab-50-Jährige eindeutig die öffentlich-rechtlichen Angebote gegenüber privat-kommerziellen.Ausgegrenzt oder gesund und fit?
Wie reagieren die Sender auf das größer werdende ältere Publikum? Richten sie sich nach deren Vorlieben, Bedürfnissen, reflektieren sie deren gesellschaftliche Situation, deren Probleme? Helmut Lukesch bezweifelt dies. In seiner Untersuchung über das Weltbild des Fernsehens, auf die der Medienkritiker Tilmann P. Gangloff in Tutzing einging, resümiert er, dass Menschen über 65 im Fernsehen deutlich unterrepräsentiert, ausgegrenzt seien und die negativen Seiten des Alters kaum gezeigt würden. Das Fernsehen vermittle insgesamt ein überwiegend positives Bild des Alt-Seins. Diesem Befund, von Lukesch kritisch beurteilt, hat Gangloff „die eigene gefühlte Statistik“ entgegengesetzt, die in mancher Hinsicht realitätsnäher wirkte als des Wissenschaftlers Analyse. So habe z.B. der inzwischen 75-jährige „Prof. Brinkmann“ in einem Schwarzwaldklinik-Special seinen 12,5 Millionen keineswegs nur älteren Zuschauern so positive Werte wie „Routine, Gelassenheit und Erfahrung“ vermittelt. Tatorte und andere Krimis, in denen alte Frauen um ihr Erspartes gebracht werden, eine von ihnen über Monate unentdeckt tot im Sessel sitzt, kriminelle Machenschaften in Altenheimen aufgedeckt werden, zeigten nicht gerade Beispiele problemlosen Alterns, ebenso wenig wie Fernsehfilme über schwierige Mutter-Tochter-Beziehungen, boshafte Schwiegermütter und Omas oder das erschütternde Porträt eines Alzheimer-Kranken.
3 Anzumerken wäre noch, dass Lukeschs Befund, „der Großteil der Senioren im Fernsehen“ werde „als körperlich gesund und geistig fit dargestellt“, dem ‚richtigen Leben’ durchaus entspricht. Die heutigen Alten sind nämlich viel weniger durch Krankheit, Gebrechlichkeit und Siechtum beeinträchtigt als alle Vorgängergenerationen.Apropos Kommissarinnen und Co.
Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum in Tutzing die vielen fit aussehenden älteren Frauen aus der TV-Fiktion nur nebenbei erwähnt wurden. Gerade Figuren wie „Bella Block“ oder „Die Kommissarin“ waren es aber, die ab Mitte der 90er Jahre einen geradezu revolutionären Wandel im Fernsehen eingeleitet haben, indem sie dem bis dahin herrschenden Frauenleitbild: Jung, schön, mit Liebesdingen zwecks späterer Heirat befasst und dem Manne untertan4, die selbstbewusste, sich über ihren Beruf definierende, ältere Frau entgegenstellten. Zahlreiche Frauen, nicht nur Kommissarinnen, sondern auch Juristinnen wie Christiane Hörbigers ungewöhnliche „Julia“, „Tippsen“ wie Evelyn Hamanns „Adelheid“ oder Ruth Drexels resolute Mutter des „Bullen von Tölz“ belegen deren Publikumsakzeptanz mit höchsten Einschaltquoten. Und machen diese TV-Frauen nicht auch medial sichtbar, was der Bevölkerungsexperte eingangs ausgeführt hatte, dass nämlich Frauen ihren Anteil am gesellschaftlichen Leben einfordern auf Kosten von Kind und Küche?
Ab 50: nicht werberelevant?
Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Tagungszeit in Tutzing widmete sich der Frage, “warum die Zielgruppe 14 bis 49 wirklich wichtig ist“, bzw. warum auch ältere Zielgruppen werblich nicht uninteressant sind. Von „Kontaktherstellung zwischen Produkthersteller und Konsument“, „Markenerinnerung“, „Aussteuerung des Mediaplans“ und „Umsatzgenerierung der Zielgruppen“ war da die Rede. Während die kommerziellen Sender darauf bestehen, dass sie mit den 14- bis 49-Jährigen auch die Älteren erreichen, wollen die Öffentlich-Rechtlichen „die verschmähte Generation“ der Alten gezielt ansprechen, weil diese immer mehr werden, Alterstypen sich immer weiter ausdifferenzieren, viele Alte „wirklich reich sind“, häufiger als Junge einkaufen und ihre Markentreue sich in Grenzen hält, wenn neue Produkte ihren Vorstellungen entsprechen.
Zwischen Konkurrenz und Quote?
In der Abschlussdiskussion keimte ein bisschen aktuelle Rundfunkpolitik auf. Die Gebührendiskussion habe ein Konkurrenzgefühl auch zwischen ARD und ZDF aufgebaut, einen Keil zwischen beide Systeme getrieben, in der Hoffnung, „dass vielleicht eines schlapp macht“, meinte Bettina Reitz vom Bayerischen Fernsehen. Und Regisseur Uli Stein befällt ein „steigendes Gefühl der Mutlosigkeit angesichts des Quoten- und Zielgruppendenkens“. Auch bei den Tatort-Filmen spüre er „Tendenzen, weniger politisch zu sein“. Susanne Kaiser vom ZDF beklagte die Politikverdrossenheit gegenüber Sendungen wie Berlin Mitte und Max Schautzer sieht bei Christiansen nur noch Leute, die dort wegen ihrer Funktion auftreten, nicht weil sie etwas zu sagen hätten. Was hat das mit den Alten zu tun? Sehr viel, denn sie sind es, die mehr vom Fernsehen erwarten, nicht nur weil sie länger sehen und immer mehr werden, sondern weil sie angesprochen sein wollen, nicht als Quotenbringer und Zielgruppen für Kaufprodukte, sondern über Inhalte, die ihren unterschiedlichen und vielfältigen Bedürfnissen entsprechen.5
Anmerkungen
1Süddeutsche Zeitung vom 10.1.2005
2 Wie alte Menschen mit online-Medien umgehen, war Titelthema in merz Nr.4, August 2004
3 Tillmann P. Gangloffs Tutzinger Referat in erweiterter Form in epd medien Nr.18 v. 9.3.2005, S.5ff.
4 Vergl. Monika Weiderer (1993). Das Frauen- und Männerbild im Deutschen Fernsehen, S. Roderer Verlag, Regensburg
5 Vergl. Anne Rose Katz (1996). Wie man aus einem Grauen Panther ein Goldenes Kalb macht… in merz Nr.5, Oktober 1996. Titelthema: Die 50plus-Generation: Ohne Präsenz in den Medien?
Beitrag aus Heft »2005/03: Handys im Jugendalltag«
Autor: Christina Oberst-Hundt
Beitrag als PDFEinzelansichtMichael Bloech: Realität als pädagogische Herausforderung
Auf einer ärmlichen holländischen Schweinefarm in der Nähe von Utrecht verfolgt eine Kleinbauernfamilie gebannt am neuen Schwarzweiß-Fernsehgerät das aktuelle Geschehen: die erste bemannte Mondmission von Apollo 11. Die neunjährige Tochter Karo ist von diesem Vorhaben einerseits fasziniert, aber andererseits glaubt das streng katholisch erzogene und gottesfürchtige Mädchen, dass Gott eine Mondlandung nicht erlauben würde. Auch ihr Vater Mees ist von alldem und überhaupt von der gesamten neuen Technik wenig begeistert. Der alkoholkranke Mann hält das Fernsehen für Betrug und hat den Bezug zur Realität vollkommen verloren. Zwar versucht Mees verzweifelt, seine starke Alkoholabhängigkeit zu besiegen, aber immer wieder verliert er den Kampf gegen seine Dämonen. Die ganze Familie leidet unter seinen zahllosen, alkoholbedingten Abstürzen. Nur die Liebe zu ihren fünf Kindern hält Karos hochschwangere Mutter in dieser bedrückenden Situation vor einer Flucht zu ihrer in der Großstadt lebenden Schwester zurück.Alles scheint sich dennoch, dank Karos Entschlossenheit, zu einem glücklichen Ende zu fügen: Die wasserscheue Karo verspricht ihrem Vater, Schwimmen zu lernen, wenn Mees im Gegenzug mit dem Trinken aufhört. Doch ein dummer Zwischenfall während Karos Kommunionsfeier und der plötzliche Tod der Schweineherde stürzen den Vater in tiefste Depression, die im Alkoholrausch bis zur Besinnungslosigkeit endet, was wiederum bei Karo grenzenlose Wut und Verachtung hervorruft. Erst als durch die finanzielle Hilfe der reichen Tante eine neue Schweineherde gekauft werden kann, kommt der Vater zur Besinnung und will „noch einmal ganz von vorne anfangen“.
Doch das familiäre Glück währt nicht lange...„Weiter als der Mond“ ist damit zunächst vor allem ein wirklich bedrückendes, emotionales Drama. Regisseur Stijn Coninx hat einen traurig stimmenden Film realisiert, der in Punkto Wahrhaftigkeit in der Tradition der Dogmafilme steht. Allerdings dürfte gerade dies wohl Kontroversen auslösen: Kann das im Film Gezeigte Kindern überhaupt zugemutet werden, ist das alles nicht zu belastend? Doch das Schicksal, das die neunjährige Karo mit ihrer Familie durchleiden muss, mag vielleicht in der verkürzten Darstellung klischeehaft, konstruiert oder melodramatisch anmuten, dennoch ist das Gezeigte durchaus realitätsnah. Und dies erzeugt umso mehr eine nachdenklich stimmende Wirkung, als die geschilderten Problemlagen, die im Film in die 70er Jahre verlagert wurden, ohne weiteres auf die heutige Zeit übertragbar sind. Alkoholabhängigkeit, technischer Wandel, Armut und Intoleranz als negative Rahmenbedingungen familiärer Strukturen sind aktueller denn je. Das Wechselspiel widriger Bedingungen erzeugt gestern wie heute in Familien Hilflosigkeit und genau das ist der pädagogisch schwierige Kern an dieser Geschichte. Huub Stapel, der in der Rolle von Karos Vater alle Register schauspielerischer Professionalität zieht, macht nahezu körperlich spürbar, dass Alkoholabhängigkeit eine gefährliche Krankheit ist, die eine ganze Familie ins Chaos stürzen kann. Das als Craving in der Medizin bekannte Phänomen des ständigen körperlichen Verlangens nach Alkohol, das alle anderen Gedanken vollständig überlagert, wird überaus deutlich und wirklichkeitsnah filmisch in Szene gesetzt. Für Kinder ist dies beim Zuschauen natürlich eine extreme psychische Belastung. Zusammen mit der emphatischen Kamera, die stets distanzlos mitten im Geschehen ist, wird eine psychisch entlastende Distanzierung beim Zuschauen beinahe unmöglich.
Schon in der Anfangssequenz wird mit der Geburt eines Ferkels auf dieses Stilmittel eingestimmt. Nahezu dokumentarisch wird dieser Augenblick, in dem Karos Mutter mit ihren Händen den mühevollen Geburtsweg des Ferkels unterstützt, in drastischer Deutlichkeit eingefangen und verweist auf das, was nun folgt: auf die Wirklichkeit. In der Konsequenz bedeutet dies jedoch nicht, dass Kinder im Sinne einer behütenden Bewahrpädagogik vor diesem Film geschützt werden sollten. Vielmehr ist das Gegenteil richtig, ältere Kinder sollten diesen Film natürlich anschauen und diskutieren, allerdings müssen dabei die Rahmenbedingungen stimmen. Was MedienpädagogInnen schon seit langem nachdrücklich fordern, nämlich dass Kinder belastende Filme nicht alleine anschauen sollen, wird hier zur Verpflichtung. Denn nach Filmende dürften sich bei den Kindern nicht nur Fragen, sondern vor allem viele Anlässe für Diskussionen ergeben.
Weiter als der Mond
Niederlande, Belgien, Dänemark, Deutschland, 2003, 99 min
Regie: Stijn Coninx
Darsteller: Huub Stapel, Johanna Ter Steege, Neeltje de Vree u.a.
Verleih: Movienet
Beitrag aus Heft »2005/03: Handys im Jugendalltag«
Autor: Michael Bloech
Beitrag als PDFEinzelansichtTilmann P. Gangloff: Kinder im Kino
Wenn über die Wirkung bewegter Bilder diskutiert wird, geht es meist um das Fernsehen. Kein Wunder: Das Leitmedium unserer Gesellschaft spielt auch bei Kindern mehrere Stunden am Tag eine wichtige Rolle. Doch das Fernsehen ist ein flüchtiges Medium: Man kann umschalten, man kann aus dem Zimmer gehen, man kann es ignorieren. Im Kino ist die Rezeptionssituation eine ganz andere: Die Leinwand ist riesig, der Ton spielt dank ausgeklügelter Sound-Designs eine noch stärkere Rolle als früher und ist zudem aufgrund der modernen Surround-Anlagen in den Kinos körperlich spürbar. Das Filmerlebnis schließlich ist nicht wie im Fernsehen in leicht konsumierbare Häppchen aufgeteilt; es dauert in der Regel mindestens neunzig Minuten. Trotzdem ist die Wirkung von Kinofilmen gerade auf kleine Kinder bislang noch kaum untersucht worden. Um so größer ist die Bedeutung des Projekts Medienkompetenz und Jugendschutz einzuschätzen, zu dem sich gleich drei Kooperationspartner zusammengeschlossen haben.
Einige Aspekte, denen die Studie nachgeht: Wie reagieren Kinder auf filmische Darstellungen? Wie verarbeiten sie Animationsfilme? Was erfassen sie von der Filmhandlung? Mit welchen Figuren identifizieren sie sich? Was löst Ängste aus? Wie gehen sie mit dargestellten Problemen um, etwa der Gefährdung von Freundschaften oder der Bedrohung von Familien? Stellen sie Bezüge zu ihrer eigenen Lebenswelt her? An welchen Filmfiguren orientieren sie sich, mit wem fiebern sie dem Happy End entgegen? Bekannt war schon vorher, dass Drei- bis Sechsjährige komplexe Handlungen stets in einzelne überschaubare Episoden zerlegen; übertragen auf die Filmsyntax würde dies einer Szene entsprechen, die ja durch die Einheit von Zeit und Raum gekennzeichnet ist. Ein Erzählrahmen, der sich über neunzig Minuten erstreckt, ist für kleine Kinder also viel zu lang, weshalb man ihnen mit einem Kinobesuch in der Regel ohnehin keinen Gefallen tut. Klar ist andererseits auch, dass gerade bei Kindern zwischen drei und sechs Jahren (früher lassen sich kaum seriöse Ergebnisse erzielen) die individuelle Medienbiografie zu enormen Unterschieden im Verhalten führen kann: Manche gehen mit ihren Eltern bereits im Kindergartenalter regelmäßig ins Kino, andere bis zur Grundschule nie.
Für alle aber gilt, wie es in der Broschüre heißt: Kinder in diesem Alter nehmen einen Film „grundsätzlich erlebnisorientiert und emotional wahr“.Filmkompetenz im VorschulalterDie Studie der Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest ergänzt das eher rudimentäre Wissen um differenzierte Erkenntnisse und weist auf eine bedeutsame Entwicklung der letzten Jahre hin: Selbst Vorschulkinder haben dank ihrer Mediensozialisation durch das Fernsehen keine nennenswerte Probleme, Realfilme von Zeichentrickproduktionen zu unterscheiden. Gerade hinsichtlich der Wirkung ist das nicht unwichtig. Sie wissen, dass Animationsfilme nicht die Wirklichkeit sind, weshalb Cartoon-Figuren selbst das größte Ungemach letztlich unbeschadet überstehen können. Schwierigkeiten bereiten den Kindern aber Computerfilme wie die von Pixar produzierten Kassenknüller Toy Story, Findet Nemo oder zuletzt Die Unglaublichen. Und auch für Shrek gilt: Die Grenzen zwischen Realfilm und Computeranimation verschwimmen. Allerdings setzen gerade die Filme von Pixar auf klassische Cartoon-Elemente; Slapstick und Humor dominieren. Bei den Figuren handelt es sich um Spielsachen (Toy Story), Insekten (Das große Krabbeln), Meeresbewohner (Findet Nemo) oder Monster aus einer Parallelwelt (Monster AG). Sind es aber doch Menschen wie die Superhelden aus Die Unglaublichen, werden sie karikiert und bleiben deshalb Kunstfiguren. Ganz anders in Robert Zemeckis’ Polar Express: Mit Hilfe der „Motion Capture“-Technik wurde der Schaffner des Zuges dem Schauspieler Tom Hanks mehr als nur nachempfunden; kleinen Kindern müssen die Erlebnisse der achtjährigen Hauptfigur (ebenfalls Hanks, im Rechner verjüngt) wie echt vorkommen.Entscheidender aber für die Wirkung ist die Dramaturgie der Geschichten. War Zeichentrick früher zumindest hierzulande grundsätzlich ein Kindergenre, zielen neuere Filme wie Findet Nemo stets auf die ganze Familie; der Handlungsaufbau ist daher weitaus anspruchsvoller und nicht mehr bloß episodisch, was kleinere Kinder nicht selten überfordert. Bei einer Empfehlung für Kinder muss also darauf geachtet werden, dass gerade die dramatischen Szenen keine anhaltenden Ängste aufbauen.
Eminent wichtig: Die Kinder dürfen nicht in ihrer festen Erwartung enttäuscht werden, dass schließlich alles gut wird und den Helden nichts geschieht. Nur dann können sie in den filmischen Abenteuern die „Angstlust“ unbeschwert genießen: „Am Ende sind ja eh alle wieder happy“, zitiert die Studie einen der jungen Teilnehmer. Die Äußerungen der Kinder zeigen aber auch, wie tief ihre emotionale Bindung zu den Hauptfiguren ist: Sie redeten teilweise über die Filmhelden, „als wären es gute Freunde“. Die Identifikation ist naheliegenderweise um so stärker, je größer der Bezug zur eigenen Lebenswelt ist, zumal Freundschaft und Familie für Filmkinder (ob nun menschlich oder tierisch) fast immer Motor der Geschichten sind; der gern exotische Handlungsort ist dabei völlig zweitrangig. Kinder im KinoInitiiert wurde die Studie Medienkompetenz und Jugendschutz von der Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest (MKFS). Ihr gehören die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK), das rheinland-pfälzische Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend sowie die Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter Rheinland-Pfalz (LPR) an. Die Ergebnisse wurden in einer sechzigseitigen Broschüre zusammengefasst. Sie kann kostenlos bei Inge Kempenich bestellt werden. Die Ergebnisse der Befragungen sind auch im Internet verfügbar. Eine nützliche Ergänzung ist das Faltblatt „Kinder im Kino“, herausgegeben von der Aktion Jugendschutz Bayern. Es fasst zusammen, wie Kinder in ihren unterschiedlichen Entwicklungsstufen mit filmischen Erlebnissen umgehen, informiert über die Kriterien der Altersfreigaben, gibt Tipps, wie Eltern ihren Kindern in Momenten der Angst helfen können, und bietet außerdem eine Liste mit
Internet-Adressen, unter denen man sich über neue Filme informieren kann.
kempenich@spio-fsk.de
Beitrag aus Heft »2005/03: Handys im Jugendalltag«
Autor: Tilmann P. Gangloff
Beitrag als PDFEinzelansichtThomas Jacob: Sechs Minuten für ein Spiel
Ballack dribbelt geschickt an seinem Gegenspieler vorbei, flankt genau auf Makaay, der nur wenige Meter vor dem Tor steht. Der Holländer zieht volley ab – Tor! Was wie die Liveübertragung eines Bundesliga-Spieles klingt, ist eine typische Szene aus dem neuen PC-Spiel FIFA 2005.FIFA 2005 ist die jüngste Ausgabe der äußerst erfolgreichen Fußballspielreihe von Electronic Arts. Das erste FIFA-Spiel erschien bereits 1994. Seitdem kommt Jahr für Jahr eine neue Version heraus, nicht nur für den PC, sondern auch für Spielekonsolen. Zu den Fußball-Großereignissen wie WM und EM kommen noch spezielle Ausgaben auf den Markt, so dass mittlerweile rund 15 Spiele der FIFA-Serie erschienen sind. GrafikprachtDie aktuelle Ausgabe unterscheidet sich dabei nur in Details von ihren unmittelbaren Vorgängern. Die Grafik wurde weiter verbessert und ist mittlerweile so realitätsgetreu, dass man bekannte Spieler problemlos an ihren Gesichtern erkennt. Auch die Bewegungen der Spieler sind geschmeidig und sehen verblüffend echt aus. Schon seit Jahren setzt die FIFA-Serie dabei auf eine Technik namens „Motion Capturing“. Dabei wird ein echter Fußballer mit Sensoren am ganzen Körper versehen, die seine Bewegungsdaten an einen Computer senden. Diese Daten übertragen die Programmierer dann auf die virtuellen 3D-Spieler, die sich somit genauso bewegen wie ihr lebendes Modell. So richtig genießen kann ein FIFA-Spieler die Details der Grafik aber nur in den Wiederholungen, die mit Nahaufnahmen und verschiedenen Kamerawinkeln protzen. Während eines Matches wird das Spielfeld in der Regel von relativ weit oben gezeigt. Zwar ist auch eine Vielzahl anderer Perspektiven wählbar, aber nur aus der Vogelperspektive behält man die nötige Übersicht.
Wählbar ist im Übrigen auch die Spiellänge, von einem kurzen Match über sechs Minuten bis hin zu den vollen 90 Minuten ist alles möglich.Steuertricks Zur Steuerung des Spiels kann entweder das Keyboard oder ein Gamepad verwendet werden. Mit den Jahren ist die Steuerung der FIFA-Serie immer komplexer geworden. Genügten beim allerersten Spiel noch zwei Aktionstasten – Passen und Schießen – so sind mittlerweile rund acht Knöpfe belegt. Damit können geübte Spieler wahre Kunststücke vollführen, vom Übersteiger über Fallrückzieher bis zur brutalen Blutgrätsche. Im Gegenzug ist ein ganzes Stück mehr Einarbeitungszeit nötig, bis man alle Nuancen der Steuerung beherrscht. Der Spieler übernimmt immer den Fußballer, der gerade dem Ball am nächsten ist. Den Rest der Mannschaft steuert der Computer. Die künstliche Intelligenz lässt die Mitspieler meist intelligent in Position laufen - immer abhängig von der Taktik, die vor dem Spiel eingestellt wurde.Kommentiert wird das Geschehen „live“ von den Fernsehmoderatoren Florian König und Rolf Bartels. Das ist am Anfang sehr amüsant und fördert die Atmosphäre – allerdings passen die Sprüche nicht immer zum Spiel und wiederholen sich recht schnell. Der Kommentator lässt sich aber zum Glück auch abschalten. TaktikFast selbstverständlich ist mittlerweile, dass neben den Nationalmannschaften auch die großen europäischen Fußballligen wie Italien, Spanien, England und Deutschland mit allen Vereinen und den Originalspielern vertreten sind. Dabei unterscheiden sich die Spieler in ihren Fähigkeiten wie Schnelligkeit und Schusskraft. Ein Ronaldo trifft auch in FIFA 2005 besser als ein Zweitligastürmer, und Olli Kahn hält fast jeden Ball. Mit einer starken Mannschaft ist es darum leichter, zu gewinnen.Im so genannten Karrieremodus übernimmt der Spieler zusätzlich noch die Rolle des Trainers.
Durch geschicktes Training und Spielertransfers gilt es nun, eine schlagkräftige Mannschaft zu formen und über fünfzehn Jahre möglichst viele Titel einzufahren. Wem die taktischen Möglichkeiten nicht reichen, der kann FIFA 2005 sogar mit dem PC-Spiel Fußballmanager 2005, ebenfalls von Electronic Arts, kombinieren. In einem Managerspiel übernimmt der Spieler die Rolle des Clubmanagers. Er kauft und verkauft Spieler, kümmert sich um Werbeverträge und Stadionausbau und legt Trainingsplan sowie Aufstellung und Taktik fest. Die Partien selbst werden dann vom Computer berechnet. Wer aber sowohl FIFA 2005 als auch den Fußballmanager 2005 installiert hat, kann die gemanagte Mannschaft dann im Match selbst steuern.Multiplayer Was für fast alle Computerspiele gilt, trifft auch auf FIFA 2005 zu: Am meisten Spaß macht eine Partie gegen einen menschlichen Gegenspieler, ob zu zweit an einem PC oder über das Netz. Im Internet gibt es richtige FIFA-Ligen mit Punktspielen, Tabellen und Meisterschaften. Auf anderen Fanseiten kann man sich Erweiterungen wie authentische Fangesänge, aktualisierte Trikots oder sogar einen Sportschau-Patch herunterladen, mit dem die Menüs des Spiels im Sportschau-Design erstrahlen. So kann sich jeder Spieler sein ganz persönliches FIFA 2005 zusammenbasteln, bis er sich – so zumindest die Rechnung von Electronic Arts – im nächsten Jahr FIFA 2006 kauft.
Susanne Friedemann: Rettet die Erde!
Mission BluePlanet. Das Klima-Quiz, Windows 2000 / XP, co2online 2005, www.mission-blue-planet.de, kostenlosDas Bundesumweltministerium bietet im Rahmen seiner Klimaschutz-Kampagne „Klima sucht Schutz“ ein kostenloses CD-ROM-Quiz für Schüler zu Themen rund um den blauen Planeten an. Darin werden in optisch ansprechender Oberfläche über 500 Fragen zu verschiedensten Aspekten der Umwelt aus den Fachbereichen Sachkunde, Erdkunde, Chemie, Biologie und Physik gestellt. Die Spieler können sich einzeln anmelden und zwischen den sieben Wissensgebieten Blauer Planet, Wind & Wetter, Über den Wolken, Unter Strom, Auf Achse, Risiko und Energiefuchs sowie drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden wählen. Dabei sind deutliche Unterschiede im Fragespektrum und dem nötigen Hintergrundwissen erkennbar, so dass inhaltlich nahezu alle Klassenstufen (ca. 2. bis 10. Klasse) mit dem Quiz angesprochen werden. Im einfachsten Modus für die jüngsten Nutzer werden Fragen und Erläuterungen optional auch vorgelesen.Das Quiz selbst bietet weitaus mehr als bloße Fragen mit Antworten.
Die Aufgabentypen reichen vom lockeren Bilderraten über Auswahlfragen bis hin zum Wortpuzzle, zu vielen Fragen gibt es eine Einführung ins jeweilige Thema sowie nach Beantwortung der Frage zusätzliche Erläuterungen in Form von Infotext, Bild und Video. Damit werden den Schülern grundlegende Begriffe, Zusammenhänge zwischen Klima, menschlichem Handeln und Folgen für die Umwelt wie auch einige Energiespartipps vermittelt. Zur Erheiterung beim Spielen tragen kleine animierte Figuren bei, die sich über richtige Antworten freuen und auch schon mal dem bösen CO2 eins auswischen.Besonderer Bonus: Die kostenlos erhältliche Quizmaster-Version zur CD-ROM Mission BluePlanet bietet die Möglichkeit, selbst ein Quiz mit eigenen Fragen und Antworten – ganz ohne Programmierkenntnisse – zu erstellen. Somit können Lehrer mit etwas Engagement auf den Unterricht zugeschnittene Denkspiele gestalten oder es sinnvollerweise sogar ihren Schülern zur Aufgabe machen, neue Fragen und die zugehörigen multimedialen Antworten für den Unterricht zu entwerfen. Als zusätzliches Lehrmittel können auch Fragebögen mit den Quizfragen gedruckt werden.
Weiterhin werden nach Angabe des Herstellers im Internet unter www.mission-blue-planet.de regelmäßig neue Fragen für das Quiz zum Download angeboten. Dort kann man auch die persönlichen Spieldaten zu einem Wettbewerb versenden und sich mit anderen Umwelt-Interessierten messen.So bildet die vielseitige Mission BluePlanet eine geeignete Informationsquelle für den ergänzenden Einsatz in der Schule und sogar über den Unterricht hinaus.
Beitrag aus Heft »2005/03: Handys im Jugendalltag«
Autor: Susanne Friedemann
Beitrag als PDFEinzelansichtDaniel Ammann: Chaos in der Sams-Welt
Das Sams: Abenteuer mit der Wunschmaschine. Win 98 / ME / XP; Mac ab OS 8.2 / OS X. Oetinger, 2004. 29,90 € Ein halbes Dutzend Sams-Bücher, dazu diverse Tonträger, Theater- und Musicalfassungen, zwei Kinofilme sowie eine beschauliche erste CD-ROM mit einfachen Spielaufgaben haben Paul Maars rüsselnasiges, rotschopfiges und rund um die Uhr reimendes Wesen seit 1973 bereits zum Medienstar gemacht. Höchste Zeit also für ein neues interaktives Sams-Abenteuer. Hierzu haben sich die Macher einiges einfallen lassen. Eine spaßige Geschichte sowie 19 ausgefallene und mit der Handlung eng verknüpfte Denk- und Geschicklichkeitsspiele sorgen für turbulente Unterhaltung.
Für Unordnung und Verstörung sorgt diesmal nicht das Sams, sondern die verschwundene Wunschmaschine. Sie ist in falsche Hände geraten und richtet mit allerhand Nebenwirkungen in der ganzen Stadt ein Chaos an. Das Wetter spielt verrückt und lässt das Freibad zufrieren, Kühe schweben an Ballons durch die Luft, aus Hydranten quillt klebriger Himbeersaft, Autos verwandeln sich in fahrende Betten und im Stadtpark wächst das Gestrüpp so schnell, dass die Besucher nicht mehr raus können. Dank tatkräftiger Mithilfe der Spielerinnen und Spieler gelingt es dem Sams natürlich, alles wieder ins Lot zu bringen. Die abwechslungsreichen und originell gestalteten Herausforderungen für Kinder ab sechs Jahren verlangen einiges an Geschick und Konzentration, garantieren aber auch länger anhaltendes Vergnügen.
Die meisten Spiele können beliebig oft wiederholt werden. Bei den sieben Punktespielen kann zudem der Schwierigkeitsgrad gewählt werden und über einen direkten Link lässt sich der Spielstand zum Vergleich sogar auf eine Highscoreliste im Internet übertragen.
Beitrag aus Heft »2005/03: Handys im Jugendalltag«
Autor: Daniel Ammann
Beitrag als PDFEinzelansichtManuela Grimm: Spielend Deutsch lernen
Leporello 4. Lern-Spiel-Werkstatt Deutsch. Windows 95 / 98 / 2000 / ME / NT / XP. Westermann Schulbuch Verlag GmbH 2003. Vertrieb über www.toptem.de, 34 €
“Spielend Lernen” ist bei Leporello 4-Lern-Spiel-Werkstatt Deutsch tatsächlich Programm. Beginnend im Spielzimmer gelangen die Kinder der 4. Jahrgangstufe durch Klicken auf die am Boden stehenden Werkzeug- bzw. Spielekisten in die beiden Hauptbereiche „Werkstatt“ und „Lernspiele“.Die Lernspiele in Leporello zeichnen sich durch einen motivierenden Spielcharakter aus, wobei sie aber so aufgebaut sind, dass das Spielen und Üben untrennbar miteinander verbunden sind. Dabei decken die einzelnen Spiele verschiedene Ebenen des Übens ab, wie beispielsweise der „Teppichpilot“ dabei helfen kann, sprachliche Phänomene aufzuzeigen. In der Werkstatt, die bewusst offen und schlicht gehalten wurde, können die Kinder frei gestalten und schreiben. Verschiedene angebotene Schreibanlässe, die Möglichkeit, über die Email-Funktion mit Freunden zu kommunizieren oder Einladungskarten am PC zu gestalten hilft, das Gelernte umzusetzen. Zudem erscheint im rechten unteren Bildschirmrand neben den Namen des Kindes auch seine Punkte. Mit jedem erfolgreich beendeten Spiel steigen die Punkte an.
Dabei ist richtiges Schreiben in den Spielen bewusst viele Punkte wert. Dieses didaktische Belohnungssystem soll zusätzlich motivieren, denn schließlich können für die erspielten Punkte neben Grafiken auch weitere Funktionen in der Werkstatt freigeschaltet werden.Sowohl der klar strukturierte Aufbau als auch die Verbindung von Lernen und Spielen wurde hier mit viel Liebe und Phantasie umgesetzt. Egal ob es sich im „Kaktusgarten“ um das Entwickeln von Sätzen vom Verb aus handelt oder beispielsweise um das Verstehen des Bauprinzips von Wörtern mit Vor- und Nachsilben beim „Zauberfluss“, haben die Kinder sicherlich ihren Spaß. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, zu zweit die Hürden der deutschen Sprache zu nehmen. Schließlich sollte der Editor noch besonders hervorgehoben werden. Er ermöglicht Lehrkräften und Eltern, eigene Übungswörter oder ganze Übungen individuell zusammenzustellen.Die Lernsoftware ist inhaltlich abgestimmt auf das Lehrwerk Leporello 4 (allgemeine Ausgabe), kann aber auch mit jedem anderen Deutschlehrwerk der vierten Klasse eingesetzt werden. Ihr vielfältiger Einsatz erstreckt sich von der Schule bis zum Üben zu Hause.
Obwohl die Lernsoftware den Kindern problemlose und selbstständige Orientierung bietet, sollten vor allem Eltern eine stützende Funktion einnehmen und den persönlichen Fortschritt ihres Nachwuchses beispielsweise im interaktiven Wörterbuch überprüfen.
Beitrag aus Heft »2005/03: Handys im Jugendalltag«
Autor: Manuela Grimm
Beitrag als PDFEinzelansichtManuela Grimm: Klappe und Action!
Nickelodeon. Mein Cartoon Studio - Trickfilme produzieren mit SpongeBob und seinen Freunden. Windows 98 / Me / 2000 / XP; MacOS 9.x-10.x. Junior in der United Soft Media Verlag GmbH 2004. 24,90 €
Trickfilme sind seit jeher ein beliebtes Fernsehformat der Kinder und werden gerne von ihnen angeschaut. Warum sollte man sie dann nicht auch versuchen lassen, einen eigenen Trickfilm zu produzieren? Dass dies viel Spaß machen kann, zeigt Mein Cartoon Studio. Begleitet von dem Sprecher der Figur des Planktons aus der Serie SpongeBob – Schwammkopf wird das Kind durch die Studiowelt geleitet. Vom Aussuchen der einzelnen Schauplätze über die Auswahl der Trickfilmcharaktere wie SpongeBob, Jimmy Neutron oder Tommy Pickles bis zu den Requisiten ist an alles gedacht. Szene für Szene gibt man den „Schauspielern“ ihre Bewegungsabläufe, Gefühle und Texte.
Selbst Kamerafahrten und lustige Geräusche lassen sich einbauen. Als letzten Schritt werden dann die richtigen Übergänge (z.B. Überblenden) zwischen den Szenen und der passenden Musik hinzugefügt. Sämtliche Elemente, angefangen über den Hintergrund, über Bewegungen der Figuren bis hin zu der Hintergrundmusik entnehmen die kleinen Regisseure einer Auswahl von vorgegebenen Möglichkeiten, die sie dann aber nach ihren eigenen Vorstellungen einbinden können. Ihrer Fantasie überlassen sind sie auch bei dem Gestalten der einzelnen Dialoge.Ganz leicht lässt sich das Meisterwerk dann auch per Email an Freunde oder Bekannte schicken. Und dann heißt es nur noch, Licht aus, hingesetzt, Popkorn geschnappt und Film an! Geeignet ist Mein Cartoon Studio für Kinder ab acht Jahren.
Beitrag aus Heft »2005/03: Handys im Jugendalltag«
Autor: Manuela Grimm
Beitrag als PDFEinzelansichtManuela Grimm: Weltraum-Trip mit Lerncharakter
Flipps Galaktische Abenteuer. Windows XP / 2000 / 98. BrainGame Publishing GmbH 2004. 24,99 €
Für Flipp, der später einmal Raumfahrer werden will, ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Er darf eine Woche im berühmten Hotel Luna Plaza auf dem Mond verbringen. Endlich gelandet, lernt Flipp die hübsche Sunny kennen, die ein großes Geheimnis mit sich trägt, das an dieser Stelle natürlich noch nicht gelüftet wird. Die zwei werden Freunde und überlisten im Spielverlauf jede Menge intelligenter Wachroboter, Kontrollkameras und Laserschranken. Sogar Ausflüge mit den Raumschiff durch das Sonnensystem und Asteroidenfelder erwarten die beiden. Unerwartet trifft Flipp dann auf eine außerirdische Lebensform... Flipp wird während des Abenteuers mit Hilfe der Tastatur und Maus gesteuert, was zu Anfang größere Schwierigkeiten bereiten kann. Seine Aufgaben bestehen aus einzelnen Missionen, die sich jeweils im Mondhotel und Raumschiff abspielen sowie einen Ausflug beinhalten.
Durch das Sammeln von Mondsteinen lassen sich in der Bonusgalerie Bilder zum Spiel freischalten. Einen besonderen Anreiz bietet die Möglichkeit, seinen eigenen Punktestände über die Website www.flipps-abenteuer.de mit anderen Spielern zu vergleichen.Neben einem Inventar, Kommunikator und dem GPS (Global Positioning System) kann Flipp auf das so genannte Brainpad zugreifen. Während des Spiels nutzt Flipp sein Brainpad, um Wissen abzurufen, das er für die Lösung von Aufgaben benötigt. Es enthält alphabetisch geordnet alles Wissenswerte zum Thema Astronomie. Die Spieler lernen dadurch nebenbei interessantes zu Phänomenen des Universums, vom Urknall bis zu den Wurmlöchern. Die zahlreichen Videos, Animationen und Grafiken des Brainpads lassen sich übrigens auch einsehen, ohne ein Spiel zu starten.
Flipps Galaktische Abenteuer (offizielles Begleitprodukt zur „Langen Nacht der Sterne“) ist ein gewaltfreies Action-Adventure-Spiel, das durch das Brainpad einen edukativen Anteil enhält. Es richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 14 Jahren.
Beitrag aus Heft »2005/03: Handys im Jugendalltag«
Autor: Manuela Grimm
Beitrag als PDFEinzelansichtHans Peter Kistner: Mehr Schiller auf die Ohren!
Schiller für Kinder. der hörverlag 2005, www.hoer verlag.de, 9,95 €
Es ist das Schillerjahr, entsprechend hoch ist der Ausstoß an Schiller-Material, für jeden Kanal, für jede Zielgruppe. So auch für die Kinder ab 6 Jahren, hier mit einer CD des Hörverlags. Ausgewählte Gedichte des Klassikers, gelesen von Peter Härtling, dem bekannten Schriftsteller und Kinderliteraten. Härtling versieht sie jeweils mit einer kurzen Einführung und einem erzählenden Rahmen. Um die Klassiker, die „Glocke“, die „Bürgschaft“, den „Taucher“ und den „Ring des Polykrates“, setzt er auch Unbekanntes wie ein Gedicht des zehnjährigen Schiller oder das „Untertänigste pro memoria an die Konsistorialrat Körnerische weibliche Waschdeputation in Loschwitz eingereicht von einem niedergeschlagenen Trauerspieldichter“.
Dass Hörmedien eine solche Renaissance erfahren, liegt sicher an der besonders suggestiven Kraft des Gehörten. Das gilt auch hier. Die Kinder werden mit Sicherheit nicht alles erfassen, was Schiller in seine Verse legte, die CD lohnt sich trotzdem. Die Kraft der gebundenen Sprache bleibt hängen im Kindergehirn, zwischen all den Handy-Klingeltönen, Hiphop-Versen und dem hundertsten „Töröööö“ Benjamin Blümchens und wird später als Erinnerung wieder belebt, wenn es mal drauf ankommt. Trotz der angenehm ruhigen Großvater-Stimme Härtlings: Manchmal kommt der Wunsch auf, dass eine jüngere Stimme mit mehr Ecken und Kanten die Gedichte liest. Es muss ja nicht immer Rufus Beck sein. Und eine gewisse Dramatik schadet auch den Kindern nichts. Trotzdem eine insgesamt gelungene CD, der eine größere Verbreitung zu wünschen ist.
Manuela Grimm: Tiere sprechen über sich
Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH (2004). Erlebnis Bauernhof. Tierstimmen und Geräusche des Landlebens. Erhältlich beim DLV, Leserservice, Postfach 1440, 30014 Hannover, Fon 0511.67806-0, vertrieb.hannover @dlv.de; 10 € zzgl. Versand
Auf einem Bauernhof gibt es für Groß und Klein immer viel zu sehen, bestaunen und vor allem viel zu hören. Die typischen landwirtschaftlichen Klänge und originalgetreuen Laute der Bauernhoftiere versetzen den Zuhörer für rund 72 Minuten auf einen aktiv betriebenen Bauernhof. Neben den authentischen Tierlauten und Geräuschen gibt es ein 24-seitiges Begleitheft. Hier bekommt man kurze zusätzliche Informationen zu den Tierlauten und den Nutzen des Tieres für den Menschen. So erfährt man beispielsweise, dass die Wachtel der kleinste Hühnervogel ist und sein dreisilbiger „Pick-wer-wick“ Gesang auch Wachtelschlag genannt wird. Quizfragen, das Spiel des „Grünen Männchens“ oder ein Memory geben die Möglichkeit zu testen, wie gut man nun die Geräusche erkennen kann.
Richtig eingesetzt, zum Beispiel als Vorbereitung für den Besuch auf einem Bauernhof oder zum „Geräusche-Raten“, bietet die Audio-CD nicht nur für die Kleinen ab ca. fünf Jahren ein wunderbar vergnügliches und anspruchsvolles Hörerlebnis.
Beitrag aus Heft »2005/03: Handys im Jugendalltag«
Autor: Manuela Grimm
Beitrag als PDFEinzelansicht
Zurück