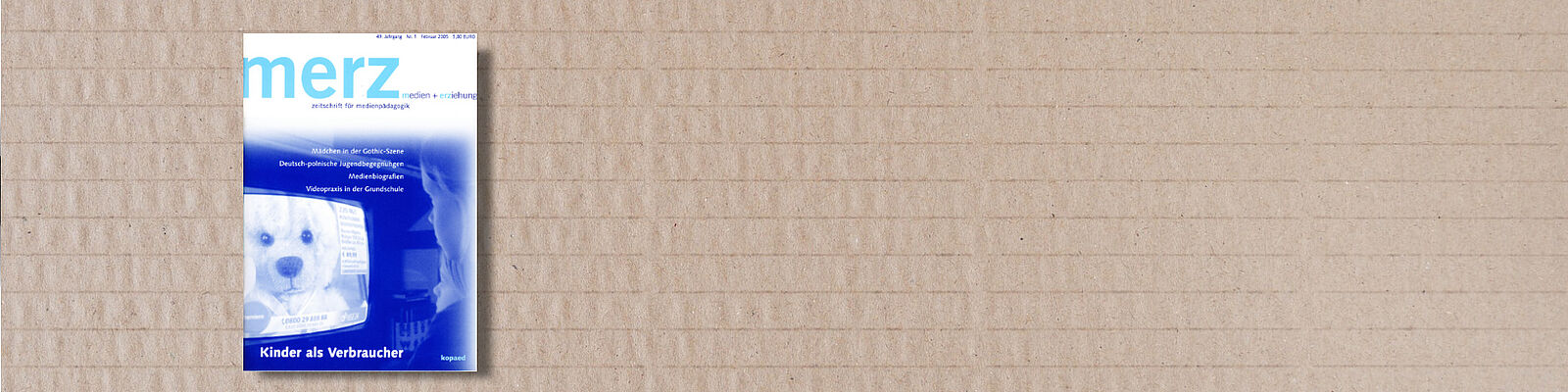2005/01: Kinder als Verbraucher
thema
Stefan Aufenanger: Medienpädagogische Überlegungen zur ökonomischen Sozialisation von Kindern
In der kindlichen Sozialisation hat Werbung eine große Bedeutung, schon früh sind Kinder damit konfrontiert und werden von der Werbeindustrie als autonome Verbraucher betrachtet.
Der Beitrag liefert einen Überblick über den Stand der aktuellen Forschung.
(merz 2005-1, S.11-16)
Ingo Barlovic / Christian Clausnitzer: Kommerzielle Werbeforschung bei Kindern
Der Beitrag ermöglicht einen Perspektivenwechsel .
Er verfolgt keine pädagogischen oder werbekritischen Interessen, sondern zeigt, wie die Werbeindustrie und die kommerzielle Werbeforschung Kinder als Zielgruppe ihrer Bemühungen wahrnehmen.
(merz 2005-1, S.17-22)
Beitrag aus Heft »2005/01: Kinder als Verbraucher«
Autor: Ingo Barlovic, Christian Clausnitzer
Beitrag als PDFEinzelansichtHardy Dreier / Claudia Lampert: Kinder im Netz der Marken
Im dem Beitrag werden Ergebnisse einer umfangreichen Studie vorgestellt, die das Phänomen „Medienmarken“ aus einer medienökonomischen und aus einer rezipientenorientierten Perspektive beleuchtet.
(merz 2005-1 S.24-30)
Beitrag aus Heft »2005/01: Kinder als Verbraucher«
Autor: Hardy Dreier, Claudia Lampert
Beitrag als PDFEinzelansichtNorbert Neuss: Medienpädagogische Ansätze zur Stärkung der Verbraucher- und Werbekompetenz
Längst sind Kinder zu einer marktrelevanten Größe geworden, die im Supermarkt als Kauf-Entscheider auf die Eltern Einfluss nehmen oder zu den „großen“ Festen die werbevermittelten Wünsche äußern.
Deshalb soll zunächst kurz die Notwendigkeit für medienpädagogische Maßnahmen in Kindergarten und Grundschule begründet werden. Anhand von Arbeitsmaterialien, die sich an Kinder richten, sollen die Möglichkeiten medienpädagogischer Arbeit aufgezeigt werden.
Schließlich wird für eine visionäre Medienpädagogik plädiert, die sich traut, normative Aussagen für diesen Bereich zu formulieren.(merz 2005-1, S.31-36)
Birgit Guth / Silke Knabenschuh: Media Smart
Mit dem Werbekompetenz-Projekt Media Smart (www.mediasmart .org.uk) gelang es in Großbritannien, Werbeerziehung als Unterrichtsgegenstand in der Grundschule einzuführen.
Die Zusammenarbeit von Werbung treibender Industrie, Medienpädagogen und Kultusministerium ermöglichte die Bereitstellung kostenloser Lehrmittel, die Kindern zwischen sechs und elf Jahren helfen, Werbung im heutigen Alltag zu hinterfragen.
Das Projekt stieß auch in Holland, Belgien und Deutschland auf Interesse. Da in deutschen Grundschulen bislang kein fester Rahmen für Werbeerziehung existiert, könnte eine Adaptation des Media Smart-Materials eine zeitgemäße Ergänzung bieten.
(merz 2005-1, S.37-41)
Beitrag aus Heft »2005/01: Kinder als Verbraucher«
Autor: Birgit Guth, Silke Knabenschuh
Beitrag als PDFEinzelansicht
spektrum
Aline Blanchot / Verena Mayr-Kleffel: Kultur- und Medienpädagogik mit Mädchen aus der Gothic-Szene
Der Artikel belegt am Beispiel der Gothic-Szene, dass weibliche Szeneangehörige in nur geringem Ausmaß an den kulturellen Aktivitäten partizipieren.
Mittels einer Befragung im Internet von136 Mädchen lässt sich ihr Weg in die Szene und ihr Aktivitätsprofil nachzeichnen. Die meisten Befragten äußerten Interesse, sich aktiv an Projekten zu beteiligen.
Es gibt also einen Bedarf an szenespezifischen medien- und kulturpädagogischen Angeboten; der Artikel schließt mit konkreten Vorschlägen.(merz 2005-1, S.42-46)
Beitrag aus Heft »2005/01: Kinder als Verbraucher«
Autor: Aline Blanchot, Verena Mayr-Kleffel
Beitrag als PDFEinzelansichtJürgen Fiege: Medienkompetenz in deutsch-polnischen Jugendbegegnungen
Das im Jugendhof Steinkimmen entwickelte Konzept der Verbindung von politischer und kultureller Bildung ist für die internationale Jugendbildung gut geeignet: Kulturelle Medien werden nicht als pädagogische Methode und Inhalte nicht als Staffage für künstlerische Formexperimente benutzt.
Das Thema wird medial bearbeitet, das Medium und seine Gesetzmäßigkeiten werden thematisiert.
(merz 2005-1, S.47-52)
Ralf Biermann / Sven Kommer: Medien in den Biografien von Kindern und Jugendlichen
Wie kompetent Jugendliche tatsächlich mit Medien umgehen, ist Thema eines Forschungsprojektes an der PH Freiburg.
Unterschiedliche Erhebungsmethoden führten zu dem Ergebnis, dass Jugendliche und junge Erwachsene, auch wenn sie sich einen Großteil ihrer Zeit mit Medien beschäftigen, durchaus noch Wissenslücken und demzufolge Lernbedarf haben.
(merz 2005-1, S.53-59)
Beitrag aus Heft »2005/01: Kinder als Verbraucher«
Autor: Ralf Biermann, Sven Kommer
Beitrag als PDFEinzelansichtChristine Hümpel-Lutz : Videopraxis in der Grundschule
Vielen Kindern fehlen heutzutage oftmals eigene Realitätserfahrungen aus erster Hand; sie erleben vielmehr ihre Umwelt via Medien.
In einem Forschungsprojekt der Universität Hannover wurde deshalb der Versuch unternommen, Multimedia im Grundschulunterricht dazu einzusetzen, dass die Kinder körper-sinnliche und gleichzeitig virtuell-bildliche Erfahrungen machen können.
(merz 2005-1, S. 60-65)
Beitrag aus Heft »2005/01: Kinder als Verbraucher«
Autor: Christine Hümpel-Lutz
Beitrag als PDFEinzelansicht
medienreport
Georg Pleger: Urheberrechtliche Selbstbestimmung für Kreativschaffende
AutorInnen, FotografInnen oder MediengestalterInnen hatten bislang wenige Wahlmöglichkeiten, um die Nutzungsrechte an ihren Werken differenziert zu regeln. Die Initiative Creative Commons stellt deshalb im Internet eine Palette von einfachen Lizenzmodellen zur Verfügung. Sie erlaubt den Kreativen, selbst zu bestimmen, ob und wie ihre Werke kopiert, verändert oder vermarktet werden dürfen.
An der Erstellung und Weiterentwicklung von Medieninhalten unterschiedlichster Art sind zunehmend mehr Institutionen und Personen beteiligt. Da wird die rechtlich saubere Klärung von Urheber- und Verwertungsrechten zu einem schwer handhabbaren Problem. Ein einfaches Beispiel: Ein Unterrichtsvideo und das entsprechende Begleitmaterial soll aus Dutzenden von gut wiederverwendbaren Medienobjekten erstellt werden. Die Bestandteile kommen aus unterschiedlichsten Quellen und sollen später in verschiedensten Zusammenhängen genutzt und weiterentwickelt werden. Die Creative Commons-Lizenzen erlauben es, Werke zu verteilen, darzustellen, zu kopieren oder zu senden, solange dabei die von der Autorin gewählten Bedingungen eingehalten werden. Damit soll die ganze Palette zwischen „Alle Rechte vorbehalten“ und „Keine Rechte vorbehalten“ (Public Domain) abgedeckt werden.
Es gibt vier zentrale Elemente, aus denen die Lizenzen wie in einem Baukastensystem zusammengesetzt werden können:
Der Name des Autors / Rechtsinhabers muss genannt werden.
Keine kommerzielle Nutzung
Die Inhalte dürfen nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Weitergabe unter gleichen Bedingungen
Wenn die Inhalte bearbeitet oder verändert werden, dann dürfen die neu entstandenen Inhalte nur unter Verwendung identischer Lizenzbedingungen weitergeben werden.
Keine Bearbeitung
Die Inhalte dürfen nicht bearbeitet oder in anderer Weise verändert werden.
Ein konkretes Beispiel für das Funktionieren: Lydia wählt für ihre Songs auf der Website von Creative Commons eine Lizenz aus. Sie entscheidet sich gegen eine kommerzielle Verwertung und dafür, ihr Werk bearbeiten zu lassen, solange andere die gleichen Lizenzbedingungen verwenden wie sie. Jetzt kann sie ihre Werke mit einer leicht verständlichen, rechtlich abgesicherten und auch technisch ausgeklügelten Lizenz verlinken – und das Ganze kostenlos. Jede Lizenz ist in drei Fassungen formuliert: einer leicht verständlichen Fassung für den Endnutzer, einer rechtlich verbindlichen Lizenz, und einem z.B. für Suchmaschinen lesbaren Code.
Wenn nun etwa Olivier in seinem Video einen Song von Lydia verwenden möchte, kann er dies tun, ohne mit Lydia noch lange Verhandlungen führen zu müssen. Sie hat bereits genau definiert, was mit ihrem Werk gemacht werden darf und was nicht. Das Ergebnis könnte ein Video von Olivier mit Songs von Lydia sein. Dazu haben die beiden aber keinen großen rechtlichen oder organisatorischen Aufwand betreiben müssen. Nach diesem Prinzip kann auch die Produktion von komplexeren Medienprodukten organisiert werden.
Derzeit laufen weltweit in ca. 70 Ländern die Vorbereitungen für die Übertragung der Lizenzen in das nationale Recht. Creative Commons erhielt im Herbst den Preis der Goldenen Nica beim Prix Ars Electronica in der Kategorie Net Vision, „weil damit der Überregulierung durch internationales Urheberrecht und Technologien wie Digital Rights Management (DRM) eine echte Alternative gegenübergestellt wird“, so die Begründung der Jury.
Weitere Informationen:
International: http://creativecommons.org
Deutschland: de.creativecommons.org
Österreich: creativecommons.at
Georg Pleger
Tillmann P. Gangloff: Pizzabote wird Geheimagent
Bei Fernsehmessen wie der Mipcom in Cannes profiliert sich das ZDF in der Regel mit teuren Dokumentationen oder aufwändigen Krimiserien. Diesmal war das ganz anders: Im Schaufenster stand die Kinderserie Scooter. Wie schon Wicked Science (Total genial) ist Scooter: Secret Agent eine Koproduktion mit dem Australier Jonathan M. Shiff. Der hat eine Gabe, die im Geschäft mit bewegten Bildern Gold wert ist: Bei ihm sieht alles viel teurer aus, als es in Wirklichkeit war. Die 26-teilige Serie war mit 6 Millionen Euro zwar trotzdem nicht billig, doch ZDF-Enterprises wird einen großen Teil dieses Geldes durch den Weltvertrieb wieder reinholen. Scooter ist eine Parodie auf die James-Bond-Filme oder aufwändige Agenten-Thriller wie Mission: Impossible mit dem Charme der Kinderkinoknüller Spy Kids. Nicht nur die Effekte, auch das dynamische Erzähltempo und die immer wieder um Originalität bemühte Erzählweise sind kinowürdig. Doch was am meisten Spaß macht, ist die Geschichte: Titelheld Scooter ist ein Pizza-Junge mit Neigung zum Pechvogel.
Er hält sich zwar für den Größten, fällt aber dauernd auf die Nase. Eines Tages wird er Zeuge einer Verfolgungsjagd. Der Gejagte verliert einen Koffer, den sich Scooter gleich schnappt. Er enthält einen Computer, über den sich ein ominöses Hauptquartier meldet, das Scooter für den Agenten X-19 hält und ihm den nächsten Auftrag erteilt. Das ZDF wäre gut beraten, die Agentenparodien nach der KI.KA-Premiere nicht samstags oder sonntags vormittags im Kinderprogramm zu verstecken; die witzigen und turbulenten Abenteuer gehören in die beste Familienfernsehzeit. Wie richtig die Entscheidung von ZDF-Enterprises war, sich diesmal mit Kinderfernsehen zu positionieren, zeigte der Vergleich mit dem restlichen Angebot: In kreativer oder gar künstlerischer Hinsicht ist gerade der Zeichentrickmarkt derzeit erschreckend leblos. Neu sind allenfalls die Verpackungen. Themen, Geschichten, Design: alles kalter Kaffee. Der Boom vergangener Jahre ist ohnehin vorbei. Es ist daher durchaus kein Zufall, dass die Sender ausgerechnet jetzt die so genannte Live Action wiederentdecken. Real gefilmte Serien hatten es jahrelang äußerst schwer, weil sie als nicht exportfähig galten: Während Zeichentrick viel leichter zu synchronisieren ist und meist in Fantasiewelten spielt, haben Realserien in der Regel einen konkreten kulturellen Hintergrund. Trotzdem ist die Nachfrage gewachsen, was sicher auch damit zu tun hat, dass Kinder immer früher die Lust an Zeichentrickserien verlieren: Ab neun ist so was Kinderkram. Spätestens der Erfolg der witzigen Disney-Serie Lizzie McGuire, in der die Titelheldin immer wieder Rat bei ihrem animierten Alter ego sucht, hat Begehrlichkeiten geweckt.
Im nicht minder erfolgreichen Kinofilm zur Serie (Popstar auf Umwegen), der allein in den USA 40 Millionen Dollar einspielte, wird Lizzie in Europa mit einer populären Pop-Sängerin verwechselt. Und da ja auch die diversen Casting-Shows gerade unter Kindern und Jugendlichen die treuesten Fans haben, wundert es nicht weiter, dass einige der neuen Serien ebenfalls auf Musik setzen: Im Mittelpunkt von Unfabulous (Unberühmt, Nickelodeon) steht Addie Singer, eine typische Zwölfjährige, deren Alltag von den ganz normalen Querelen mit Schule und Eltern geprägt ist. Was sie von ihren Mitschülern allerdings unterscheidet, ist ihr Talent: Sie schreibt Songs, in denen sie all die Dinge verarbeitet, mit denen sich ein junges Mädchen herumschlagen muss. Interessant ist auch die Besetzung: Addie wird gespielt von Emma Roberts, einer Nichte von Hollywood-Star Julia Roberts. Entscheidend für den Erfolg der neuen Serien ist die Authentizität: Selbst wenn die Kinder in den Geschichten in zumindest einer Beziehung völlig anders sind als andere Gleichaltrige – einer kann in die Zukunft sehen, ein anderer ist Filmstar –, so ist der Rest ihres Lebens ganz und gar gewöhnlich. Und das heißt für die Zielgruppe (circa 9 bis 13 Jahre): Jeder Tag bedeutet Kampf.
Doch während Jungen und Mädchen in der Regel schon genug Probleme damit haben, im falschen Körper zu stecken, steckt Phil Diffy aus Phil of the Future (Disney) auch noch in der falschen Zeit: Er gehört eigentlich ins 22. Jahrhundert, ist aber mit seiner Familie während einer Zeitreise im Amerika des Jahres 2004 gestrandet. Phil hat damit das typische Teenager-Problem, sich irgendwie mit seiner Umgebung arrangieren zu müssen, in potenzierter Form. Für die Produzenten haben diese Erfolgsproduktionen nur einen Nachteil: Sie lassen sich bei weitem nicht so gut vermarkten wie Zeichentrickserien. Kein Wunder: Die Zielgruppe ist nur noch selten in Spielzeuggeschäften anzutreffen. Aber man kann ja nicht alles haben.
Tilmann P. Gangloff
Beitrag aus Heft »2005/01: Kinder als Verbraucher«
Autor: Tilmann P. Gangloff
Beitrag als PDFEinzelansichtMagret Köhler: Erfolg mit der Vergangenheit
Damit hatte niemand gerechnet: Ein Film über das Ende des Dritten Reichs wurde zum Publikumsrenner. Der Untergang von Oliver Hirschbiegel brachte es bis Anfang Januar auf gut 4,5 Mio. Zuschauer. Während sonst Polit-Dramen über Nazi-Deutschland in Programmkinos ein klägliches Dasein fristeten, traf Der Untergang auf großes Interesse, nicht nur national, sondern auch international. In Frankreich überrundete er am Startwochenende sogar Oliver Stones Alexander. Es sind zunehmend Regisseure der mittleren und jüngeren Generation, die sich des Themas annehmen. Vielleicht haben auch Fernseh-Dokumentationen über Graf von Stauffenberg oder Albert Speer den Weg bereitet. Im Gegensatz zu den an Wissensvermittlung orientierten älteren Spielfilmen wird Geschichte und Anspruch an breite Unterhaltung verknüpft, wollen die jungen Regisseure anhand fiktionalisierter, aber historisch genau recherchierter Geschichten die Menschen erreichen. Gerade die 30- bis 40-jährigen Filmemacher entwickeln ein Faible für das, was unter den Nazis geschah. Sechzig Jahre nach Kriegsende ist der Blick zurück nicht mehr von politischer Bewältigung oder pädagogischer Aufarbeitung geprägt, sondern von einer manchmal unbekümmert wirkenden Neugier und Herangehensweise wie in Dennis Gansels Napola über die Elite-Zuchtanstalten Hitlers.
Wohl das beeindruckendste und ehrlichste Drama aus der Zeit des braunen Terrors ist Marc Rothemunds Sophie Scholl - Die letzten Tage. Aufgegriffen wurde das Schicksal der Widerstandskämpferin schon in Michael Verhoevens Die weiße Rose mit Augenmerk auf die Entwicklung der gesamten Widerstandsgruppe und in Percy Adlons Fünf letzte Tage (beide 1982), primär erzählt aus der Perspektive von Else Gebel, Sophies Zellengenossin. Rothemunds Ansatz ist ein anderer, ein mehr persönlicher. Er geht weiter, endet mit der Hinrichtung von Hans und Sophie Scholl sowie ihres Mitstreiters Christoph Probst im Februar 1943. Während Sophie bei Verhoeven nicht weinen durfte, ist hier die innere Reise der Protagonistin auf Emotionalität angelegt. So wird die Studentin als ganz normales Mädchen eingeführt, das die Natur liebt, ausgelassen zur Swing-Musik aus dem Feindsender tanzt und vor Lebenslust nur so sprüht. Sie ist gläubig, aber nicht frömmelnd. Die Handlung stellt sich aus ihrem Blickwinkel dar - die Verhaftung der Geschwister nach einer Flugblattaktion im Lichthof der Uni München, ihr verbales Kräftemessen mit dem Ermittlungsbeamten Hans Mohr, den sie fast von ihrer Unschuld überzeugen kann, das Warten in der Zelle auf die Hinrichtung, ihr mutiges Auftreten gegenüber Blutrichter Freisler in einer Farce von Gerichtsverhandlung, der rührende Abschied von den Eltern, die letzte Zigarette mit ihrem Bruder und Probst, der aufrechte Gang zum Schafott. Leise Trauer über ein zu kurzes Leben. Der 36-jährige Regisseur stützt sich auf bis zur Wende in der DDR unter Verschluss gehaltene Protokolle, die die Verhöre aus der Sicht des Gestapo-Beamten wiedergeben. Aber nicht nur.
So wurde sogar mit Uhr gestoppt, wie lange es dauerte vom Schließen des Vorhangs bis zum Fallbeil. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Sophie Scholl wurde nur 22 Jahre alt.Großen Stellenwert räumt Rothemund dem gewieften Verhörspezialisten Mohr ein, eine nicht ganz durchschaubare Persönlichkeit, die auf der einen Seite den Nazis treu dient, aber dennoch seine Zweifel ahnen lässt, vielleicht weil er persönlich betroffen war, sein Sohn an der Front kämpfte. Ein Höhepunkt des Film ist die „Verhandlung“ unter Roland Freisler persönlich, der extra mit dem Flugzeug nach München kam. Die Darstellung eines der schlimmsten Nazi-Verbrechers (André Hennicke), der 6000 Todesurteile fällte, mag übertrieben wirken, entspricht aber den zum Vergleich herangezogenen Originalaufnahmen.Rothemund und seine wunderbare Hauptdarstellerin Julia Jentsch schufen eine Vorstellung des Menschen und des Charakters Sophie Scholl. Die junge Frau ist keine Märtyrerin, sondern jemand, der das Leben in allen Facetten liebt und leben möchte, erst nach und nach wird sie zur Heldin, verzichtet auf Brücken, die ihr Mohr baut, trotz aller Angst steht sie zu ihrer Überzeugung und schützt mit ihren Aussagen die anderen Mitglieder der Widerstandsorganisation. Und immer wieder der Blick aus dem Fenster, in den Himmel – Symbol der Freiheit. Aufwühlend die Szene, in der Sophie sich von den Eltern verabschiedet, keine falsche Sentimentalität, sondern nachvollziehbares Gefühl.
Die Kamera unterstreicht die Entwicklung: Am Anfang hell ausgeleuchtet, in der Zelle und während der Vernehmung erscheint alles farbloser und kälter, am Ende wird es immer weißer – eine Reise ins Licht. Von der anfänglichen Offenheit der Bilder entwickelt sich der Film sukzessive zu einem atmosphärisch dichten Kammerspiel, zu einem sensiblen Porträt. Dass dies hundertprozentig gelingt, liegt auch an Julia Jentsch, die mit großer Intensität und Glaubwürdigkeit die Figur verkörpert. Sophie Scholl - Die letzten Tage ist ein Glücksfall für das deutsche Kino. Selten wurde ein Stück jüngster Vergangenheit so eindringlich vermittelt. Die Botschaft Widerstand leisten, Zivilcourage zeigen, gilt noch heute.
Beitrag aus Heft »2005/01: Kinder als Verbraucher«
Autor: Margret Köhler
Beitrag als PDFEinzelansichtThomas Jacob: Propeller statt Düsen
IL2-Sturmovik ist eine historische Flugsimulation für den PC. Den ungewöhnlichen Namen hat das Spiel nach einem russischen Kampfflugzeug des Zweiten Weltkrieges erhalten.Historische SimulationenSimulationen von Flugzeugen des Ersten und Zweiten Weltkrieges erfreuen sich großer Beliebtheit unter PC-Spielern. Denn in den alten Propellermaschinen kommt es vor allem auf die Geschicklichkeit und richtige Taktik an, um Luftkämpfe zu gewinnen. Der Gegner kommt nahe heran, die Flugzeuge umkreisen einander. Ziel ist es, sich hinter den Feind zu setzen, um in eine gute Schussposition zu kommen. Simulationen moderner Kampfjets sind da viel nüchterner und „unpersönlicher“. In ihnen spielt sich der Großteil der Gefechte mittels Lenkraketen über riesige Entfernungen ab, der Gegner ist meist nur als Punkt auf dem Radarschirm zu erkennen. Viele Spieler ziehen daher den Nervenkitzel eines direkten Duells vor, den historische Simulationen vermitteln.Flugsimulationen, die im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sind, gibt es daher in großer Zahl. Fast alle haben entweder den Krieg im Pazifik oder den Luftkrieg um England zum Schauplatz. Denn England und die USA sind wichtige Absatzmärkte für Computerspiele. IL2-Sturmovik ist die erste aufwändige Flugsimulation, die sich ausschließlich mit dem Luftkrieg zwischen Russland und Deutschland beschäftigt. Trotz des ungewöhnlichen Szenarios wurde das Spiel ein internationaler Bestseller, auch wenn die Verkaufszahlen von Simulationen bei weitem nicht an die von Actiontiteln heranreichen. Entwickelt wurde das Programm von der bis dahin völlig unbekannten russischen Spieleschmiede „Maddox Games“. Als das Spiel Ende 2001 erschien, überschlug sich die Fachpresse vor Begeisterung, das Spiel gewann nahezu alle Preise als „Simulation des Jahres“.So authentisch wie möglichObwohl nach dem Modell „IL2-Sturmovik“ benannt, kann der Spieler nicht nur dieses eine Flugzeug steuern. Insgesamt tauchen über 70 Modelle im Spiel auf, bei 31 davon darf man selbst ins Cockpit steigen. Alle Flieger sind bis ins kleinste Detail modelliert, sämtliche Maße, Farben und Flugeigenschaften sind originalgetreu. Die Programmierer betonen, dass sie jede Einzelheit selbst recherchiert und anhand von historischen Unterlagen und Fachliteratur geprüft haben. Auch für die authentische Geräuschkulisse wurden keine Mühen gescheut. Die Entwickler produzierten aufwändige Tonaufnahmen von Originalflugzeugen, für den simulierten Funkverkehr wurden historische Mikrofone benutzt.
Viel Aufwand für ein Computerspiel, der sich aber lohnt. Denn für Simulationsfreaks steht die historische Korrektheit an erster Stelle - obwohl sicher kaum ein Spieler wirklich beurteilen kann, ob das Flugverhalten authentisch ist. Aber zumindest die Illusion, ein echtes Flugzeug zu fliegen, soll so perfekt wie möglich sein. Und in diesem Punkt bildet IL2-Sturmovik die Referenz im Simulationsgenre. Im höchsten Realitätsgrad bedarf es schon sehr viel Übung, das Flugzeug heil in die Luft und wieder auf den Boden zu bekommen. Von Erfolgen gegen die Gegner ganz zu schweigen. Denn auch im Bereich der Künstlichen Intelligenz gehört das Programm zu den Besten. Die computergesteuerten Piloten lassen sich kaum austricksen und machen auch erfahrenen Spielern zu schaffen. Natürlich lässt sich die Realitätsnähe herunterregeln, damit auch Einsteiger Erfolgserlebnisse haben.Kampagne und Multiplayer
Zum Einstieg in das komplexe Programm empfiehlt sich die virtuelle Flugschule, die den Spieler in mehreren Lektionen behutsam in die Simulation einführt. Mittels Sprachausgabe und Vorführungen werden Cockpitinstrumente und Flugmanöver vorgestellt, die man danach selbst ausprobieren kann. Das Herzstück des Spieles aber ist die „Pilotenkarriere“. Der Spieler entscheidet sich für die deutsche oder russische Seite und beginnt seine Laufbahn. Immer neue Missionen werden ihm zugewiesen, es gibt Beförderungen und Orden zu erringen. Egal wie gut der Pilot aber auch ist – am historischen Verlauf des Krieges ändert sich nichts.Besonders wichtig bei einer Flugsimulation ist der Multiplayermodus. Bei IL2-Sturmovik können bis zu 32 Spieler gleichzeitig an einer Mission teilnehmen – entweder über ein Netzwerk oder über das Internet. Neben dem klassischen „Jeder-gegen-Jeden“-Modus besteht auch die Möglichkeit, Missionen kooperativ zu bestreiten. Sogar die Aufgabenteilung innerhalb eines Flugzeuges ist möglich: Ein Spieler fliegt, der andere bedient das Heckgeschütz.
Auch eine echte Kommunikation mit den anderen Spielern über Mikrofon ist vorgesehen. Es ist sogar möglich, sein Flugzeug mit einem eigenen Anstrich zu versehen. IL2-Sturmovik ist ein sehr populärer Multiplayertitel im Internet. Hunderte Spieler tummeln sich zu jeder Tages- und Nachtzeit auf den Servern der „Gaming Zone“ von UBI Soft, dem Publisher des Spiels. Auch Dutzende so genannter „Schwadronen“ existieren, Spielergemeinschaften im Internet, ähnlich den „Clans“ für Actionspiele. Die Mitglieder einer Schwadron trainieren gemeinsam und treten gegen andere Schwadronen an. Oft treffen sich die Teilnehmer einer solchen Gruppe auch mal im realen Leben, um sich kennen zu lernen und auszutauschen. Andere Fans erstellen neue Flugzeuge, Missionen oder Kampagnen und stellen sie zum Download bereit. Nachfolger in SichtSowohl ein gelungener Multiplayermodus als auch einfache Erweiterbarkeit sind heute wichtige Merkmale für den langfristigen Erfolg eines Spiels. Denn so fesselt das Programm auch nach dem ersten Durchspielen weiter und bleibt im Gespräch – gut für die Verkaufszahlen. Nach dem Erfolg von IL2-Sturmovik war es nur eine Frage der Zeit, bis ein Nachfolger angekündigt wurde. Die nächste Simulation von „Maddox Games“ soll noch in diesem Jahr erscheinen. Pacific Fighters wird dann einen klassischen Flugsimulationsschauplatz haben: den Luftkrieg zwischen den USA und Japan.
Milena Chieffo: Junge Dschungelforscher
Expeditionen ins Tierreich für Kinder: Abenteuer im Dschungel. Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP; MAC System MacOS 8.1 – 9.x. Studio Hamburg Fernseh Allianz (FA) GmbH 2002/2004. Über www.ARD-VIDEO.de und www.usm.de erhältlich, 19,90 €.
Der Held dieses Spiels ist der kleine Junge Joe, der im Regenwald bei seinem Onkel, einem Naturfilmer, seine Sommerferien verbringen möchte. Doch erst mal heißt es für Joe, diesen zu finden, denn Onkel Klaus ist samt Tieraufnahmen, die ein Fernsehsender in Auftrag gegeben hat, verschwunden. Mit Hilfe eines sprechenden Affen macht sich Joe auf die Suche nach seinem Onkel und hat gleichzeitig die Aufgabe neue Filmaufnahmen von allerlei verschiedenen Tierarten zu machen. Dabei gibt es Interessantes über die Tierwelt zu lernen und zu erforschen. Wahlweise kann dieses Computerspiel auch in englischer Sprache gespielt werden.Es wird darauf hingewiesen, dass die Aufmerksamkeitsspanne für 6- bis 7-Jährige nach 30 Minuten, bei 10-Jährigen nach 90 Minuten erschöpft ist.
Das Spiel mit der bunt gestaltenden Zeichentrickgraphik beinhaltet eine Reihe von Echtfilmsequenzen aus Dokumentarfilmmaterial der ARD-Reihe Expeditionen ins Tierreich, die das jeweilige Tier in seinem natürlichen Lebensraum zeigen. Das spielende Kind hat die Möglichkeit, diese Informationen immer wieder abzurufen, sobald es das Tier gefunden und gefilmt hat. Die Expedition durch den Dschungel führt den Helden durch verschiedene Etappen, an denen insgesamt fünf eigenständige Spiele gespielt werden können und wo das Kind Wissen, Gedächtnis oder Reaktion testen kann.Der gesamte Spielaufbau ist leicht verständlich und sollte besonders kleinen Dschungelforschern keine Probleme bereiten, da alle Funktionen auch laut vorgelesen und erklärt werden. Für ältere Kinder könnte das Spiel jedoch bald langweilig werden, da es wenig Raum für eigene Interaktionen schafft. Der festgelegte Weg bzw. die Vorgehensweise nach dem Prinzip einer Schnitzeljagd erschöpft sich schnell. Die integrierten, kleineren Spiele sind zwar nett gestaltet und als Abwechslung gedacht, bieten aber erfahreneren Computernutzern keine neuen Herausforderungen.
Das Computerspiel, das eher den passiven Charakter eines Hörspiels besitzt, ist Einsteigern und kleineren Kindern vorbehalten, dabei kann die englische Version, die zwar sicherlich zur Erweiterung des Vokabulars beiträgt, auch keinen größeren Anreiz bieten.Die Verbindung von Lernsoftware und Computerspiel ist leider nur zum Teil geglückt. Jüngere Spieler im Alter von 5 bis 8 Jahren werden aber mit Sicherheit ihren Spaß haben, den kleinen Joe und seinen Freund, den Affen, durch die Dschungelwelt zu begleiten und dabei neue Tierarten kennen zu lernen.
Beitrag aus Heft »2005/01: Kinder als Verbraucher«
Autor: Milena Chieffo
Beitrag als PDFEinzelansichtAndrea Breuer: Mathe mit Freddy
Freddy – Vampirisch gute Noten. Mathematik Klasse 1. Ernst Klett Grundschulverlag GmbH / Tivola Verlag GmbH. WIN 95 / 98 / ME / NT / 2000 / XP, Pentium 166, 29,90 €.
Freddy ist ein kleiner Vampir, der mit abwechslungsreichen Spielen hilft, Mathekenntnisse zu verbessern. Dazu wurde anhand des Lehrplans von Klasse 1 eine Vielzahl spannender Übungen erstellt. Freddy lebt, zusammen mit Bodo, der Fledermaus, auf Schloss Schädelrauch. Dort können insgesamt zehn Zimmer besichtigt werden. In jedem Zimmer wartet ein anderes Themengebiet der Mathematik: Rechnen am Zahlenstrahl, Geometrie, Rechnen mit Plus und Minus, Zahlen zerlegen und Kopfrechnen sind einige der Kategorien.
Zuerst hat man die Möglichkeit, das Themengebiet anhand sehr gut erklärter Übungen zu erproben. Wenn man sich dann fit genug fühlt, geht es ab zur Prüfung. Hier wird die Mühe auch belohnt.Denn wer in der Prüfung sehr gut abscheidet, der kann als Belohnung für die vorherigen Anstrengungen Spiele auf mehreren Levels spielen. Aber nur, wer alles richtig hat, darf drei Levels durchspielen.
Dieses Spiel ist schön aufgemacht, leicht verständlich und gut strukturiert. Es ist nicht nur ein kurzfristiger Zeitvertreib, sondern eine gute Möglichkeit, Spaß am Mathe Lernen zu bekommen!
Beitrag aus Heft »2005/01: Kinder als Verbraucher«
Autor: Andrea Breuer
Beitrag als PDFEinzelansichtMilena Chieffo: Vom Kinoerfolg zum Spiel
Lauras Stern. Win 98 / ME / 2000 / XP, MAC OS X 10.1.1 / G 3, Classic OS 8.6. Tivola Verlag GmbH, Vertrieb über www.tivola.de, 19,95 €.
Kürzlich erst ist Lauras Stern als Film in die Kinos gekommen, und schon gibt es das Computerspiel dazu (vgl. auch unser Thema in der vorderen Hälfte des Heftes). Zusammen mit Laura besucht man verschiedene Planeten, auf denen es immer etwas anderes zu entdecken gibt: Auf dem einen kann man Ausschnitte aus dem Film sehen, auf dem anderen wird eine genaue Bastelanleitung für eine Laterne gegeben.
Wieder auf anderen wird man zu Spielen herausgefordert, die entweder das musikalische Talent oder das Gedächtnis trainieren, dabei kann zwischen einer leichteren und anspruchsvolleren Schwierigkeitsstufe ausgewählt werden. Die Menüführung ist einfach, wird aber auch genauestens erklärt, so dass sich Kinder alleine zurechtfinden können. Die Spielgrafik ist dem animierten Zeichentrickfilm nachgeahmt und kommt bei Kindern sicher gut an.
Das Spiel ist nicht nur etwas für Lauras Stern- Fans, sondern bietet auch Abwechslung und Anregungen für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben.
Beitrag aus Heft »2005/01: Kinder als Verbraucher«
Autor: Milena Chieffo
Beitrag als PDFEinzelansichtAndrea Breuer: Spielen mit Heidi
Heidi – Deine Welt sind die Berge. Tivola Verlag GmbH, WIN 98 / ME / NT / 2000 / XP, Pentium II oder höher, 24,95 €.
Heidis Geschichte – ihr Leben auf der Alm bei ihrem Großvater, ihr Aufenthalt in Frankfurt bei Klara und ihre Rückkehr zum Großvater auf der Alm – wird mit vielen kleinen Spielen angereichert. Die grafisch sehr schön gestaltete Geschichte wurde in insgesamt 13 Szenen eingeteilt. In jeder Szene gibt es verschiedenes zu entdecken. Zur Abwechslung ist in jeder Szene ein Spiel hinterlegt. Bei dem Spiel kann man zwischen zwei Schwierigkeitsgraden wählen und sie können beliebig oft gespielt werden.
Ein besonderes Highlight: Die CD kann neben der deutschen Sprache auch auf Englisch und Französisch abgespielt werden.
Schon für die Kleinsten ab ca. 3 Jahren dürfte Heidis interaktive Geschichte Spaß machen, aber auch für die Größeren ist die CD-ROM aufgrund der verschiedenen Schwierigkeitsgrade durchaus empfehlenswert.
Beitrag aus Heft »2005/01: Kinder als Verbraucher«
Autor: Andrea Breuer
Beitrag als PDFEinzelansichtKathrin Demmler: Partyvorbereitungen
Pettersson & Findus – Der Torten werfende Geburtstagskater. Kiddinx Entertainment GmbH; Mac OS 8.6 / OS X 10.1 oder Windows 98 / NT 4.0 / XP, ca. 21 €
Der Kater Findus beschließt eines Morgens, dass heute ein Tag ist, um Geburtstag zu feiern. Nach anfänglichem Zögern findet auch Pettersson Gefallen an dieser Idee. Bis zum Fest haben die beiden aber noch jede Menge zu erledigen, denn zu einer richtigen Geburtstagsparty gehören schließlich eine Geburtstagstorte, Girlanden, bunte Luftschlangen und vieles mehr. Die Spieler können den beiden bei den Vorbereitungen zur Hand gehen. Beim Eierlaufen und Sackhüpfen, bei einer Tortenschlacht oder auf dem verwinkelten Wurzelpfad können Lakritzschnecken oder Kekse gewonnen werden. Damit kann dann in der Schnappmaschine nach Gegenständen gefischt werden, die nötig sind, um den Hof zu schmücken. Auch im Schuppen ist die Hilfe der Spielenden nötig, denn Petterson baut heimlich ein Geburtstagsgeschenk für Findus.
In der Bastelkiste können die Spieler dann Einladungs- und Tischkarten gestalten, die sie natürlich auch ausdrucken und für ihre eigene Geburtstagsfeier verwenden können. Die verschiedenen Aktivitäten fordern einen geschickten Umgang mit der Maus, trainieren das Reaktionsvermögen und fördern die Konzentration. Vor allem aber macht es viel Spaß, mit Petterson und Findus die liebevoll und detailliert ausgearbeitete Umgebung zu erkunden.
Selbst wenn alle Vorbereitungen für das Fest abgeschlossen sind, kann man immer wieder auf die einzelnen Spiele zurückgreifen, da jeder Spielende den Spielstand abspeichern und somit zu jedem Zeitpunkt in das Spiel zurückkehren kann.
Beitrag aus Heft »2005/01: Kinder als Verbraucher«
Autor: Kathrin Demmler
Beitrag als PDFEinzelansichtMilena Chieffo / Karin Ehler: Sachwissen zum Hören
Der Trend zum Hörbuch, der bei der Hörfassung von Romanen und anderen Gattungen der fiktionalen Literatur begonnen hat und dabei auch die Kinderbücher zum Hören geschaffen hat, ist einen Schritt weiter gegangen. Mittlerweile gibt es auch Sachbücher zum Hören. Viele von uns sind mit Büchern der Sachbuchreihe „Was ist was?“ aus dem Tessloff-Verlag groß geworden, die zu praktisch jedem Sachthema einen eigenen Band (mittlerweile 117) mit vielen Bildern und anspruchsvollen informativen Texten veröffentlichten. In Zeiten von Medienkonvergenz und Merchandising ist das nicht mehr genug, erfolgreiche Produkte werden auch via TV, Video, Kassette oder CD und am besten noch Game vermarktet (vgl. www.wasist was.de). Ob und wie es gelingt, Kindern und Jugendlichen Wissen ohne Bilder, die in Büchern und in der TV-Serie (auf Super RTL) ein so wichtige Rolle spielen, als reine Ton-Produktionen zu vermitteln, das soll hier untersucht werden.Was ist Was – Spinnen / Dinosaurier. CD. Universal Family Entertainment 2004, ab 6 Jahren, ca. 50 Min. Vertrieb über www.universalfamily.de ; 7,49 €
Um gleich beim Eingangsbeispiel zu bleiben: Von den 117 Bänden der Was ist Was?-Reihe sind mittlerweile achtzehn Themen auf Kassette und CD erschienen, jeweils zwei auf einem Tonträger, so dass also neun CDs auf dem Markt sind. Sie richten sich an Kinder ab 6 Jahren. Die Kombination der Themen ist nicht immer naheliegend (Dinosaurier und Spinnen), aber man bemüht sich im allgemeinen doch, in eine ähnliche Richtung zu gehen (Ritter und Burgen / Das alte Rom, Seeräuber / Schiffe). Theo, Tess und Quentin (ein Ausrufezeichen, ein Fragezeichen und ein Punkt) begleiten jedenfalls durch das Programm und erleben dabei immer wieder neue Geschichten. Im Dinosaurierkapitel zum Beispiel gräbt Theo den Garten um und findet dabei einen Knochen. Ob es sich dabei wohl um ein Dino-Skelett handelt? Ein Erzähler erklärt die wichtigsten Begriffe und beantwortet Fragen wie: Was haben Dinosaurier gefressen? Warum starben sie aus? Insgesamt eine gelungenes Hörspiel, das durch den Einsatz vieler Soundeffekte Spannung erzeugt und gleichzeitig durch Erzählblöcke informiert und durch dialogische Abschnitte zwischen den drei Protagonisten unterhält.Wieso? Weshalb? Warum? Alles über Dinosaurier. CD. Jumbo Neue Medien & Verlag GmbH 2004, ab 4 Jahren, ca. 55 Min. Vertrieb über www.jumbo-medien.de, 12,80 €
Eine andere erfolgreiche Buchreihe ist bei Ravensburger erschienen und richtet sich an jüngere Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter. Gemeint sind die Wieso? Weshalb? Warum?-Bücher, die Kindern mit vielen Klappen, Fenstern und Drehscheiben Einblicke in elementare Sachthemen und Lebensbereiche bieten. Von den über 20 Bilderbüchern wurden bei Jumbo nun die Themen „Alles über Dinosaurier“, „Technik bei uns zu Hause“, „Wir entdecken unseren Körper“, „Wir entdecken die Ritterburg“ und „Auf dem Bauernhof“ als Audio-CD produziert. Die Umsetzung der in Buchform so ansprechenden Themen (Klappen, Drehscheiben, Fühlbahnen für die Finger...) gelingt trotz der rein auditiven Übermittlung recht gut: Mit Hilfe von Hintergrundgeräuschen und geschickter sprachlicher Beschreibung, von Dialogen und einer anschaulichen Rahmengeschichte wird auch ohne Bilder deutlich, wie ein Kühlschrank funktioniert, ein Fachwerkhaus aussieht oder ein Dino gelebt hat. Dabei sind die Dialoge hier, im Gegensatz zu denen der Was ist was?-Reihe, ruhiger und erklärender und verzichten auf Spannung erzeugende Geräuschkulissen. Auch die Sachinformationen werden im Dialog vermittelt. Jeder Track klingt mit einem Musikstück aus, so dass die Informationen in Ruhe nachwirken können. Ob sich jedoch die jüngere anvisierte Zielgruppe ab 4 Jahren schon so lange – rund 55 Minuten – auf ein Thema konzentrieren kann, ist fraglich. Für ältere Kinder allerdings sind die CDs eine echte Bereicherung.1000 Themen: Was Kinder wissen wollen. Dinosaurier. CD. Universal Family Entertainment 2001, ab 5 Jahren, ca. 32 Min. Vertrieb über www.universalfamily.de; 7,49 €
Mehr wie in einer Märchenstunde geht es zu bei den CDs der Reihe 1000 Themen. Eine ruhige Frauenstimme erzählt mit geheimnisvollem Ton alles über Dinosaurier (oder Piraten, den Körper, Pflanzen oder ein anderes der insgesamt neun vertonten Themen), unterbrochen von Musikstücken, die in peppigem, rockigen Stil die Inhalte noch einmal aufgreifen. Die Lieder sind an aktuelle Pop-Stücke angelehnt, welche sie besonders eingängig und mitsingbar machen. Auf dialogische Elemente oder Soundeffekte verzichtet diese zwischen 2001 und 2003 produzierte Reihe mit neun CDs vollständig, trotzdem werden besonders jüngere Kinder durch die einfache Vermittlung der Inhalte und die Mischung von Erzählungen und Liedern profitieren können.Ulrich Janßen und Ulla Steuernagel: Die Kinder – Uni. Warum bin ich Ich? und Warum fallen die Sterne nicht vom Himmelt? CD, 2004, Hörverlag, 14,95 €
Um eher abstrakte oder philosophische Themen geht es bei den Audio-CDs aus der Reihe der Kinderuni-Vertonungen (vgl. auch Beitrag auf S. 3f. in merz 5-04). Sie richten sich an ältere Kinder (das empfohlene Alter ab 6 scheint manchmal noch zu jung) und geben Erläuterungen zu philosophischen Fragen, die Kinder beschäftigen (Warum bin ich Ich?, Warum dürfen die Erwachsenen mehr als Kinder?, Warum gibt es Arme und Reiche?) oder auch zu naturwissenschaftlichen Gebieten, die sie interessieren, etwa Warum speien Vulkane Feuer?Entstanden sind die CDs aus speziellen Kinder-Vorlesungen an der Universität Tübingen, die ab 2002 gehalten wurden. Auf Basis dieser Vorträge haben die Journalisten Ulrich Janßen und Ulla Steuernagel ein Buch herausgegeben, das wiederum die Grundlage bildet für die Hör-Produktionen. Neun CDs sind mittlerweile erschienen, auf denen jeweils zwei Vorlesungen Platz finden. Regelmäßig stellen Kinder Fragen, auf die vom Sprecher Ulrich Noethen (bzw. bei früheren Produktionen Rufus Beck) ohne szenische Hintergrundgeräusche in halb dialogischer, halb vortragender Form Antworten gesucht werden. Der Sprecher geht dabei immer auch auf alle Hintergründe ein, Begriffserklärungen und der Einbezug mehrerer Sichtweisen werden in die Antwort gepackt. Die Vorlesungen werden an mehreren Stellen mit Musik untermalt.Diese CD ist ein anspruchsvolles Hörerlebnis, das Kinder und Erwachsene mit vielen Informationen gerade auch zu ungewöhnlichen Themen versorgt.
Beitrag aus Heft »2005/01: Kinder als Verbraucher«
Autor: Karin Ehler, Milena Chieffo
Beitrag als PDFEinzelansicht
Zurück