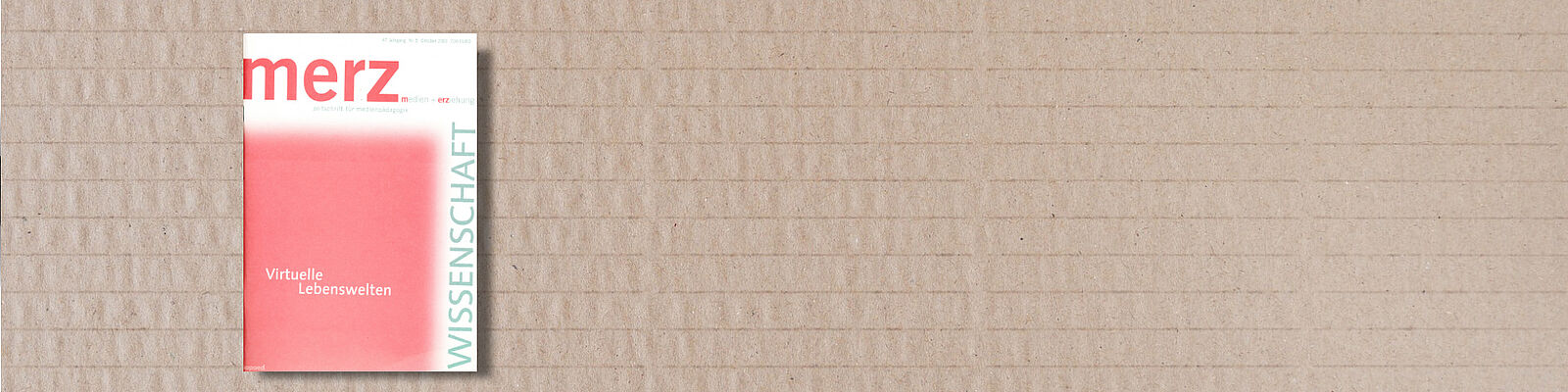2003/05: Virtuelle Lebenswelten
thema
Helga Theunert und Susanne Eggert: Virtuelle Lebenswelten
Der einführende Beitrag setzt sich damit auseinander, welche Rolle virtuelle Erfahrungswelten in der Lebenswelt von Individuen spielen. Die Möglichkeit der interaktiven Nutzung und die Realitätsnähe der virtuellen Welten werfen die Frage auf, ob diese Alternativen zur Realität darstellen können. Anonymität, Identitätsspiele und die damit verbundenen möglichen Grenzüberschreitungen und Tabubrüche machen den Reiz der Fantasiewelten aus. Je nachdem, wie sehr sich ein Individuum auf die virtuellen Angebote einlässt, kann dies zur Reflexion des eigenen Selbst, aber auch zu Risiken für das Individuum in seiner realen Lebenswelt führen. Für die Medienpädagogik gilt es, das Bewusstsein für die Unterscheidung realer und virtueller Welten zu schärfen und Konzepte für eine sichere und gewinnbringende Nutzung virtueller Räume zu erstellen.Der Artikel schließt mit einer Kurzdarstellung der folgenden Beiträge.
This introductory article discusses the role of virtual spaces for the everyday life of individuals: Do interactive and lifelike virtual worlds offer alternative realities? What makes imaginary worlds attractive, is the opportunity of being anonymous, of faking one’s identity and – related to that – of crossing borders and breaking taboos. Depending on how much the individual gets involved in virtual spaces, this involvement can lead to self-reflection, but also to problems concerning the handling of everyday reality. The task of media education is to make people aware of the differences between real and virtual worlds and to provide concepts for using virtual spaces in a safe and successful way.The article closes with an abstract of the following essays.
Beitrag aus Heft »2003/05: Virtuelle Lebenswelten«
Autor: Helga Theunert, Susanne Eggert
Beitrag als PDFEinzelansichtRegina Decker / Christine Feil: Grenzen der Internetnutzung bei Kindern
Der Beitrag stellt erste Ergebnisse aus dem Projekt „Wie entdecken Kinder das Internet?“ vor, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und am Deutschen Jugendinstitut München durchgeführt wird. Das Projekt zielt darauf, den Begriff Internetkompetenz im Alter zwischen 5 und 12 Jahren zu konkretisieren und aus dem kinderspezifischen Internetumgang Ansatzpunkte für ein alltagsbezogenes medienpädagogisches Handeln abzuleiten. Auf der Grundlage von technikgestützten teilnehmenden Beobachtungen werden die Schwierigkeiten der Kinder im Umgang mit dem Internet herausgegriffen und beschrieben. Die medienpädagogischen Ansprüche an ein Netz, das der Information und dem Lernen dient, werden allerdings durch den Internetgebrauch der Kinder relativiert.
The article presents first results of the project „How do children discover the internet?“, which is supported by the Bundesministerium für Bildung und Forschung (Ministry of Education and Research) and which was carried out by the Deutsches Jugendinstitut München. The project aimed at clarifying the term „internet literacy“ of children aged 5 to 12. Furthermore, the goal was to receive a starting point for new concepts of media education, taking into consideration the special way in which children deal with the internet. On the basis of technically supported participating observations difficulties of children using the internet are characterised. But the media educational demands, required of an internet that serves information and learning, are qualified by the children’s use of the internet.
Beitrag aus Heft »2003/05: Virtuelle Lebenswelten«
Autor: Christine Feil, Regina Decker
Beitrag als PDFEinzelansichtBirgitte Holm Sørensen: If spare time didn’t exist –
In diesem Aufsatz wird mithilfe der Spieltheorie das Interesse älterer Kinder an virtuellen Welten (Chat, Online-Spiele und Communities) analysiert, um zu einem Verständnis für die Bedeutung dieser Aktivitäten im Alltag der Kinder zu kommen. Viele ältere Kinder leben sowohl in realen als auch in virtuellen Welten: Sie lernen, virtuelle Räume durch Lernprozesse zu nutzen, die außerhalb der Schule und die innerhalb ihrer eigenen Welt stattfinden. Wenn Kinder virtuelle Welten nutzen, erlernen sie Kompetenzen, die sie für ihre Bewegung in und ihre Nutzung von virtuellen Räumen benötigen: zur Kommunikation, um soziale Beziehungen zu knüpfen und aufrecht zu erhalten, zur Teilnahme an und Einrichtung von virtuellen Gemeinschaften. Diese dort erlernten Kompetenzen sind nicht nur für das aktuelle Interesse der Heranwachsenden an virtuellen Welten von Bedeutung, sondern die hier erlangten Fähigkeiten sind Grundkompetenzen, die für ihre weitere (Aus-)Bildung und ihren Berufsweg von Nutzen sein können.
This article will apply a play perspective to the interest of older children in the use of virtual spaces for chat, online games and communities in order to come to an understanding of the significance of these activities in children’s everyday lives. Many older children have lives in both physical and virtual spaces, and they learn to use virtual spaces and function in them by means of off-school learning processes, which are related to their own culture. In their use of virtual spaces they acquire competences related to their virtual behaviour and praxis, in which communication, the establishment and maintenance of social relations, the participation in and last not least the construction of communities have importance for their future education and work.
Beitrag aus Heft »2003/05: Virtuelle Lebenswelten«
Autor: Birgitte Holm Sørensen
Beitrag als PDFEinzelansichtDagmar Hoffmann / Thomas Münch: Mediale Aneignungsprozesse im Netz
Die im Folgenden vorgestellte Studie beschäftigt sich mit der geschlechtsspezifischen Nutzung des Internet im mittleren bis späten Jugendalter. Es soll herausgefunden werden, inwieweit die Internetnutzung in den jugendlichen Alltag integriert ist. Ein Vergleich von Internet-Intensivnutzern mit Radio- und Musik-TV-Intensivnutzern verdeutlicht, dass Internet-Intensivnutzer andere Medienpräferenzen haben als Jugendliche, die primär auditive bzw. audio-visuelle Medien favorisieren. Anhand der Daten der DFG-Studie „Jugendsozialisation und Medien: Zur Entwicklungsfunktionalität der Medienaneignung im Jugendalter am Beispiel Hörfunk, Musikfernsehen und Internet“ sollen die geschlechtsspezifischen Motive der Onlinenutzung und die besonderen Themeninteressen der Internet-Intensivnutzer bestimmt werden. Ziel ist es, die Bedeutsamkeit der Internetnutzung im jugendlichen Alltag herauszuarbeiten und die individuellen Nutzen- und Gratifikationsaspekte für die Heranwachsenden zu identifizieren.
The purpose of the following study is to examine the gender specific use of the internet in adolescence. We first resume the context in which internet is being used in every day life and compare the general media preferences of a heavy internet user group with a group of heavy radio and Music-TV users. In brief we describe the study “Youth socialisation and media: On the developmental functionality of media appropriation in adolescence with a focus on radio, music television and internet use“. We try to analyse the particular reasons for adolescents to be online and determine the gender specific interests of the heavy internet user group. In conducting this study our goal was to establish the relevance of internet use in adolescent everyday life. We wanted to find out whether the internet could stimulate the ability and creativity of young men and women.
Beitrag aus Heft »2003/05: Virtuelle Lebenswelten«
Autor: Thomas Münch, Dagmar Hoffmann
Beitrag als PDFEinzelansichtTanja Witting / Heike Esser: Wie Spieler sich zu virtuellen Spielwelten in Beziehung setzen
Eine Untersuchung an der Fachhochschule Köln mit 80 ComputerspielerInnen im Alter von 16 bis 37 Jahren hat gezeigt, dass es Spielern möglich ist, sehr persönliche und individuelle Anknüpfungspunkte zu virtuellen Spielwelten herzustellen. Diese Anknüpfungspunkte beeinflussen entscheidend, wie ein Spiel erlebt wird und welche „Wirkkraft“ Spielinhalte entfalten können. Insbesondere in Hinblick auf mögliche Verstärkungseffekte in Bezug auf Einstellungen, Menschen- und Weltbilder ist die Anschlussfähigkeit der Spielinhalte an bereits vorhandene Erfahrungen und Ansichten als ausschlaggebend anzusehen.
A survey conducted at the University of Applied Sciences Cologne/Germany (‚Fachhochschule Koeln’) with female and male computer game players between 16 and 37 has shown that the players are able to make a very personal and individual link with virtual game worlds. These links have a decisive influence on how the players conceive a game and on how strong the impact of the game’s contents may be. The links of the game’s contents to experiences already made as well as opinions, can be seen as crucial especially as regards possible intensifying effects regarding opinions as well as views of man and of the world.
Beitrag aus Heft »2003/05: Virtuelle Lebenswelten«
Autor: Tanja Witting, Heike Esser
Beitrag als PDFEinzelansichtWaldemar Vogelgesang: LAN-Partys: Jugendkulturelle Erlebnisräume zwischen Off- und Online
Vernetzbare Computerspiele werden für Jugendliche verstärkt zum Anknüpfungspunkt für unterschiedliche Gesellungsformen, Aneigungsweisen und Distinktionsinteressen. Ob im privaten Rahmen zu Hause oder auf professionell organisierten Großveranstaltungen, die „generation kick.de“ (Farin) hat einen wahren LAN-Boom (LAN=Local Area Network) ausgelöst. Die Gruppe wird für die Jugendlichen dabei zu einer Art Wissensdrehscheibe und Sozialisationsagentur in Computer- und Netzfragen, wobei Strategien des Selbermachens und der ständigen Marktbeobachtung eine wichtige Rolle spielen. Hinzu kommt, dass gerade die größeren LAN-Partys und LAN-Events regelrecht zu Showbühnen der Spezialisierungs- und Kompetenzinszenierung werden.
Network computer games are getting more and more focal concerns for different forms of communities, receptions and distinctions. Whether it is privately or professionally organized, the ‚generation kick.de’ has triggered off a real LAN-boom. The group represents a knowledge mediation and a socialisation agency for computer and internet activities, where do-it-yourself-strategies and permanent market studies are of great importance. Moreover, the big LAN-parties and LAN-events transform into stages of specialisation and performance.
Tanja Schatz: Die individuelle Funktion des Chattens bei Jugendlichen
Der Artikel stellt die Befunde einer Studie zum Chatverhalten Jugendlicher vor, für die 178 Gymnasiasten befragt wurden. Neben einer kurzen Beschreibung der medialen Ausstattung der Schüler wird der Existenz altersspezifischer Nutzungsweisen sowie der Bestimmung von protektiven wie Risiko-Faktoren der individuellen Chat-Nutzung nachgegangen. Entsprechende Merkmale finden sich dabei sowohl auf der Ebene des sozialen Umfeldes der Jugendlichen wie auch auf jener der subjektiven Einstellungen und Überzeugungen. Unabhängig von diesen spezifischen Einflussfaktoren lässt sich bei Jugendlichen eine allgemeine Chat-Nutzung beobachten, die der Bewältigung altersspezifischer Entwicklungsaufgaben dient und sich damit von der bislang identifizierten Nutzung junger Erwachsener unterscheidet.
The article presents the results of a study concerning the chat behaviour of young persons, 178 Grammar school pupils were questioned for this study. Apart from a short description of the media equipment of the pupils the study inquires the existence of age-specific methods of use and the determination of protective factors and risk factors of the individual use of chat rooms. Corresponding features are found both in the social environment of the pubescents and on the level of subjective attitudes and beliefs. Not dependent on these specific influencing factors it is obvious that young persons use chat rooms to cope with age-specific development tasks which differ from the use of the internet known by this time.
Harald Marburger: CMC – Die digitale Identitätsdroge?
Der Artikel stellt die Befunde zur „Internetsucht“ grundsätzlich in Frage. Im Zentrum der explorativ-deskriptiven Untersuchung von synchronen CMC-Angeboten (Chat, MUD, MOO etc.), verbunden mit Einzelfallanalysen ihrer Nutzer, stehen „Vielnutzer“ von Chat- und MUD (Multi-User-Dungeons)-Angeboten, deren Nutzungsverhalten deviante Züge aufweist. Ihre Nutzungsmotive sowie die Angebote selbst werden unter dem Fokus postmoderner Identitätstheorien, insbesondere der „Patchwork-Identität“ von Heiner Keupp, untersucht. Dabei werden Zusammenhänge zwischen CMC-Nutzung und Identitätsprozessen aufgedeckt, sowie Hypothesen entwickelt, die das Verhalten der Subjekte als Produkt normaler Identitätsarbeit fassbar machen. Es wird dabei in Ansätzen die Theorie der „dominanten, virtuellen Teilidentität“ skizziert, die durch die begleitenden Einzelfallanalysen gestützt wird.
This article questions in principle the statements to ‚Internet Addiction’. It contains an explorative-descriptive investigation of synchronous CMC-offers (Chat, MUD, MOOS etc.), related with the individual case analysis of their users. It is basically about the behaviour of ‚Much-Users’ of Chat and MUD (Multi User Dungeon)-offers, whose user behaviour exhibits deviant symptoms. Their motives for usage, as well as the offers themselves, are examined under the focus of post-modern identity theories, in particular the ‚Patchwork Identity’ from Heiner Keupp. Relations between CMC-usage and identity processes are analyzed, and hypotheses are developed, which make the behaviour of the test persons comprehensible as a product of normal identity building work. The author outlines as well the theory of the ‚dominant, virtual partial identity’, which is supported by the accompanying individual case analysis.
Nicola Döring / Sandra Pöschl: Wissenskommunikation in themenbezogenen Online-Chats
Der Beitrag präsentiert eine Mehrmethoden-Studie zur Wissenskommunikation in Online-Chats. Für die drei untersuchten themenbezogenen IRC-Channels #html (Undernet), #HTML (Efnet) und #linuxger (IRCnet) können zahlreiche Details der Wissenskommunikation beschrieben werden. Es zeigte sich, dass in den betrachteten Chats etwa zwei Drittel der eingebrachten Probleme in kurzer Zeit gelöst wurden. Die Betrachtung themenbezogener Chat-Räume relativiert das einseitige Bild von der rein geselligen und unterhaltsamen Chat-Kommunikation und illustriert, dass Chats keineswegs automatisch außeralltägliche Wirklichkeitsbereiche darstellen, sondern auch feste Bestandteile der alltäglichen Lebenswelt sein können.
This article presents a multi-method study on knowledge communication in online chats. For the three investigated on-topic IRC channels #html (Undernet), #HTML (Efnet) and #linuxger (IRCnet) different details of the knowledge communication process are described. It turned out, that two thirds of the discussed problems could be resolved quickly via online chat. The investigation of on-topic online chats puts into perspective the one-sided image of a purely sociable and amusing chat communication. The study demonstrates that online chats are not automatically part of an alien virtual life, but that users can appropriate them as elements of their everyday real life.
Beitrag aus Heft »2003/05: Virtuelle Lebenswelten«
Autor: Nicola Döring, Sandra Pöschl
Beitrag als PDFEinzelansichtSandra Winkel / Gunter Groen / Hans-Christian Waldmann / Franz Petermann: Suizidforen im Internet
So genannte Suizidforen im Internet sind in den letzten Monaten zunehmend in den Blickpunkt der öffentlichen Diskussion gerückt. In den Medien und auch in Stellungnahmen von Experten wird häufig vor allem auf die möglichen Gefahren von Suizidforen abgehoben. Diese bestünden unter anderem in einer gegenseitigen Stimulation zum Suizid oder im Austausch von „zuverlässigen“ Methoden zur Selbsttötung. Die Nutzerinnen und Nutzer der Internetforen scheinen in diesen besonderen virtuellen Räumen jedoch oft weit mehr zu finden. Wissenschaftliche Untersuchungen zur Nutzung der Foren und den möglichen Auswirkungen, insbesondere aus Sicht der Nutzer, sind bis heute äußerst rar.
So-called suicide forums (chat-rooms, newsgroups) have received increasing attention amongst social scientists. While media reports and expert statements focus on respective risks like unbound dissemination of suicide methods or a potential reduction in thresholds to actually make use of them, it becomes evident that forum participants also draw approvable benefits from these services. Scientific studies addressing the issue of the actual impact of forum communications from a users’ perspective, however, are still rare.
Beitrag aus Heft »2003/05: Virtuelle Lebenswelten«
Autor: Hans-Christian Waldmann, Gunther Groen, Sandra Winkel
Beitrag als PDFEinzelansicht
Ansprechperson
Kati StruckmeyerVerantwortliche Redakteurin
kati.struckmeyer@jff.de
+49 89 68 989 120
Ausgabe bei kopaed bestellen
Zurück