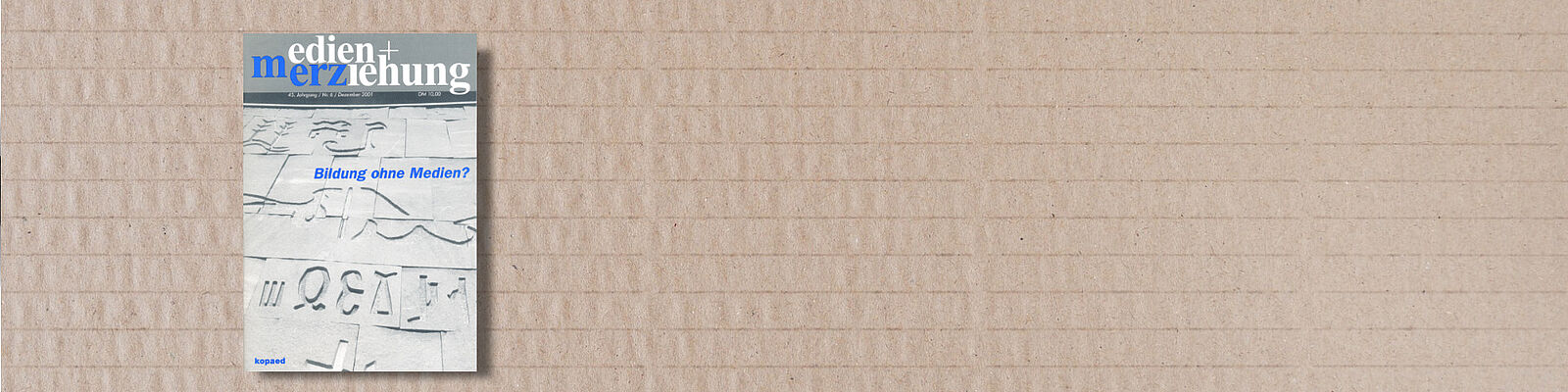2001/06: Bildung ohne Medien
aktuell
Susanne Eggert: Vergessen werden wir die Eindrücke nicht so schnell
Etwas ist anders und zwar nicht nur, was die 'Ausmaße' der Terroanschläge am 11.September 2001 betrifft. Auch die Art, wie die Medien sich mit den Ereignissen auseinadnergesetzt haben, bzw. dies immer noch tun, ist in vielerlei Hinsicht nicht vergleichbar mit ähnlichen Situationen in der Vergangenheit. "Ähnliche Situationen", damit sind zum Beispiel Katastrophen wie das Erdbeben in der Türkei im vergangenen Jahr gemeint, bei dem Zigtausende von Menschen ums Leben kamen und Hunderttausende über Nacht kein festes Dach über dem Kopf mehr hatten und plötzlich von Seuchen bedroht waren, die man längst unter Kontrolle zu haben glaubte. Und es damit kriegerische Auseinandersetzungen wie in Ex-Jugoslawien oder der Golfkrieg gemeint.Einige Punkte, die aus medienpädagogischem Blickwinkel überdenkenswert sind:- Am auffälligsten war wohl die Totalität der Berichterstattung über mehere Tage hinweg. Im Fernsehen folgte eine Sondersendung der anderen. Unterhaltungsprogramme, die sonst als Institutionen gelten, an denen niemand rütteln möchte, wie die "Harald-Schmidt-Show", wurden ausgesetzt. Der Strom an Interviews mit Experten, Betroffenen und Hilfskräften in Fernsehen und Radio riss nicht ab, und auch die zeitungen und das Internet lannten kein anderes Thema mehr.
Selbst wenn man es gewollt hätte, gab es keine Möglichkeit, der Informationsflut zu entkommen - auch nicht für Kinder.- Zum ersten Mal erlebten die Zuschauer vor dem Bildschirm eine reale Katastrophe 'live'. Live-Berichterstattung von Katastrophenorten hat es auch schon früher gegeben, sei es aus Überschwemmungs- oder Erdbebengebieten, sei es von Kriegsschauplätzen, an denen gefallene Angehörige beklagt wurden. Doch es waren immer die Folgen eines Geschehens, mit denen man konfrontiert wurde, niemals aber das Ereignis selbst. Diesmal waren wir von Anfang an dabei. Und die Bilder von den Flugzeugen, die in die Gedächtnisse eingebrannt. Ist das ein Grund dafür, dass das Entsetzen so groß war?- Rund um die Uhr bis spät in die Nacht gingen am 11- September immer wieder die gleichen Bilder von den einstürzenden Türmen des World Trade Centers sowie von Menschen, die voll Angst und Schrecken um ihr Leben liefen, über den Bildschrim. Im Vordergrund versuchten Journalisten Erklärugen für das, was geschehen war, abzuliefern, Meinungen dazu, was nun zu tun sei, einzufangen, im Hintergrund aber immer wieder dieselben Aufnahmen. Fragen drängen sich auf: Welchen Grund hatte es, dass diese Bilder immer wieder gezeigt wurden? Lag es daran, dass keine anderen passenden Bilder verfügbar waren oder steckte eine andere Überlegung dahinter? Welche Reaktionen wurden damit bei den Zuschauerinnen und Zuschauern vor den Bildschirmen ausgelöst? So viel ist sicher: Vergessen werden wir diese Eidrücke ihct so schnell.- Sehr schnell nach den Anschlägen wurde in den Medien die Frage laut, wie wohl Kinder mit dem Geschehen umgehen und wie man sie bei der Verarbeitung dieser Informationen unterstützen könnte.
Im Gegensatz zu früheren Ereignissen bestand kein Zweifel daran, dass sie mitbekommen hatten, was geschehen war, und dass dies Ängste und Unsicherheiten bei ihnen auslösen musste, mit denen sie nicht allein gelassen werden durften. Damit zeigten die Medien ihrem jüngsten Publikum gegenüber eine Sensibilität, wie das bisher nicht der Fall war.- Ohne lange zu zögern, nahmen sich manche Programmanbieter auch ihrer heranwachsenden Zuschauer an. Am schnellsten reagierte der KI.KA. Mit klaren Worten und ohne das Grauen durch unnötiges Bildmaterial oder spekulative Kommentare zu strapazieren, wurde erklärt, was geschehen war. Es wurden Experten hinzugezogen, wo dies sinnvoll war, den Kindern wurden Räume zum Reden und zum Austausch geöffnet, es wurde eine Hotline eingerichtet und auf den Internetseiten des KI.KA gab es die Möglichkeit, seine Überlegungen, Fragen und Ängste per E-mail loszuwerden. Die Angebote wurden von den Kindern angenommen. Aber der KI.KA war nicht der einzige Sender, der mit seinem Programm auf die Kinder und Jugendlichen reagierte. Als Beispiel soll noch VIVA genannt werden, denn dort wurde ganz abgeschaltet und wenige Tage später mit dem Publikum darüber diskutiert, wie man weitermachen soll.
Der 11. September liegt nun schon einige Wochen zurück, und der erste Schrecken hat sich gelegt. Aber es grassiert immer noch eine diffuse Angst, denn mit den Terroranschöägen allein ist es ja nicht vorbei. Die militärischen Vergeltungsschläge in Afghanistan mit allen Begleiterscheinungen eines Krieges, die Anschläge mit Milzbrandregen, die Aktivitäten unzähliger Trittbrettfahrer bestimen die Nachrichten. Für medienpädagogisches Denken und hendeln bedeutet das, dass es an der Zeit ist, sich wieder einmal intensiv mit der Medienberichterstattung auseinander zu setzen. Zwei Aspekte sind dabei von besonderer Relevanz:- Der Aspekt der Analyse. Anlässe hierfür sind z.B. die penetrante Wiederholung von TV-Bildern, teilweise unangemessen als Kunstobjekte verfremdet, oder die Hysterie und Angstmacherei durch die Medien.- Der Aspekt, wie Kinder und Jugendliche mit derartigen Informationen umgehen und wie sie dabei sinnvoll unterstützt werden können.
thema
Jürgen Oelkers: Bildung ist ein ständiges Abenteuer
Beschleunigung als Erfolg?
Statt von Bildung wird heute von Qualifikation gesprochen. Der Ausdruck "Bildung" ist gleichermassen unklar und unerreichbar, "Qualifikation" dagegen erscheint als die handfeste und erreichbare Grösse. Dieser semantische Austausch ist ein untrügliches Zeichen für eine Abwertung und so für eine Krise, die so recht niemand bemerkt, weil ständig Umbau betrieben wird. Dabei ist nicht die Arbeitsmarktorientierung entscheidend, auch humanistische Studien sind immer im Blick auf Berufe betrieben worden (Grafton / Jardine 1986 ) und die Humboldtsche Universität hat nie auf die Ausbildung für akademische Berufe verzichtet; es ist auch nicht einfach der Nierdergang der Bildung im Allgemeinen, da sich die Bildungsanstrengungen im Staat und Gesellschaft vervielfacht, sind Erwartungen der Kurzzeitigkeit und der didaktischen Erleichterung, die darauf ausgerichtet sind, Lernen zu beschleunigen und so erfolsfähig zu halten.
Die lange Anstrengung und der späte Effekt, das Unberechenbare der Bildung, sind in Misskredit geraten, ich könnte auch sagen, in einer Gesellschaft, die nach Zielgruppen aufgeteilt wird, sind diffuse allgemeine Anstrengungen kaum sehr lohnend. Nicht zufällig wird Leben nicht mehr mit Bildung, sondern mit "lebenslangem Lernen2 zusammengebracht, ohne dass es sich um einen Pleonasmus handeln würde. "Lebenslanges Lernen2 bezieht sich auf nützliche Qualifizierungsportionen, nicht auf Horizonte des Verstehens und so fortlaufende Anstrengungen, die Bildung letzlich ausmachen (Oelkers 1986). "leben" wird verstanden als ständige Qualifizierungsleistung, die sozusagen jede Lücke mit Lernen ausfüllt, während "Bildung" als relative überflüssige Ästhetisierung erscheinen kann, die sich dem Nutzenkalkül entzieht...
( merz 2001/06, S. 357 - 363 )
Horst Dichanz: Aufgaben des Bildungsfernsehens in einem neu vermessenen Bildungsmarkt
Zwei Vorbemerkungen zum Thema sind erforderlich:- Der Begriff Bildungsfernsehen ist auch nach über dreissigjähriger Diskussion in Deutschland nicht klarer geworden. In meinen Überlegungen beziehe ich ihn auf Programmangebote öffentlich-rechtlicher und privater Fernsehanbieter, in denen der intentionale Lerncharakter andere Programmziele wie z.B. Information oder Unterhaltung deutlich überwiegt.- Im Unterschied zu einer Bildungsszene, auf der über Jahrzehnte ein öffentliches und nur zum geringen Teil ein privates Bildungsangebot den Bildungssektor prägte, hat sich im Gefolge der Vermehrung der Frequenzen und der Einbeziehung neuer Medien ein offener Bildungsmarkt entwickelt, der von der betriebsinternen Weiterbildung bis zu weltweit angebotenen Bildungsprogrammen kaum noch überschaubare multimediale Lehr-Lern-Angebote anbietet, die realtiv unabhängig von Zeit und Ort von Individuen, Lerngruppen oder Institutionen gegen Gebühren abgerufen undgenutzt werden können.
Bildungsprogramme der verschiedensten Art sind zu einer Ware geworden, dren Charakter und Preis sich immer mehr nach Angebot und Nachfrage richtet. Zahlreiche Indizien (s.u.) belegen die Existenz eines Bildungsmarktes, der nach ähnlichen Gesetzen funktioniert wie andere Warenmärkte.Zur Entwicklung des BildungsfernsehensFragen nach der Bedeutung des Fernsehens für den Bildungssektor und Möglichkeiten der Entwicklung von fernsehgestützten Bildungsprogrammen oder gar eines Bildungsfernsehens (im folgenden: BFS ) begleiten das Fernsehn seit seinem massenhaften Einsatz. Schulfunk- und Schulfernsehsendungen waren wichtige Vorläufer für regelmäßige Bildungsprogramme. Funkkollegs und Telekollegs stehen für langfristige erfolgreiche Modelle rundfunkgestützer Bildungsprogramme, öffentliche und private Teleakademien wurden und werden im In- und Ausland erprobt. Die Idee von Teleuniversitäten geistert in regelmäßigen Abständen durch die bildungspolitischen Diskussionen, die Open University (Groß Britanien) und die Fernuniversität sind nur zwei Beispiele, in denen die Neuen Technologien für unterschiedlichste Bildungszwecke genutzt werden und z.T. grosse Publika erreichen...
( merz 2001/06, S. 364 - 370 )
Thomas Gruber: "Man muss die Menschen da abholen, wo sie sind"
Seitdem Günther Jauch mit seinem Quiz "Wer wird Millionär" regelmäßig Quotensieger wird und ein Universitätsprofessor, also ein Vertreter des klassischen Bildungsbürgertums, als erster die ausgelobte Million gewinnen Konnte, erlebt das Thema 2Bildung in den Massenmendien" eie Renaissance. Dabei ist diese Thema alles andere als neu.Bildung war bereits Ende der 40er Jahre ein Thema, als in Deutschland die Gesetze zur Einrichtung öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten verabschiedet wurden. Im Bayerischen Rundfunkgesetz, das am 1.Oktober 1948 in Kraft getreten ist, wird der Programmauftrag wie folgt definiert: "Die Sendungen des Bayerischen Rundfunks dienen der Bildung, Unterrichtung und unterhaltung.
" Wollte man die Reihenfolge der Aufzählung nicht als Willkür-, sondern als bewussten Willensakt verstehen, wäre Bildung der erste und auch der vornehmste Auftrag des Bayerischen Rundfunks.Bildungsangebote im Fernshen gehörten von Anfang an zum Programmauftrag der öffentlich-rechtlichen Anstalten. Vor allem seit Mitte der sechziger Jahre, als Politiker und Soziologen eine "Bildungskatastrophe" fürchteten und die "Demokratisierung der Bildung" forderten, stiegen die Erwartungen an den Bildungsauftrag des Fernsehens. Als erster ARD-Sender reagierte der Bayerische Rundfunk: Als "Schule der Gesellschat" apostrophiert, gründete der BR 1964 ein drittes Fernsehprogramm, das ausdrücklich als "Studienprogramm" genutzt werden sollte.
Die anderen ARD-Sender und auch das ZDf folgten dem Beispiel - wenn auch Jahre später. Zunächst schien Zweckgemeinschaft Fernsehen und Bildung zu funktionieren. Zuversichtlich hieß es 1969 in einem Thesehnpapier des WDR: Fernsehen müsse "stärker und verbindlicher in den Ausbildungsprozess" einbezogen werden, da "traditionelle Institutionen der Bildung und Ausbildung nicht immer flexibel genug sind, sich der voranschreitenden Entwicklung anzupassen." Doch die Akzeptanz dieser Kurse nahm stetig ab, und auch die sozialen Erwartungen wurden enttäuscht...
( merz 2001/06, S. 371 - 377 )
Burkhard Thiele: Die Bildungstheorie der Europäischen Gemeinschaft
Die Bildungsaktivitäten der Europäischen GemeinschaftEs sind in erster Linie wohl die schildernden Namen wie ERASMUS, LINGUA, COMETT, SOKRATES oder LEONARDO DA VINCI, die in den nationalen Öffentlichkeiten Europas mit den Bildungsaktivitäten der EG in Verbindung gebracht werden. Dies ist nicht überrschen, da sich seit Mitte der achtziger Jahre mehrere hunderttausend Studenten und DOzenten aller Mitgliedstaaten an diesen Aktionsprogrammen beteiligten. Allein in der ersten Phase des SOKRATES-Programms, das sich vom 1. Januar 1995 bis zum 31. Dezember 1999 erstreckte, beteiligten sich nahezu 275.000 Unionsbürger. Es handelte sich hierbei vor allem um Schüler, Auszubildende, Studenten, Professoren, Schulleiter, Lehrer und Entscheidungsträger des Bildungssektors, deren Auslandsaufenthalte in einem anderen EG-Staat mit Gemeinschaftsmitteln gefördert wurde.
Darüber hinaus wurden im Rahmen des Programms rund 1500 Universitäten, 8500 Schulen und 500 transnationale Projekte unterstützt, vor allem zur Entwicklung und zur Verbesserung der Unterrichtsqualität in Schulen und Hochschulen. Um die gesetzten Ziele des Programms erfolgreich zu verwirklichen wurde SOKRATES I mit 920 Millionen ECU (!) ausgestattet. Dies war der höchsteBetrag, der jemals für ein Bildungsprogramm der EG bereitgestellt wurde. Da aber ein Großteil der Projekte wegen des immens großen Andrangs nur mangelhaft gefördert werden konnte, wurde für die zweite Phase des SOKRATES-Programms nunmehr die astronomische Summe von 1.850 Millionen EUR für den Zeitraum vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2006 bereitgestellt. Es zeichnet sich aber bereits jetzt ab, dassauch dieser Betrag den enormen Bedarf nach Förderleistungen nur unzureichend decken kann. Angesichts der größer werdenden Nachfrage ist eine weiter Aufstockung der Mittel auch aus sozialen Gründen dringend erforderlich...
( merz 2001/06, S. 378 - 383 )
spektrum
Jürgen Hüther: Johann Amos Comenius/ Jan Amos Komenský (1592 - 1670)
Das Buch verändert die KommunikationVersuche, den Gegenstands- und Aufgabenbereich der Medienpädagogik zu systematisieren, haben zu der "klassischen2 Zweiteilung der Medienpädagogik in Mediendidaktik und Medienerziehung geführt, die auf eine viel zitierte, mittlerweile selbst historische Formel von Kösel/Brunner (1970) zurückgeht. Danach befasst sich Medienpädagogik mit allen unterrichtsrelevanten Fragen der Medienverwendung im Schul- und Ausbildungsbereich (Erziehung durch Medien) und mit der Kompetenzvermittlung zur Bewältigung des Medienalltags (Erziehung durch Medien).
Gegenstände der Medienpädagogik sind demnach Bildungsmedien sowie Informations- und Unterhaltungsmedien gleichermaßen, wobei der Beschäftigung mit den Medien als didaktische Insttrumente sicher die längere Tradition zukommt, denn die Geschichte der Bildungsmedien ist in ihrer zeitlichen Dimension weitgehend identisch mit der des Unterrichtens selbst, da die technischen Hilfsmittel zur Verbesserung der Alltagskommunikation immer schon nach ihrem Aufkommen bald auch zu Zwecken der Belehrung und des Unterrichtens genutzt werden.
Das gilt für die heutigen Medien Film, Fernsehen, und Internet, es gilt vor allem aber auch für das Buch, denn mit der Entwicklung beweglicher Metalllettern legte Gutenberg Mitte des 15.Jahrhunderts den Grundstein zur Entstehung dieses ersten Massenmediums als Informations-, Unterhaltungs- und Unterrichtsmittel...
( merz 2001/06, S. 401 - 403 )
medienreport
Erwin Schaar: Exhibierte Trauer -
Nanni Moretti ist ein Regisseur, dessen Filme auch unmittelbar von ihm leben. Ein Autorenfilmer, der seine Person in die Handlung integriert, die also auch von seinen Gefühlen, von seinen Beobachtungen lebt. Als engagierter Linker hat er sich in seinen beiden Filmen "Caro diario" (1993) und "Aprile" (1998) mit seiner Heimatstadt Rom dezidiert politisch und sozial, aber auch sehr humorvoll auseinandergesetzt. Dabei nie auf seine ganz persönlichen Erfahrungen verzichtet. Morettis Filme drehen sich auch immer um Moretti. Sie sind visuelle Versuche, der eigenen Biografie nachzuforschen. Seine zudem vorhandene pädagogische Ader versucht er mit seinem Kino in Trastevere zu beweisen, in dem er die Filme zeigt und zeigen will, die er einer Vermittlung für wert befindet."La stanze del figlio" transportiert eine Idee von ihm, die er den Zuschauer zum Reflektieren anbieten möchte: "Es drängte mich dazu, vom Schmerz zu erzählen, den man bei Tod eines geliebten Menschen empfindet, die Verhaltensweisen auszuloten, mit denen die Angehörigen darauf reagieren.
Es war mir ein großes Anliegen, diesen Stoff zu inszenieren. Nie zuvor habe ich mich so intensiv mit den Gefühlen, die ein Film auslöst, identifiziert wie diesmal."Aus Glück wird SchmerzEine Stadt mit einem intimen Charakter, in der Einzelne noch wahrgenommen werden können; die Familie des Psychotherapeuten Giovanni mit Tochter und Sohn, beide fast erwachsen; die alltägliche Arbeit mit den Patienten, deren Nöte Giovanni zumindest anzuhören versucht; die Liebe Giovannis zu seiner Frau Paola; die sportlichen Betätigungen - Giovanni und sein Sohn Andrea beim Joggen, Andrea beim Tennisspiel, Tochter Irene beim Basketball; Paola als Bindeglied der Familie. Ein gemeinsamer Sonntag ist vorgesehen, aber Giovanni erfüllt den Wunsch eines leidenden Patienten, ihn unbedingt zu besuchen, und Andrea geht daher zum Tauchen. Das hätte alles Episode bleiben können. Doch Andrea verunglückt tödlich und das so homogene Zusammensein von Menschen wird beendet. Jeder sucht für sich den Verlust zu bewältigen. Giovanni, Paola, Irene haben die Koordinaten ihrer liebenden Geborgenheit verloren. Giovanni hat nun Schwierigkeiten, dem Patienten, der ihn gerufen hat, helfend gegenüberzutreten; hat nicht mehr die Konzentration, sich den alltäglichen Nöten anderer zu widmen und gibt vorerst seine Tätigkeit auf.
Noch einmal wird das Bild einer sich verstehenden und einträchtigen Familie angetönt, als die Urlaubsfreundin Andreas auftaucht - eine Erinnerung an die Zeit, als alle noch in der Einheit lebten. Vielleicht wird es wieder eine Art geregelten Zusammenlebens geben - es wird aber immer mit der Erinnerung an den Verlust verbunden sein.Ein Abschied für immerMorettis gefühlvolle Bilder und die Geborgenheit vermittelnder Schauspieler zeichnen eine in sich ruhende Familie, in der die Figur Andreas aber seltsam blass bleibt, nicht als starke Persönlichkeit gezeichnet wird. Es gibt keine Sentimentalitäten, die Räume der unaufdringlich dezent möblierten Wohnung vermitteln Wärme, sind aber in ihrer Zusammengehörigkeit schwer in den Filmbildern auszumachen. Eine dezente routinierte Hintergrundmusik von Nicola Piovani lässt Vertrauen fassen. Aber schon die Episoden mit den Patienten, die auf der Couch ihre psychischen Konflikte erzählen oder Giovanni gegenübersitzen und von zerstörerischen Wünschen berichten, verweisen auf eine nicht haltbare Präsenz des Glücklichseins.Dass geliebte Menschen verschwinden werden und diese Trennung endgültig sein wird, versucht der Regisseur Moretti mit den bildfüllenden Tätigkeiten des Verschweißens und Verschraubens des Sarges dann fast zu eindringlich zu beschwören.
Die wie handwerkliche Unterweisungen gefilmten Handgriffe werden im Zusammenhang mit der Geschichte zur Absage an jegliche religiöse Tröstung oder Hoffnung, die ein Priester mit platten Symbolismen zu vermitteln versucht.Das Zimmer meines SohnesEs mag dem Titelgeber der deutschen (untertitelten) Fassung sicher nicht von ungefähr eingefallen sein, das Posessivpronomen "mein" zu verwenden, das im Original nicht vorkommt. Morettis Präsenz als Schauspieler hat etwas Egomanisches an sich, so dass seine Figur ständig im Vordergrund des Geschehens steht, was die anderen Hauptfiguren einengt. Dadurch mag sich auch auf die Dauer des Films die Handlung zu sehr auf das Gefühlsleben Giovannis verlagern, was dem Film eine eher männliche Sichtweise gibt. Die wenig prägnannte Figur Andreas, dem zudem der Vater wenig Siegeswillen (beim Tennisspiel) unterstellt und der durch einen kleinen Diebstahl einen moralischen Flecken bekommt, lässt Moretti selbst zum Star des Films werden, ähnlich wie in Woody Allens Filmen auch dieser bei seinem Auftreten die Story prägnant in den Griff nimmt. Gelingt Allen durch sein komödiantisch geniales Talent eine Abstraktion seines Erzählens, d.h. der Zuseher wird zum Genuss von Allens Darstellung aufgefordert, erleben wir bei Moretti ganz die Einbindung auf seine außerfilmische Person.
Die Geschichte wird zum Träger der Emotionen der Starfigur Moretti, auf die er uns fixieren möchte. So als ob er diese Selbstverliebtheit durchaus selbst erkannt hätte, äußert er: "Eine weitere Neuerung besteht darin, dass die Person, zu denen Giovanni Beziehungen unterhält, diesmal nicht bloße Randfiguren sind, die um den Hauptcharakter kreisen. Meine Frau Paola, mein Sohn und meine Tochter sind hier absolut eigenständige Charaktere.""Das Zimmer meines Sohnes" wurde als "Bester Film" bei den Filfestspielen in Cannes 2001 mit der Goldenen Palme ausgezeichnet.Das Zimmer meines Sohnes(La stanza del figlio)Regie und Idee: Nanni MorettiBuch: Linda Ferri, Nanni Moretti, Heidrun SchleefKamera: Giuseppe LanciMusik: Nicola PiovaniDarsteller: Nanni Moretti, Laura Montes, Jasmin Trinca, Giuseppe SanfeliceProduktion: Italien (Sacher Film, Bac Film, Studio Canal) 2001Länge: 99 MinutenVerleih: Prokino Filmverleih
Tillmann P. Gangloff: Animation ohne Risiko
MangaismusRiesige Augen und kleine Stupsnäschen: So sehen Manga-Mädchen aus. Und weil die japanischen Comic-Verfilmungen (Kenner sprechen von "Anime") weltweit erfolgreich sind, wimmelt es in vielen neuen Serien von solchen Gesichtern. Das liegt zwar auch daran, ass japanische Firmen seit dem "Pokémon"-Boom ihre Archivware verkaufen können, doch einige der neuen Produktionen kommen aus Frankreich. Europäische Inhalte in fernöstlicher Form: Das kann durchaus reizvoll sein. Muss es auch, denn weitere Reize gab es auf den jüngsten Animationsmärkten Cartoon-Forum und Mipcom Junior kaum. Alles, was sich etablierte Produktionsfirmen an unkonventionellem Design derzeit zutrauen, wirkt wie eine späte Hommage an Klszky/ Szupo - und deren einst avantgardistischer Stil ("Rugrats") ist mittlerweile auch in die Jahre gekommen.Animation gilt nach wie vor als Schlüssel zu den Kinderquoten. Angeblich gibt es zwar einen Trend zu so genannten Live- Action-Programmen, doch davon war bei der Mipcom Junior in Cannes nicht viel zu sehen. Tapfer hat sich immerhin die Bavaria gegen den Trend gestemmt und die von ihren Töchtern Askania und Maran produzierten Langlaufserien "Schloss Einstein" und "Fabrixx" eingereicht.
Ansonsten aber konnte selbst der weltweite Erfolg der Kinder-Endzeit-Soap "The Tribe" (KI.KA) die Produzenten nicht ermutigen. Angesichts gestiegener Produktionskosten, gesunkener Lizenzpreise und anderer wirtschaftlicher Probleme scheuen sie ganz einfach das Risiko. Und weil das auch für den Animationsbereich gilt, war die durchschnittliche Qualität in Cannes handwerklich zwar hoch, künstlerisch jedoch eher enttäuschend.Das betrifft auch zwei Produktionen, die aber aufgrund ihrer bekanntn Vorlagen zumindest hierzulande trotzdem erfolgreich sein werden: "Timm Thaler", James Krüss' Geschichte des Jungen, der dem Teufel sein Lachen verkauft", und "Momo", Michael Endes Geschichte des Mädchens, das sich tapfer den Zeitdieben entgegenstellt. "Momo" - riesige Augen und stupsnase - ist eine der wenigen neuen Produktionen von EM.TV. Einzig interessant ist in beiden Fällen die düstere Welt der Bösewichte. Flash-AnimationGerade bei "Timm Thaler" spürt man die industrialisierte Animation: Mit ihren eckigen Bewegungen wanken die Figuren wie Roboter durch die Gegend. "Lebendig" ist ihnehin bloß der Vordergrund. Bestes Beispiel, das man sio oder ähnlich auch in vielen anderen Zeichentrickproduktionen finden könnte: Als Timm über einen Rummelplatz geht, bewegt sich außer ihm überhaupt nichts. So spart der Produzent (in diesem Fall CTM) zwar Geld, doch die Bilder wirken tot.Das ist der Nachteil der Computeranimation, es sei denn, man macht das Beste aus den beschränkten Möglichkeiten und setzt auf Flash-Animation.
Susanne Müller, Leiterin des Kinder- und Jugendprogramms beim ZDF, sieht darin eine der wenigen Innovationen beim Zeichentrick. Flash stammt aus dem Internet: Die Animation ist deutlich sparsamer, die Figuren bewegen sich weniger, die Hintergründe bleiben leer. Im ohnehin etwas trägeren Internet ist das durchaus sinnvoll. Gar pfiffige Produzenten versuchen nun, den umgekehrten Weg zu gehen und die Bilder oder zumindest die Machart von Internet ins Fernsehen zu transportieren.Das klappt natürlich nur, wenn der Animationsstil auch passt; wie zum Beispiel bei "2020" aus Spanien. Hier stammten die Figuren vom Fließband und unterscheiden sich nur durch Frisur und Kleidung; der Rest (Kopf, Bauch, Hände) besteht eigentlich bloß aus Kreisen. Die Serei spielt in einer "nahen Zukunft", in der es von Klonennur so wimmelt (im Fußballstadion spielen elf Maradonas gegen elf Ronaldos). "2020" richtet sich an ein Publikum im "Simpsons"-Alter und ist vom inhaltlichen Grundmuster her ähnlich. Eine Mittelschichtfamilie steht im Mittelpunkt. Mutter arbeitet bei einem TV-Sender. Vater testet synthetisch hergestellte Nahrung, zum Beispiel Eier in Würfelform. Eine ffröhliche Satire, die beweist: Wenn der Inhalt stimmt, ist das Design zweitrangig.Nicht minder schräg ist "da Möb", eine Produktion im Vertrieb der deutschen TV Loonland, die sich an Jugendliche richtet. ERwachsene werden sich schon allein wegen der Musik kaum mit en Burschen anfreunden, zumal zwei der drei Titeljungs (eine Hip-Hop-Band) aussehen, als wären sie aus der MTV-Serie "Beavies & Butt-head" übernommen worden.
"Da Möb" wird es allerdings schwer haben, denn für viele Kindersender dürfte die Serie ein zu 'altes' Publikum ansprechen.Eine neue ZielgruppeDie Produzenten haben eine neue Zielgruppe entdeckt: jugendliche Mädchen. Die typische Zielgruppe von Daily Soaps wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist seit Jahren im Zeichentrickbereich vernachlässigt worden. Produzenten erklärten dies mit dem Argument, in den Familien seien nun mal - ganz die Väter - die Jungs die Herren der Fernbedienung; deshalb gebe es kaum Trickserien mit weiblichen Hauptfiguren. Weil aber amerikanische Marktforscher herausgefunden haben, dass es allein in den USA 18 Millionen Mädchen und junge Frauen zwischen 10 und 19 Jahren gibt und die pro Jahr 67 Milliarden Dollar in die Geschäfte tragen, müssen Werbung treibende Fernsehsender diese Zielgruppe natürlich auch bedienen: mit Zeichentrickversionen von Mystery-Serien wie "Buffy" oder "Sabrina" oder der französischen Produktion "Totally Spies!". Im Mittelpunkt stehen drei High-School-Mädchen aus Beverly Hills, die regelmäßig brisante under-Cover-Aufträge übernehmen. Das Design dieser fröhlichen Variante von "Drei Engel für Charlie" ist zwr eher konventionell, doch die Mädchen haben es in sich: ewig lange Beine, große Augen, Stupsnase.
Beitrag aus Heft »2001/06: Bildung ohne Medien«
Autor: Tilmann P. Gangloff
Beitrag als PDFEinzelansichtTillmann P. Gangloff:Kindern Realitäten zeigen
Selbstherrliche TV-SenderJede Woche zeigen deutsche Fernsehsender weit über hundert Stunden Kinderprogramm. Dabei handelt es sich zum größten Teil um Zeichentrick- Immerhin gibt es in der ARD, im ZDF oder im KI.KA aber auch diverse Informationssendungen. Doch das ist im Wesentlichen Infotainment in Schnipsellänge. Dokumentarisches Kinderfernsehen oder gar Dokumentarfilme für Kinder: Fehlanzeige. Die Kinder wollen das nicht shen, sagen die Sender. Woher sie das wissen?Die Kinder selbst sagen was ganz anderes. Im Gegensatz zu Tagungen, bei denen immer bloß über Kinder geredet wird, aber nie mit ihnen, kam bei einem europäischen Symposium in Köln auch dei Zielgruppe zu ihrem Auftritt. Unverblümt machte sie klar, dass sie vom Kinderfernsehen Informationen erwarten; auch über Tragödien wie die Anschläge in Amerika.Die Sender aber ignorieren die Bedürfnisse ihrer jungen Zuschauer. Eine Untersuchung der Dokumentarfilminitiative (dfi) im Filmbüro Nordrhein-Westfalen kommt zu dem Ergebnis: je älter die Zielgruppe, dest kürzer und komprimierter werden die Beiträge. Selbst die "Sendung mit der Maus" (WDR) leistet sich gelegentlich ein Dreißig-Minuten-Stück; ältere Kinder oder Jüngere Jugendliche dürfen bloß noch mit Infotainment-Schnipseln in Magazinen rechnen. Die Kinder in Köln waren zehn bis dreizehn Jahre alt, und sie wussten nicht nur, was Dokumentationen sind ("Wo man was über die Welt erfährt"), sie wollen sie auch sehen: in Form von Zeitgeschichte zum Beispiel. Und sie sollten natürlich aus Kindersicht gestaltet sein. Kinder müssten aber nicht vorkommen.
In Berichten über den Zweiten Weltkrieg oder den Kosovo zum Beispiel wollen die Kindernicht sehen, wie Kinder sterben.Es gibt VorbilderEine ganze Reihe der rund 120 Teilnehmer in Köln kam aus Skandinavien, Holland und Belgien; und da sieht wieles ganz anders aus. In Dänemark zum Beispiel müssen 25 Prozent der Filmfördermittel in Kinderfilme investiert werden; davon profitiert natürlcih auch der Dokumentarfilm. und in Holland gibt es einen jährlichen Drehbuchwettbewerb, "Kids & Docs". "Stimulierungsfond" heißt das dort: Schüler schreiben Entwürfe für Dokumentationen, Autoren arbeiten sie zu Treatments aus, die Sender sorgen für die Produktion und garanteren feste Sendeplätze. Das, forderte Petra Schmitz von der dfi, müsste doch auch in Deutschland möglich sein. DieDrehbuchwettbewerbe gibt es zwar, allerdings werden sie überwigend von privaten Initiativen getragen. Die Stiftung Goldener Spatz, Veranstalterin des gleichnaigen Kinderfilm- und Fernsehfestivals in Gera, oder Föderverein Deutscher Kinderfilm, so die Vorschläge, könnten den Wettbewerb koordinieren, ARD-Sender setzen um, KI.KA strahlt aus. Die Kultusministerin, die das Thema Medienkompetenz zuletzt vor allem auf die Eroberung des Internet reduzierten ("Schulen ans Netz"), könnten die Schirmherrschaft übernehmen.Die Kinder wären mit Sicherheit zu begeistern. Denn sie, weiß auch Antje Starost, "Sind nicht das Problem". Starost hat vor jahren den Film "Chaupi Mundi"gedreht, ohne Filmförderung, ohne Fernsehanstalt; produziert hat sie ebenfalls selbst und schliesslich sogar den Vertrieb übernommen. DEr Film, in dessen Mittelpunkt ein Mädchen in Ecuador und sein Schwein stehen, beschränkt sich zwar über lange Strecken auf die ausgiebige wortlose Dokumentierung einheimischr Arbeitstechniken, aber die Kinder mögen ihn offenbar trotzdem.
Der Film ist 1992 entstaden. Seither hat Starost nicht mehr für Kinder gearbeitet: Es erfordere einfach zu viel Energie, Fernsehen und Fördergremien zu überzeugen. Wie steht es mit der Förderung?Dabei warten die Förderer bloß auf entsprechende Anträge; zumindest beim Kuratorium junger deutscher Film, das ja zur Hälfte ausdrücklich der Förderung von Kinderfilmen gewidmet ist. Kuratoriumsmitglied Thomas Hailer wusste allerdings nur von zwei Prjekten zu berichten. Dafür brachte er drastisch auf den Punkt, warum sich so wenige Produzenten und Regisseure an Dokumentationen für Kinder trauen: Es stelle ja schon "ein unglaubliches Risiko" dar, einen Kinderfilm zu produzieren; für einen Dokumentarfilm für kinder aber müsse man "fast schon selbstmörderische Absichten haben".Obwol der Dokumentarfilm in Baden-Württemberg Tradition hat ("Stuttgarter Schule"), befinden sich unter den 160 Produktionen, die die dortige Medien- und Filmgesellschaft bislang gefördert hat, nur eine einzige Dokumentation, die sich auch an Kinder richtet. Förderer wie das Filmbüro NW (zu dem die dfi gehört) konzentrieren sich laut Satzung ohnehin auf kulturelle Filmförderung; Fernsehen ist da gar nicht vorgesehen.In anderen Bereichen sieht es nicht besser aus. Ausgerechnet beim nicht-gewerblichen Filmverleih stand man den Dokumentationen lange Zeit selbst im Weg. Weil der Bundesverband Jugend und Film (BJF), so Geschäftsführer Reinhold T. Schöffel, aus Gründen der Projektsqualität auf den Videoverleih verzichtet, ist die Nachfrage entsprechend gering: Die Mehrzahl der dokumentarischen Produktionen auf 16mm oder gar 35mm gibt es kaum. Schöffel kündigte an, der BJF werde in Zukunft stärker auf da Medium DVD setzen, was auch TV-Dokumentationen neue Chancen eröffnen könne.Gutgemeinte VorschlägeAus Sicht der Sender ist es ohnehin empfehlenswert, stärker mit den nicht-gewerblichen Verleihern zusammenzuarbeiten. Der BJF zum Beispiel möchte unbedingt die dänische Produktion "Aligermaas Abenteuer" von Andra Lasmanis (1998) nach Deutschland holen.
Das Porträt eines mongolischen Mädchens läuft in Skandinavien seit drei Jahren mit großem Erfolg. Vereine wie der BJF aber können es sich nicht leisten , dn Film auf eigene Kosten zu synchronisieren und Kopien ziehen zu lassen 8untertitelte Kopien sind bei Kindern kaum einsetzbar). Und da offenbar keiner der Fernsehsender ein Interesse an dem Film hat, werden ihn deutsche Kinder nie zu sehen bekommen. Für Produktionen mit Spielfilmlänge haben TV-Anstalten im Kinderprogramm keine Sendeplätze (KI.KA zeigt zwar jeden Sonntag zur Mittagszeit einen Märchenfilm, doch da werden in erster Linie die alten Defa-Bestände aufgebraucht).Wie wäre es denn, forderte man in Köln keck, wenn sich KI.KA und Arte zusammentäten? Beim Kinderkanal ärgert man sich schon seit Jahrn darüber, dass der Sender zur besten Kinderzeit gegen 19.00 Uhr dem deutsch-französischen Kulturprogramm weichen muss. Dabei wird Arte zumindest in Deutschland um diese Uhrzeit höchst wahrscheinlich kaum wahrgenommen. Ein gemeinsames Familienprogramm, auch mit dokumentarischen Formen für Kinder: könnte man doch mal drüber nachdenken! Wirtschaftlich ausgerichtete Förderungen wie etwa die Filmstiftung NRW lassen sich übrigens ohnehin nur in Aushnahmefällen auf dokumentarische Projekte für Kinder ein. Das müssen dann schon Produktionen wie die über 5 Millionen Mark teure, international koproduzierte WDR-Reihe "Fabeltiere" von Uwe Kersken, der früher viel fürss Kinder- und Schulfernsehen gedreht hat ("Delphingeschichten"), einmal in Fahrt war, brachteer gleich die ganze Misere auf den Punkt: Dokumentarische Formen existieren im Kinderfernsehen bloß noch als mgazin-Einspieler, die "finanziell und künstlerisch nicht mehr akzeptabel seien". Angesichts der niedirgen Budgets neigten manche Produzenten offenbar dazu, die Beiträge von Praktikanten realisieren zu lassen. Dabei seien doch Kinder viel kritischer als Erwachsene und hätten "die besten Filmemacher der Welt" verdient.
Beitrag aus Heft »2001/06: Bildung ohne Medien«
Autor: Tilmann P. Gangloff
Beitrag als PDFEinzelansichtChristian Doelker: Wissensexplosion versus Erfahrungstransfer
Der Text geht auf ein Referat zurück, das der Autor im Juli 2001 bei der Gesamtschweizerischen Lehrerweiterbildung gehalten hat.Die Trennung von Erfahrung und WissenEin Zitat, das sich wie eine Klette an mein Bewusstsein gehängt hat, ist der folgende Satz des Psychiaters Ronald D. Laing: "Was die direkt von unserer eigenen Erfahrung abgeleiteten Erkenntnise und Vergegenwärtigungen betrifft, so weiß jeder von uns im Grunde nicht mehr - und möglicherweise erheblich weniger - als Männer und Frauen zu anderen Zeiten und anderen Orten"(Die Stimme der Erfahrung. Köln 1983 ).Hier ist für einmal von Erfahrung die Rede und nicht von Kenntnissen und Informationen.
Und je mehr das Schlagwort einer Informationsgesellschaft oder Wissensgesellschaft an Bedeutung gewinnt, je mehr Informationen und Wissen an Volumen (exponentiell) zunehmen, umso wichtiger scheint mir, zwischen den Begriffen Erfahrung und Wissen eine Unterscheidung zu treffen. Das heisst: Der Satz des amerikanischen Psychiaters kann dahin verstanden werden, dass derheutige Homo informaticus in seiner Aufnahmefähigkeit für Erfahrungen nicht viel anders organisiert ist als ein Mensch der Jäger- und Sammlergesellschaft (Altsteinzeit und Phase der Prähominiden) respektive der Agrargesellschaft (o Jungsteinzeit oder Mittelalter ist da gleichgültig). Aufnahmefähigkeit für Erfahrung meint somatische Speicherung, die Ablage also im eigenen personalen Gedächtnis, beziehungsweise im tradierten kollektiven Gedächtnis einer Kultur/ Ethnie/ Population. Erfahrung betrifft mithin "Erkenntnisse und Vergegenwärtigungen2, die zur Steuerung unseres Verhaltens und Handelns in komplexen Lernprozessen erworben worden sind...
( merz 2001/06, S. 395 - 400 )
Beitrag aus Heft »2001/06: Bildung ohne Medien«
Autor: Christian Doelker
Beitrag als PDFEinzelansicht
kolumne
Erwin Schaar: Abschied vom Job
"Was werden Sie denn machen?" gehört/e fast schon zur Regelanfrage, wenn man sich outet, sich in naher Zukunft in den Rentenstand verstzen zu lassen. Kann es denn sein, dass sich einer, der so viele Jahre an der regelmäßigen Publizierung einer Zeitschrift arbeitete, sich von seiner Arbeit verabschiedet, ohne Pläne für die Zukunft ausgearbeitet zu haben? Er wird seine Zeit doch nicht damit verbringen, die Deckel der Kochtöpfe zu lupfen, in denen eine zu Hause herrschende Frau, so sie vorhanden ist, täglich Nahrung zubereitet, deren Verzehr dann Lebenszeit strukturiert? Der aus diesem tiefen Loch des Nichtstuns, in das er unweigerlich fällt, seltsame Marotten ausbrütet, die seine Umwelt zur Verzweiflung treiben werden?Wollen wir den Albtraum verlassen, der so oft mit dem Eintritt in den Ruhestand assoziiert wird. Es sit ja zuzugeben, Begriffe wie "Rente" oder "Ruhestand" beinhalten die unbeweglichkeit des Geistes und des Körpers, lassen Stagnation und daraus sich ergebende Rüchwärtsgewandheit erwarten. Andererseits hört man auch immer wieder: "Jetzt kann ich das nachholen, wozu ich vorher die Zeit nicht aufbrachte" - die vielen Bücher lesen, die Reisen in Angriff nehmen, die so genannten Interessen pflegen.
Das wäre dann die aktivere Form des Zeitverbringens.Der nue Lebensabschnitt - gleich wie lange er dauern wird - dürfte zumindest eine neue erfahrung bringen, die nicht immer Zuckerschlecken sein wird, auch wenn der Schrebergarten im Kopf erklärter Feind sein soll. Vorsätze hängen immer von Körper und Geist ab.Diie Rückschau auf die langjährige Tätigkeit schrumpft bedenklich, wenn ein Fazit gezogen werden soll. Die vielen gebundenen Jahresbände der Zeitschrift lassen eigentlich eine Vielfalt vermuten, die mit Arbeit in Verbindung gebracht werden könnte - aber warum ist die Zeit so schnell vergangen, in der das Bemühen um jedes einzelne Heft gar nicht mehr aufscheint? So viel möchte man noch sagen, zur Entwicklung der Medien, dem Selbstverständnis der Medienpädagogik, die sich parallel dazu entwickelt hat und wo man doch so viele Lücken entdeckt, die nicht gesehen wurden, denen kein Eingang in die Auseinandersetzung gewährt wurde. Besucht man aber ab und zu ein Referat einer Ringvorlesung einer Hochschule, die interessiert, muss man immer wieder feststellen, wie abgekapselt meist vor sich hin gedacht wird, weil das Vertreten der eigenen fachlichen Belange nicht nur mit dem Gegenstand zusammenhängt, sondern dessen Eingebundenheit in wirtschaftliche und soziale Gegebenheiten schon viel Kraft verlangt.
Die eigene Notwendigkeit muss deutlich, andere von der eigenen Wichtigkeit überzeugt werden.Der Abschied fällt in eine Zeit, in der auch die geistige Bindung an die politische Linke in Frage gestellt wird durch die "uneingeschränkte Solidarität" zu einem Krieg, der viele Fragen aufwirft, die kritische Haltung erfordern, deren Wert aber ofiziell immer mehr angezweifelt wird. Doch die intelektuelle Freiheit und die geistige Vielfalt der Medien sind zu nicht mehr wegzudenken Bestandteilen des politischen Lebens geworden.Die Medien sind in positives Geschehen eingebunden. Und sie sind durch ihr dasein auch Auslöser für Phantasien und Taten, die ohne sie einfach nicht vorstellbar wären. Das hat nichts mit Schuld an etwas zu tun, das ist eine wertneutrale Feststellung, die aber in die Anlyse der Taten mit einbezogen werden muss. Der französische Medienphilosoph Paul Virilio hat 1986 über 2Krieg und Kino" geschrieben, was auch für das Fernsehen gelten dürfte: "Kino ist Krieg, weil Gustav Le Bon 1916 schreibt, 'der Krieg nicht nur das materielle Leben der Völker erfasst, sondern auch ihr Denken...
Und hier kommt man wieder auf die grundsätzliche Vorstellung, daß die Welt nicht vom vom Rationalen gelenkt wird, sondern von Kräften affektiven, mystischen oder kollektiven Ursprungs, die die Menschen führen, den mitreißenden Suggestionen dieser mystischen Formeln, die umso mächtiger sind, als sie sehr vage bleiben... Die immaterliellen Kräfte sind die wahren Lenker der Kämpfe."Widersprüche und Sprünge meiner Ausführungen müssenso stehen bleiben. Sie sollen und müssen auch die weiteren Auseinandersetzungen prägen. So weit ersichtlich werde ich Mitheruasgeber von merz bleiben und als eher zurückgezogener Berater tätig sein. Meine Kollegin Claudia Schmiderer wird die Redaktion übernehmen mit einem neuen Team, das sie in der nächsten merz-Ausgabe vostellen wird. Ihr und dem Team viel Erfolg.
Ansprechperson
Kati StruckmeyerVerantwortliche Redakteurin
kati.struckmeyer@jff.de
+49 89 68 989 120
Ausgabe bei kopaed bestellen
Zurück