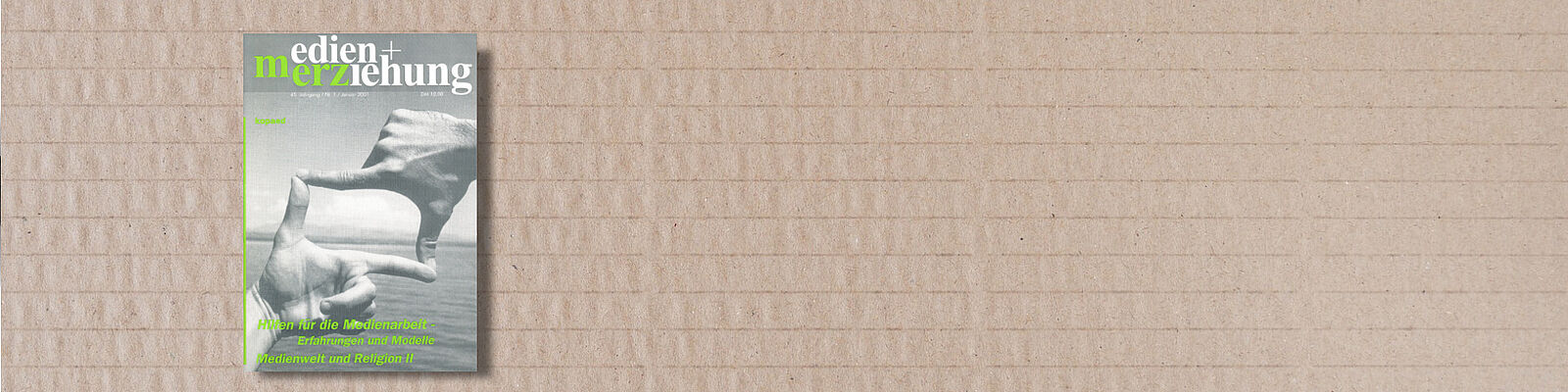2001/01: Hilfen für die Medienarbeit
thema
Norbert Neuß: „Ich wurde offener für die Erfahrungen der Kinder"
Die hier vorgestellte Konzeption beinhaltet nicht nur die Aus- und Fortbildung von Medienkompetenz bei der Zielgruppe, sondern setzt auch auf die positive und nachweisbare Wechselwirkung auf die Kinder und deren Eltern.
(merz 2001-01, S. 7-9)
Beitrag aus Heft »2001/01: Hilfen für die Medienarbeit«
Autor: Norbert Neuß
Beitrag als PDFEinzelansichtDieter Steffen: Multimedia ante portas
Die Beispiele aus der medienpraktischen Arbeit einer Bielefelder Schule zeigen auch die positiven Entwicklungen für die Lehrenden und die noch einzulösenden Forderungen für eine künftige Medienpädagogik in der Schule.
(merz 2001-01, S. 10-13)
Beitrag aus Heft »2001/01: Hilfen für die Medienarbeit«
Autor: Dieter Steffen
Beitrag als PDFEinzelansichtMichael Scheibel: Alma mater virtualis
Ausgehend von der Prämisse, dass Hochschulen keine Produkte, sondern Prozesse entwickeln, fehlt es dort neben der finanziellen Ausstattung auch an institutioneller Verankerung und Vernetzung zukunftsorientierter Lehrkonzepte.
(merz 2001-01, S. 14-16)
Beitrag aus Heft »2001/01: Hilfen für die Medienarbeit«
Autor: Michael Scheibel
Beitrag als PDFEinzelansichtChristian Filk : Netzgestützte Wissenskommunikation
Mit onlinebasierten Lehr- und Lernumgebungen werden neuartige Lernkonzepte notwendig. Die Forschung zu diesem komplexen Bereich steht jedoch noch am Anfang und muss vor allem interdisziplinäre Ansätze aufgreifen.
(merz 2001-01, S. 17-19)
Beitrag aus Heft »2001/01: Hilfen für die Medienarbeit«
Autor: Christian Filk
Beitrag als PDFEinzelansichtTom Bette: Lerning by doing...und mehr
Nicht nur Spaß, auch ernsthafte und konzentrierte Anstrengungen stehen an, wenn ein Uni-Radio professionelle Ansprüche erfüllen will, und damit nicht nur Studierende sondern auch interessierte Bürger erreichen möchte.
(merz 2001-01, S. 20-22)
Beitrag aus Heft »2001/01: Hilfen für die Medienarbeit«
Autor: Tom Bette
Beitrag als PDFEinzelansichtJosef Lederle: Von Engeln und Teufeln
An ausgewählten Filmen werden ikonographische und mythologische Elemente aufgezeigt, die eine Vorstellung von Jenseits geben und zu einer Reflexion über Funktion und Bedeutung symbolischer, religiöser Kommunikation führen.
(merz 2001-01, S. 24-29)
Beitrag aus Heft »2001/01: Hilfen für die Medienarbeit«
Autor: Josef Lederle
Beitrag als PDFEinzelansichtFranz Josef Röll: Mythische Bildmotive in der Werbung
Auch die Konzepte der Werbung setzen auf den Bedarf nach Mythen. Die symbolisch aufgeladenen Bilder enthalten Motive, die Orientierung bieten können. Sie einzuordnen verlangt jedoch Kenntnisse unserer religiösen Bildkultur.
(merz 2001-01, S. 30-36)
Beitrag aus Heft »2001/01: Hilfen für die Medienarbeit«
Autor: Franz Josef Röll
Beitrag als PDFEinzelansichtUdo Feist: Besitz und Besessenheit
Der Autor zeichnet den Weg des Voodoo nach von seinem Ursprung auf Haiti, wo dieser Kult in erster Linie eine Sozialtechnik darstellt, bis zur Verbreitung in den USA und Europa, wo er sich in der Jugendkultur und Esoterik ausprägte.
(merz 2001-01, S. 37-42)
Beitrag aus Heft »2001/01: Hilfen für die Medienarbeit«
Autor: Udo Feist
Beitrag als PDFEinzelansicht
medienreport
Erwin Schaar: Das Trugbild Leitkultur
Regie und Buch: Michael Haneke - Kamera: Jürgen Jürges - Musik: Giba Gonçalves - Darsteller: Juliette Binoche, Thierry Neuvic, Sepp Bierbichler, Alexandre Hamidi, Ona Lu Yenke, Luminita Gheorghiu - Produktion: Frankreich (MK2 Productions, Les films Alain Sarde) 2000 - Länge: 117 Minuten - Verleih: Prokino/ Twentieth Century Fox of GermanyMichael Hanekes Filme sind pessimistisch und doch dem Leben zugewandt. Sie sind grüblerisch. Sie sind zeichenhaft stilisierend, dann aber doch nicht so abstrakt, dass sie der Emotion nicht zugänglich wären, dass sie nur aufzeigen würden, um den Intellekt zu beschäftigen. Hanekes Filme bedürfen wacher, nicht unbedingt schon von Gefühlen gebeutelter Zuseher. Rekreation beim Zusehen kann nur im Nachvollziehen einer als gelungen angesehen Konzeption des Regisseurs gelingen. Jeder auf den schnellen Gag lauernde, auf Action getrimmte Kinogeher wird oder müsste genervt die Vorstellung verlassen. Diejenigen, denen Filmbilder auch Anlass für Nachdenken sind, finden genug Stoff für ästhetische und soziale Auseinandersetzungen.All dies gilt vornehmlich für Hanekes neuesten Film „Code inconnu“.Keine letzten WahrheitenDie Handlung des Films ist natürlich dramaturgisch verbunden, auch wenn es viele Begebenheiten sind, die sie ausmachen, und die grundsätzlich nichts miteinander zu tun haben oder hätten, denen aber der Autor eine erzählerische Klammer gegeben hat, damit wir Zuschauer an den Figuren bleiben können, die filmischen Botschaften sich nicht in Unverbindlichkeiten, also an Figuren ohne Geschichte auflösen:
Ein Boulevard in Paris. Jean trifft seine Schwägerin Anne, der er seinen Entschluss mitteilt, den ihm zugedachten Bauernhof nicht zu übernehmen. Anne, eine Schaupielerin, eilt zu einem Vorsprechtermin und schickt Jean in ihre Wohnung. Auf dem Weg dorthin demütigt er durch eine pubertäre Geste die rumänische Bettlerin Maria, die illegal in Frankreich ist. Amandou, malinesischer Abstammung, stellt Jean zur Rede, der sich widerspenstig zeigt. Es entwickelt sich eine Schlägerei, die damit endet, dass der Schwarze Amadou mit zur Polizei muss, Maria ausgewiesen wird. All diesen Gestalten begegnen wir im Laufe des Films immer wieder, werden mit weiteren Partikelchen aus ihrer Lebensgeschichte bekannt. Zu diesen Personen werden sich noch Annes Mann Georges, der als Kriegsreporter im Kosovo arbeitet, der Vater von Georges und Jean und weitere Personen, die mit diesen Protagonisten in Verbindung gebracht werden können, gesellen.Wir wechseln innerhalb der Erzählung ein paar Mal den Ort, gehen von Paris aufs Land, aber auch nach Mali, in den Kosovo, nach Rumänien, verfolgen so die Personen ein Stück ihres Lebens.Die erste Schwarzblende, die unvermittelt der Eingangssequenz folgt, lässt an einen Fehler bei der Projektion des Films denken, bis man die dramaturgische Konzeption Hanekes erkannt hat, lange und kurze Sequenzen, manchmal auch in einer Einstellung gedreht, durch Schwarzblenden abzubrechen. Es soll kein stringenter Handlungsablauf entstehen, der den Eindruck einer mit letzter Wahrheit erzählten Geschichte vermitteln würde. „Man kann nicht so tun, als wäre man im 19. Jahrhundert und als ließe sich Wirklichkeit in toto wiedergeben. Das ist absurd.Aber genau das machen ja 90 Prozent der Regisseure und beziehen aus diesem Erklärungsmodell natürlich auch ihre Publikumswirksamkeit“ (aus einem Interview mit M. Haneke, abgedruckt in „Austrian Film News“, Juni 2000).Einsamkeit„Code: Unbekannt“ ist ein Film über die Schwierigkeiten der zwischenmenschlichen Verständigung, über die Fallstricke des partnerschaftlichen Zusammenlebens, über das Auslöschen von Menschenleben im Krieg und die Informierung der Welt darüber, über Fremdenfeindlichkeit, zwischenmenschliche Provokationen, über die Ästhetik der Wahrnehmung und über deren Relativität selbst. Haneke liebt es, die im ersten Augenblick sich auch so darstellende Normalität als ein Trugbild zu entlarven, immer wieder zu zeigen, dass das nur gelernte (oder vielmehr zu spielen gelernte) Konvention ist. Jeder Mensch ist allein! Hilfe erwächst ihm nicht durch sogenannte Mitmenschlichkeit oder Liebe - bei der Behauptung solcher Gefühle würden sich Hanekes Bilder abwehrend aufstülpen wie die Materie bei einem Erdbeben. Und trotzdem wird menschliche Existenz von Haneke nicht dekonstruiert, sondern hat ihren Wert als diese Einzelexistenz, als die sie vor- und in das Geschehen eingeführt wird. Da scheint Haneke seit dem den Zorn auf seelenlose Quäler und Mördertypen herausfordernden „Funny Games“ doch eine gnädigere Haltung dem menschlichen Wesen gegenüber gefunden zu haben. Zumindest lässt er seine von ihm gewählten und beschriebenen Figuren nicht in Bösartigkeit erstarren: Jean, der der Bettlerin aus Rumänien achtlos eine zusammengeknüllte Tüte in ihre bittenden Hände schmeißt, tut das eher beiläufig, unbedacht denn gezielt, die jugendlichen Provokateure in der Metro, die Anne herauszufordern versuchen, erscheinen zwar aggressiv, reagieren aber wider nur den Frust ab, der sich in sie gefressen hat, weil die Gesellschaft ihnen als Emigranten keinerlei Chancen der Entfaltung bietet.Sprechende TrommelnHaneke beginnt seinen Film mit der pantomimischen Darstellung eines Seelenzustandes durch ein taubstummes Kind. Auch die ratenden Kinder, die die Darstellung verfolgen, können nicht sprechen und geben ihre Auflösungen der Rätselfigur in der Gebärdensprache.
Der Film schließt wieder mit der Darstellung eines Zustandes durch ein Kind, der leichter, aber auch oberflächlicher erscheint als das Psychorätsel zu Beginn. Und überlagert wird dieses Ende durch die Trommeln einer mächtigen Drum-Band, die in koordinierter Formation erregende Rhythmen produziert. Die Besetzung dieses Orchesters der sprechenden Trommeln ist multiethnisch und der Rhythmus ist nicht französisch. Trommelnd scheinen Menschen verschiedener kultureller Herkunft einen gemeinsamen Weg oder zumindest einen Anfang gefunden zu haben. Und wie sie gegen das nervtötende Geseiere von einer Leitkultur antrommeln können.Zum Regisseur: Michael Haneke ist 1942 in München geboren, nach seinem Studium der Psychologie in Wien war er Redakteur beim Südwestfunk und arbeitet seit 1970 als Autor und Regisseur für Film und Theater. Bekannt wurde er durch seine Filme „Benny’s Video“ (1992) und „Funny Games (1997).
Beitrag aus Heft »2001/01: Hilfen für die Medienarbeit«
Autor: Erwin Schaar
Beitrag als PDFEinzelansichtFlorian Schneider: Streaming Media - ein Konvergenzmonster?
Wenn es im Internet im Jahr 2000 ein beherrschendes Thema gab, dann hieß es „Streaming Media“. Unter diesem Kampfruf haben sich mehr oder weniger abenteuerliche Phantasien Bahn gebrochen, die von der Konvergenz aller Medien zu einem einzigen, hybriden Monster handeln, welches die Endnutzer mit unablässiger Kommunikation auf allen zur Verfügung stehenden Plattformen heimsucht: Vom „Blairwitch-Project“ bis hin zur jederzeit am Mobiltelefon abrufbaren Videoüberwachung des heimischen Kühlschranks, von der AOL-Time-Warner-Fusion bis zur Versteigerung der UMTS-Lizenzen. Fünf Jahre nach dem Durchbruch des Internets als Massenmedium schien der Sprung auf eine qualitativ neue Ebene des Hypes nicht nur überfällig, sondern auch zum Greifen nah. Doch 2000 war auch das Jahr der im freien Fall nach unten korrigierten Prognosen. Was also ist dran an der Wunderwelt der miteinander verschmelzenden Medien? Worin besteht überhaupt das Besondere am Streamen?
Audio und Video via Internet
Zunächst einmal handelt es sich bei Streaming Media um einen vergleichsweise alten Hut: Schon kurz nachdem das Hypertextuniversum des World Wide Web erschlossen wurde, machte den Programmierer die Frage zu schaffen, wie über das neue Medium nicht nur statische Texte und Bilder, sondern auch ungleich umfangreichere Audio- und Video-Daten zu übertragen wären. Beim herkömmlichen Download kompletter Dateien war die Zeit des Wartens, bis der Prozess des Herunterladens endlich abgeschlossen war, in der Regel fünf bis zehn Mal so lang wie das eigentliche Hörvergnügen im Anschluss. 1995 gelang es der Firma „Progressive Networks“ aus Seattle erstmals, Audio-Daten via Internet zu übertragen - und zwar mehr oder weniger in Echtzeit. Mit dem RealAudio-Player konnte das Abspielen der Datei gestartet werden, sobald die ersten Pakete auf dem Rechner anlangten. Voraussetzung ist, dass der Endnutzer die Player-Software auf seinem Rechner installiert hat und dass die Ton-Dateien digitalisiert und komprimiert im proprietären Real-Audio-Format auf einem entsprechenden Streaming Server bereit gehalten werden. Die Daten können zwar auch über TCP/IP und das WWW-Protokoll HTTP übertragen werden, doch eigene Multi-Casting Protokolle wie das „Real Time Streaming Protocol“ (RTSP) oder UDP erhöhen die Übertragungsgeschwindigkeit um ein Vielfaches. Nur wenige Monate nachdem „Progressive Networks“ seine neue Technologie vorgestellt hatte, waren RealAudio-Downloads auf allen großen und populären Webseiten zu finden. Mit der zweiten Version des Players vom Frühjahr 1996 waren Live-Übertragungen möglich und die Einbettung der Audio-Inhalte in das Design von Webseiten. Kurz darauf kam der erste RealVideo-Player heraus, der bis zu seiner aktuellen Version 8 die Stellung als am weitesten verbreitete Play-Back-Software gegen die Konkurrenz von Apple (Quicktime) und Microsoft (Windows Media Player) behaupten konnte.
Open Spaces
Neben den großen kommerziellen Angeboten nutzten von Beginn an vor allem Hobby-Sender und Piratenradios das Internet als Übertragungsweg. Die Streaming-Technologie ermöglichte den Kleinst- oder Mikro-Medien neben der terrestrischen Ausstrahlung mit meist minimaler Reichweite auf einmal ein überregionales, nicht mehr eingrenzbares Publikum anzusprechen. Geradezu legendär ist der „World Service“ von Heith Bunting auf „Irational.org“. Rund um die Uhr sind dort Programme von Piraten- und Schlafzimmersendern aus aller Welt zu hören: Von „La onda bajita“ mit ihrer „Lowrider Show“ aus Kalifornien über Radio „Kyrgyzstan“ bis hin zum australischen „Stereopublic“ fügen sich Dutzende unterschiedlichster Mini-Programme in ein gemeinsam verwaltetes Sendeschema. Im „X-Change“ Netzwerk haben sich seit 1997 unter Federführung von Rasa Smite und Raitis Smits aus Riga und ihrem „E-lab“ alternative nicht-kommerzielle Internet Sender und praktizierende Individualisten zusammengeschlossen. „Open Spaces, Non-Linearität und experimentelle Praxis“ lauten die Prinzipien, nach denen die akkustischen Dimensionen des Cyberspace erforscht werden sollen. Pionierarbeit leistete auch Thomax Kaulmann, Mitbegründer des Internet-Radios der „Internationalen Stadt Berlin“, der mit seinem Projekt Orang.orang.org eine offene Datenbanklösung zur Archivierung von Audio- und Video-Inhalten entwickelte. OMA, das „Open Media Archive“, sammelt, streamt und erschließt Medien-Produktionen, die auf verschiedenen Servern angesiedelt, aber über eine gemeinsame, dynamische Plattform zugänglich sind. Im Unterschied zu kommerziellen Anbietern wie „Atomfilms“, „Eveo“ oder „Videofarm“ kann das Publikum hier nicht nur kostenlosen Content herunterladen, sondern auch eigene Produktionen in die nach verschiedenen Genres und Rubriken sortierte Datenbank hochladen.Kultur des ProvisorischenEs waren die kleinen, unabhängigen und randständigen Initiativen, die den großen Medienkonzernen vormachten, wie Interaktivität nicht nur versprochen, sondern auch wahr gemacht wird. Diese reichhaltigen Erfahrungen zu bündeln und mit der aktuellen Debatte um rechtliche Rahmenbedingungen, technologische Entwicklungen, sowie politische und ästhetische Implikationen zu verknüpfen, war Ziel einer Konferenz, die im Oktober 2000 in Amsterdam stattfand. „Net.congestion“ - also Netzstau, die Fehlermeldung die allzuoft die flüssige Datenübertragung unterbricht - lautete der ironische Titel des Großereignisses, das sich einzureihen versuchte in die Tradition „Next Five Minutes“-Kongresse. Die Frühphase des Experimentierens mit „Streaming Media“ angeführt von ein paar Enthusiasten sei unweigerlich zu Ende, hieß es im Konzept von „Net.congestion“. Netzradio und Web-TV seien an einem Punkt angelangt, wo es nicht mehr bloß gilt, Chancen und Möglichkeiten des hybriden Zusammenspiels von alten und neuen Medien auszuloten und taktische Varianten zu erörtern: „Die Werkzeuge, die die Produzenten von Streaming Media sowohl auf kulturellem wie auf kommerziellem Gebiet benutzen, sind nahezu dieselben. Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Gruppen ist die Art und Weise, wie die Inhalte präsentiert werden.“„Net.congestion“ verdeutlichte aber vor allem eines: Wohin man auch blickt, machen äußerst provisorische Lösungen den Charakter der neuen Medienwirklichkeit aus. Resultat ist eine Kultur des Imperfekten und eine Renaissance oraler Erzählstrategien, die sich den klassischen Plotgesetzen der verschriftlichten Welt Stück für Stück entziehen. Nora Barry vom Online-Filmfestival „The Bit Screen“ sieht vier narrative Taktiken im Aufwind: Interaktive Geschichten, die dem User die Kontrolle über den Fortgang der Handlung übereignen; kollaborative Strategien, bei denen mehrere gleichberechtigte Autoren am Werk sind; Zufallskonfigurationen, wenn Datenbanken automatisch jeweils einzigartige Versionen zusammenstellen; und zu guter Letzt der klassische Kurzfilm. Überschaubare Datenmengen kombiniert mit althergebrachter Dramaturgie und gängigen Pointen machen sicherlich den populärsten Audio- oder Video-Content auf Seiten kommerzieller Anbieter aus.
Ob die User, sobald sie einmal Blut geleckt haben, sich mit der Fortschreibung ihrer Rolle als Couch-Potatoes zufrieden geben, darf jedoch getrost bezweifelt werden. Zu groß sind die Verlockungen, mit denen neue Technologien und deren digitale Übertragungswege winken: Es beginnt beim banalen Chat, der als eine Art Rückkanal heutzutage jedes Streaming begleitet, das etwas auf sich hält. Dies führt zwangsläufig zum Recht auf Programmierung, das aus den Redaktionsstuben der Sendeanstalten in die Hände eines selbstbewußten Publikums übergleitet. Vorläufiger Endpunkt sind im Moment noch richtig radikal anmutende Szenarien, in denen die klassische Handlung mit festgefügtem Anfang und Ende in zahllose Erzählfragmente zertrümmert wird....
Machtverhältnisse verändernEnorme Bedeutung haben die Erfahrungen, die ein einstiger Piratensender wie das Belgrader Radio B92 bei der trickreichen Umgehung des staatlichen Sendemonopols sammeln konnte. Gerade in Gegenden dieser Welt, die nicht über bandbreitige Zugänge verfügen oder wo eine einzige Telefonleitung schon ein kaum vorstellbares Privileg ist, gehört die Zukunft dem hybriden Mix aus allen möglichen Übertragungswegen, seien sie nun analog oder digital, via Internet oder Satellit, im Äther oder im Boden verlegt. Arun Mehta, Streaming-Experte aus New Delhi, legte drei inhaltliche Kriterien fest, die unabhängige Medien im Zeitalter des „Digital Divide“ auszeichnen sollten: Unmittelbare Verbesserungen im konkreten Leben der Menschen herbeizuführen, Medienkompetenz zu befördern und dadurch die herrschenden Machtverhältnisse zu verändern.
Solcher Optimismus erinnert an Hoffnungen, die in der Früh- und Blütezeit von Dokumentarfilm- oder Videobewegung kursierten. Der entscheidende Unterschied dürfte aber darin bestehen, dass heutzutage nicht nur die Produktionswerkzeuge, sondern auch effiziente und vergleichsweise kostengünstige Distributionswege prinzipiell verfügbar sind. Im Gegensatz zu blanken HTML-Seiten setzt der Upload von Audio-und Video-Dateien dennoch um einiges kostspieligere Hard- und Software-Umgebungen voraus, sowie Internet-Zugänge mit großer Bandbreite, wie sie sich derzeit in der Regel nur größere Firmen leisten können. Je vehementer kommerzielle Anbieter sich auf dem Markt der konvergierenden Medien zu positionieren versuchen, desto wichtiger ist es, im Rahmen kommunaler Kulturpolitik und aktiver Medienarbeit frühzeitig Modelle zu entwickeln, die nichtkommerziellen Projekten die Möglichkeit bieten, ihre Audio- und Videoproduktionen zu digitalisieren, zu formatieren und ins Netz zu stellen.
Neutrale und werbefreie Kontexte sind sicherlich unabdingbare Voraussetzung für Glaubwürdigkeit und Erfolg zahlreicher Unterfangen. Gleichzeitig bergen Streaming Media gewaltige ästhetische Herausforderungen und ein immenses kreatives Potential. Eine völlig neue Dimension tut sich vor allem für die non-fiktionale Filmproduktion auf: Anstelle bloßer Dokumentation könnte es vielmehr um eine Art „Meta-Documentary“ gehen: Eine Sicht der Wirklichkeit, die in der Lage ist, zeitlich und räumlich unbegrenzte, parallel stattfindende und miteinander vernetzte Prozesse zu reflektieren.
Beitrag aus Heft »2001/01: Hilfen für die Medienarbeit«
Autor: Florian Schneider
Beitrag als PDFEinzelansichtFernand Jung: CD-ROMs zum Nachschlagen und Spielen
Eine zentrale nationale Kinemathek, wie sie in anderen Ländern eine Selbstverständlichkeit ist, gibt es in Deutschland nicht (wegen der Kulturhoheit der Länder), und so kam es in den letzten Jahrzehnten immer wieder zu unkoordinierten regionalen Aktivitäten, um den Bestand der Filmkultur wenigstens in Teilaspekten aufzuarbeiten. Nach vielem Hin und Her gibt es seit einigen Jahren den Kinematheksverbund, der eine zentrale filmhistorische Arbeit ermöglicht und die filmkulturelle Tradition lebendig halten soll. Dazu gehören die Sammlung und Sicherung der deutschen Filmproduktion von den Anfängen bis zur Gegenwart, ferner die Restaurierung alter Kopien, die Veröffentlichung von Untersuchungen, die Veranstaltung von Retros u.a.m. Diese Aufgaben teilen sich nun die im Kinematheksverbund zusammengeschlossenen drei größten Filmarchive in Deutschland, das Bundesarchiv in Koblenz, das Deutsche Filminstitut in Frankfurt und das Deutsche Filmmuseum in Berlin – eine Reihe weiterer filmwissenschaftlicher Institutionen sind dem Verbund angeschlossen. Ein erstes Ergebnis dieser Gemeinschaftsarbeit ist die vorliegende CD-ROM, die sich in zwei Abschnitte teilt: Die „Top 100“ und die „Deutsche Filmografie“.1995 führte der Verbund unter Filmhistorikern und Journalisten eine Umfrage nach den „100 wichtigsten deutschen Filmen“ durch, um diese zu dokumentieren, die Kopien archivarisch zu sichern und sie für den nicht-kommerziellen Bereich verfügbar zu machen. Letzteres ist erst bedingt der Fall, aber die auf der CD-ROM versammelten Informationen zu den 100 „wichtigsten“ deutschen Filmen lassen keine Wünsche offen. Ein schier unerschöpflicher Materialfundus aus filmografischen Angaben, Inhaltsangaben und Kritiken, Abbildungen (bis zu 30 je Film) und Filmausschnitten, der dank der hier angewandten Technik leicht zu handhaben ist. Man braucht auch keine Angst zu haben, sich in den Datenmengen zu verlieren.
Die „Deutsche Filmografie“, das Ergebnis einer gesonderten Arbeitsgruppe im Kinematheksverbund, enthält die Grunddaten „aller“ Spielfilme, die zwischen 1895 und 1998 in Deutschland produziert oder mit deutscher Beteiligung koproduziert wurden. „Koproduziert“ wird dabei großzügig ausgelegt und so nimmt der Anteil von Filmen, die man keineswegs als „deutsche“ Produktionen einordnen würde, zuweilen groteske Ausmaße an. „The more the better“ scheint hier die Devise zu sein. Insgesamt sind 17 905 Titel nunmehr recherchierbar, wenn auch nur mit den notwendigsten filmografischen Angaben. Eine ähnlich aufgebaute Datei der deutschen Dokumentar- und Kurzfilme (und experimentellen Filme?) ist in Arbeit.
Für beide Verzeichnisse gilt: Die technischen Daten, die Schreibweise von Namen und Titeln, alles ist ‘astrein’ – man merkt, dass Fachleute zu Gange waren. An Details herumzumäkeln, erscheint bei der Materialfülle schon fast kleinlich oder wie Beckmesserei. Ein Desiderat bleibt doch: Dass alle Filme der Deutschen Filmografie mit derselben Ausführlichkeit dokumentiert werden wie das bei den „Top 100“ der Fall ist. Zu krass erscheinen im Moment die etwas mickrigen Grunddaten im Vergleich zu den opulenten Dokumentationen der Top 100. Jedenfalls ist die Deutsche Filmografie ein Projekt, dem man eine Zukunft wünscht, auch weil es vielfach ausbaufähig ist und von seinen Mitarbeitern offenbar ernst genommen wird.
Beitrag aus Heft »2001/01: Hilfen für die Medienarbeit«
Autor: Fernand Jung
Beitrag als PDFEinzelansichtMichael Bloech: Gute Laune und viel Gefühl
Schickes StylingNach „Charlie & Louise – Das doppelte Lottchen“ von Joseph Vilsmaier und „Pünktchen und Anton“ von Caroline Link kommt jetzt die dritte Neuverfilmung eines Erich Kästner-Kinderbuch-Klassikers in die Kinos. Da der Produzent Peter Zenk auch noch die Rechte an „Das fliegende Klassenzimmer“ erworben hat, befindet sich der vierte Kästner-Film in Vorbereitung.
„Emil und die Detektive“ ist die wohl gelungenste Adaption in der aktuellen Reihe der Kästner-Verfilmungen. Ohne respektlos mit dem Kinderbuch aus dem Jahr 1928 umzugehen, hat die Drehbuchautorin und Regisseurin Franziska Buch die inzwischen nostalgisch anmutende Romanvorlage angenehm modernisiert. Der Film besitzt Tempo, Witz, Gefühl, Spannung und eine gehörige Portion Zeitgeist. Der inzwischen obligatorische Scooter (früher Tretroller genannt), das Handy oder der Laptop fehlen dabei ebenso wenig wie die Kreditkarte oder der Auftritt im schicken Restaurant. Geboten wird eine gehörige Portion Musik und coole action, die Kindern sicher gefallen wird. Geblieben ist das Ernsthafte der Vorlage, das Gefühl für Gerechtigkeit, das Engagement für die Belange der Kinder, das Streben nach Solidarität der Kinder untereinander und das Mitfühlen am Schicksal von Kindern aus gescheiterten Beziehungen.
Veränderte Details
Franziska Buch siedelt die Story in den bekannten klassischen Milieus Kästners an, deren Dynamik sich aus dem Zusammentreffen konträrer Lebenswelten entwickelt: sei es der Gegensatz Großstadt - Land, oder sei es das Aufeinanderprallen von Ost und West, oder seien es einfach nur die finanziellen Unterschiede. All diese Widersprüchlichkeiten treiben mit ihrer entsprechenden Dynamik die Geschichte von Emil und den Detektiven voran. Der Story verleiht das eine gewisse Realitätsnähe und macht das Zuschauen einfach interessant. Reichtum ist dann nicht per se verwerflich und Armut adelt dann eben nicht immer, von daher ist diese Kästnersche Welt in diesem Film eine mit Ecken und Kanten. Gänzlich anders als in der Vorlage sind die Rollen Gustavs mit der Hupe und Pony Hütchens gezeichnet. Ein Mädchen im 21. Jahrhundert hat einfach eine andere gesellschaftliche Rolle als eines in der ersten Hälfte des 20. In der großartigen UFA-Produktion von 1931 wird die Kinderbande noch von einem Jungen, dem frechen Gustav mit der Hupe geleitet - heute ist es Pony Hütchen, die burschikos und unangefochten die Kindergang anführt. Mit Berliner Schnauze, viel Einfühlungsvermögen und einer anständigen Dosis Mut gewinnt sie das Vertrauen und auch die Freundschaft von Emil, der ein Neuling in der großen Stadt ist. Deshalb muss Gustav konsequenterweise mit Pony Hütchen die Rollen tauschen, jetzt ist er der „Brave“, der in Berlin bei seiner überfürsorglichen Mutter (Maria Schrader) in einer repräsentativen Villa wohnt. Der Dieb wird gestelltIm Gegensatz dazu lebt der zwölfjährige Emil mit seinem arbeitslosen Vater in einem Provinzkaff an der Ostsee. Seit der Scheidung wird Emils Vater förmlich vom Pech verfolgt und das Geld ist mehr als knapp. Wie bei Kästner wird aber nicht auf die Mitleidsdrüse gedrückt, im Gegenteil.
Der Vater (Kai Wiesinger) ist mehr als sympathisch und irgendwie Lebenskünstler, der immer auch an sich selbst und natürlich an seinen, wie er sagt, großartigen Sohn glaubt. Als Emil nach einem selbstverschuldeten Autounfall des Vaters nach Berlin zur wohlhabenden Schwester seines Lehrers geschickt wird, entwendet der dubiose Max Grundeis (Jürgen Vogel) im Zugabteil dem vertrauensseligen Jungen mit einem gemeinen Trick sein mühsam gespartes Geld. Jürgen Vogel ist dabei, wen mag es verwundern, einfach umwerfend diabolisch. Er versteht es meisterhaft, neben all den bösen Seiten der Person auch leise selbstironische Züge zu verleihen.Emil hat das Ersparte deshalb mitgenommen, um in der Großstadt einen gefälschten Führerschein zu erwerben, da seinem Vater der Führerschein entzogen wurde, er aber für seinen zukünftigen neuen Job dringend auf diesen angewiesen ist. In Berlin angekommen, heftet der Junge sich an die Fersen von Max und erhält bald Unterstützung von der zwölfjährigen Pony Hütchen und ihrer Gang. Gemeinsam observieren sie den Dieb und verfolgen ihn bis zu dem noblen Hotel Adlon, wo sich der zwielichtige Halunke einmietet. Dann überschlagen sich förmlich die Ereignisse, eine dramatische Jagd nach dem Geld und nach einem mysteriösen Koffer voller Juwelen quer durch Berlin beginnt.
Am Ende zuviel GlückBesonders gelungen sind die Szenen, in denen Emil und Pony alleine agieren und dabei ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen. Tobias Retzlaff in der Rolle des Emil ist eine wahre Entdeckung. Sehr glaubwürdig und mit viel Natürlichkeit verkörpert er den netten sympathischen Jungen. Im Gegensatz dazu wirken die Szenen, in denen die Kindergang auftritt, seltsam konstruiert und ein wenig bemüht. Ihren Charme entwickeln die ‘Massenszenen’ immer nur dann, wenn sie videoclipartig montiert werden. Die temporeiche Jagd durch das mondäne und dann wieder ärmliche Berlin wird souverän von Kameramann Hannes Hubach in Szene gesetzt.
Bei aller Action kommt der Humor nicht zu kurz. Anders jedoch als bei „Pünktchen und Anton“ wird Humor für Kinder nicht mit Albernheit verwechselt. Mit augenzwinkerndem Witz wird die Geschichte erzählt und dabei wird auch das ‘Gefühl’ bedient. Vor allem die Szenen zwischen Vater und Sohn sind so voller Sentiment, dass sie gefährlich nah an den Kitsch kommen, die peinliche Grenze dann aber doch nicht überschreiten. Zu guter Letzt ist alles wieder im Lot, so wie es sich für einen Kinderfilm gehört. Der Dieb ist im Gefängnis, das Geld wieder da, der Vater bekommt einen lukrativen Job und eine Belohnung für die Juwelen im Koffer gibt es obendrein. Bei aller Freude über das glückliche und vorhersehbare Happy End wird die Story dann leider ein wenig überstrapaziert. Wie in der Anfangseinstellung sehen wir Emil in den romantischen Dünen der Ostsee beim Versteckspiel mit seinem Vater, doch jetzt findet er nicht nur ihn, sondern gleich die ganze Berliner Gang samt Pony Hütchen. Das wäre noch im Rahmen, wenn nicht auch noch Emils Vater die Mutter von Gustav verliebt im Arm hielte. Weniger ist bekanntlich oft mehr, dennoch bleibt beim Abspann das Gefühl, wieder einmal einen guten unterhaltsamen Kinderfilm gesehen zu haben. Und wer sich jetzt ärgern sollte, dass das Ende hier verraten wurde, dem sei zur Beruhigung gesagt, dass es bis zu dem überglücklichen Finale viel Überraschendes und Turbulentes zu erleben gibt.
Beitrag aus Heft »2001/01: Hilfen für die Medienarbeit«
Autor: Michael Bloech
Beitrag als PDFEinzelansichtMaría Luisa Sevillano García: Lernen mit Printmedien
Das Misstrauen wird abgebautIn den letzten zwanzig Jahren hat sich das Verhältnis zwischen Tageszeitungen, Schulbehörden und Schulwesen in Spanien grundlegend verändert. Die Zahl der theoretischen und praktischen Aufsätze über Vor- und Nachteile der Verwendung von Tageszeitungen im Schulunterricht nahm stetig zu. Einige Lehrer begannen in der Schulpraxis Tageszeitungen zu verwenden. Zunächst allerdings wandten sich Schulaufsichtsbehörden und Eltern mit folgenden Begründungen gegen solche Neuigkeiten: drohende Politisierung des Unterrichts und Verlust der Kontrolle über die Curricula. Es wurde der Vorwurf erhoben, dass die Schule auf diesem Weg und mit diesen Mitteln keine ernsthafte Bildung vermitteln könne, sondern diese bruchstückhaft bleibe. Das war auch eine versteckte und zum Teil gerechtfertigte Kritik an der Qualität der Tageszeitungen.
(merz 2001-01, S. 54-56)
Beitrag aus Heft »2001/01: Hilfen für die Medienarbeit«
Autor: María Luisa Sevillano García
Beitrag als PDFEinzelansicht
publikationen
Bernd Schorb: Auch geistige Waren brauchen Qualitätsschutz
Information ist ein Bürgerrecht mit einem so hohen Rang, dass es sowohl in der Verfassung der USA verankert ist, als auch in der zukünftigen europäischen. Die Informationsfreiheit gilt als Basis einer demokratischen Gesellschaft.Die publizistischen Medien sind die vierte Macht im Staat, ihre Aufgabe ist es, unabhängig von der Staatsgewalt diese zu kontrollieren, unabhängig und überparteilich. Diesen oder einen ähnlichen Satz lernen unsere Kinder schon in der Schule.
Aber: Deregulierung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um dem Markt der neuen Medien eine Entwicklungschance zu geben. So verkünden es Bundes- und Landesregierungen.Information ist eine Ware, die sich auf den neuen Medienmärkten realisiert. Wer über die meisten Informationen und die entsprechenden Distributionsmöglichkeiten verfügt, der hat auf den neuen Märkten die besten Chancen. Diesen oder einen ähnlichen Lehrsatz kennt heute jeder Kleinaktionär aus den Börsennachrichten.Wie geht das zusammen? Wenn Deregulierung bedeutet, dass jeder, der über Information verfügt, frei ist, mit dieser zu tun, was immer er will, sie zu horten, zu verkaufen, zu verändern, zu vernichten ... Wenn Information eine Ware ist, die wie jede andere Ware, wie Schlagringe, Rindfleisch oder Bordeaux-Wein gehandelt wird... Wer sichert dann die Qualität der Information? Wer sichert das Recht, tatsächlich über alle öffentlichen Informationen verfügen zu können. Wer macht öffentlich bedeutsame Informationen öffentlich und wer verhindert, dass Informationen über das Privatleben der Menschen öffentlich werden?
Das hehre Gut Information ist dabei, zu einer beliebigen und austauschbaren Handelsware zu werden. Als geistige Nahrung für ein gesundes Leben der Menschen ebenso wichtig wie die ess- und trinkbaren Lebensmittel erleidet sie das gleiche Schicksal wie diese. Sie kann nutzen oder schaden, ist echt oder künstlich, keiner kann es wirklich unterscheiden. Die Nahrung kann gut schmecken und doch schädigen. Aus dem Bereich der Lebensmittel lernen wir täglich neue Beispiele kennen, die darauf verweisen, dass die Selbstverantwortung der Produzenten schwindet, wenn es um den Profit geht. Ist es beim Fernsehen anders, kann man sich hier auf den Geschmack der Konsumenten oder die Verantwortung der Produzenten verlassen?
Wer sichert uns die Qualität der Information?Sind es die attraktiven Informationssendungen? Vielleicht ein Sender, der nur einmal am Tag Nachrichten ausstrahlt, deren Inhalt von den neuesten Entwicklungen im Big Brother-Container bis zu den Beziehungsproblemen eines Filmstars reicht? Oder belehren uns gar die Informationsmagazine, die schon mit ihren Namen verdeutlichen, dass es ihnen um Brisantes, Blitze und Explosionen geht und uns eine Welt voller großer Menschen in Glamour und kleiner Menschen im Schrecken darbieten?
Sind es die Journalisten? Vielleicht gerade jene, die aus der privaten frisch gegründeten Ausbildungsstätte eines Senders stammen, dem das Lehrangebot der renommierten Journalistenschulen nicht mehr zugesagt hatte. Unzeitgemäß fand er deren Ausbildung, stellte seine Unterstützung ein und gründete eine hauseigene. Eine Landesmedienanstalt stieg mit ihren Einkünften aus unserem Kabelgroschen bei dieser Senderschule mit ein - um die Qualität der Ausbildung zu sichern? Oder sind es die neuen Real-Life-Shows? Wird uns nicht live in Laborexperimenten präsentiert, wie sich junge Menschen in geschlossenen Räumen verhalten? Erfahren wir nicht in unzähligen Talkshows, welche Probleme sich hinter der Fassade des Alltags verbergen? Oder können nicht junge Frauen lernen, wie sie sich prostituieren müssen, um einen Millionär zu ergattern?
Die Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen und täglich kommen neue hinzu. Mit jedem Beispiel stellt sich die Frage wieder, ob die Deregulierung des Medienmarktes der allein selig machende Weg in die gelobte Medienzukunft ist, oder ob es nicht doch so etwas wie der Regeln eines medialen Anstandes bedarf?Wenn der Vergleich stimmt, dass Information für unseren Geist die gleiche Bedeutung hat wie Speis und Trank für unseren Körper, dann haben wir auch ein Recht darauf, die Qualität von Information gesichert zu bekommen, durch Sendungen, die die Welt nicht als Lügengebäude darstellen, durch Informationen, die wirklich von Nutzen sind, um unser privates wie das gesellschaftliche Leben zu gestalten, durch Wahrung der Würde auch der Menschen, die nicht fähig sind, sich selbst vor Exhibitionismus und Voyeurismus zu bewahren, und durch unabhängige kritische und selbstkritische Informations-Macher.
Beitrag aus Heft »2001/01: Hilfen für die Medienarbeit«
Autor: Bernd Schorb
Beitrag als PDFEinzelansicht
Ansprechperson
Kati StruckmeyerVerantwortliche Redakteurin
kati.struckmeyer@jff.de
+49 89 68 989 120
Ausgabe bei kopaed bestellen
Zurück